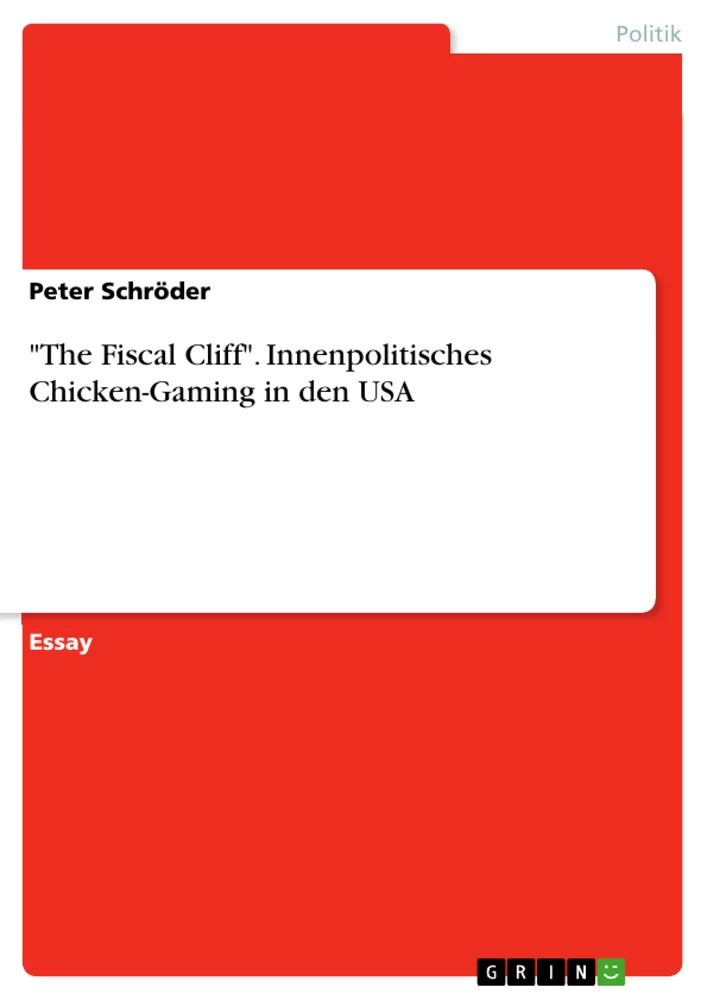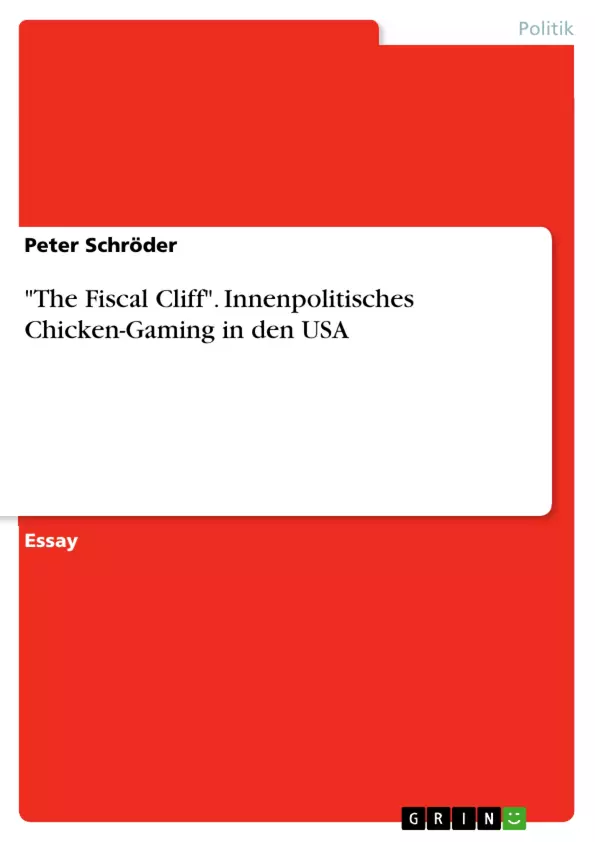Als föderalistische Mehrheitsdemokratie ist es insbesondere ein Merkmal der Politik und der politischen Entscheidungen der USA, dass sie zuweilen kurzfristig, entsprechend wenig nachhaltig und teils populistisch anmuten. Auch im Fall der drohenden Zahlungsunfähigkeit, dem Fiscal Cliff, auf welches die USA in den letzten Wochen des Jahres 2012 und auch aktuell noch zusteuern, zeigen sich diese systemischen Schwächen der Demokratieform. Welche Akteure hier beteiligt sind und welche Handlungsmotive sie aufweisen ist ebenso Inhalt dieses Essays, wie die allgemeine Form dieses politischen Prozesses, welcher nicht ohne Grund mit dem aus einer früheren Form der Jugendkultur stammenden "Chicken-Gaming" verglichen wird.
Dieser Prozess wird historsich betrachtet und auf das aktuelle Beispiel des Fiscal Cliffs übertragen. Dabei werden auch mögliche Handlungsspielräume abgestekt, bevor schließlich diese Betrachtung zu einer These über den möglichen Fortgang oder eben ein Ende dieser Krise führt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Herleitung und politische Bedeutung
- Das Chicken-Game der Spieltheorie
- Aktuelles Beispiel: Fiscal-Cliff in den USA
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit dem Phänomen des „Fiscal Cliffs" in den USA und analysiert dieses anhand des Begriffs „Chicken-Game" aus der Spieltheorie. Ziel ist es, die historische Herleitung und politische Bedeutung des Chicken-Game zu erläutern und dieses anhand des Beispiels des Fiscal-Cliffs zu beschreiben. Der Essay beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Chicken-Game im Rahmen der Spieltheorie und untersucht die Anwendung dieses Konzepts auf die politische Situation in den USA.
- Das Chicken-Game als Form der Eskalationspolitik
- Anwendung des Chicken-Game in der Politik
- Die Spieltheorie und das Gefangenendilemma
- Das Fiscal Cliff als Beispiel für ein Chicken-Game
- Die Rolle von Kommunikation und Informationsasymmetrie im Chicken-Game
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung führt in das Thema „Fiscal Cliff" ein und beschreibt die Situation in den USA im Jahr 2012. Dabei wird auf die drohende Insolvenz der USA aufgrund des Auslaufens von Steuererleichterungen und gleichzeitig einsetzenden Ausgabenkürzungen hingewiesen. Der Essay kündigt die Analyse des „Chicken-Game" als theoretisches Konzept an, um die politische Situation im Kontext des Fiscal-Cliffs zu verstehen.
-
Im zweiten Kapitel wird die historische Herleitung des Begriffs „Chicken-Game" aus den USA der 1950er Jahre erläutert. Es wird auf die Mutprobe mit zwei Wagen auf einer Straße hingewiesen, bei der derjenige, der zuletzt ausweicht, als Verlierer gilt. Die Übertragung dieses Konzepts auf den Bereich der Politik wird erklärt: Zwei Akteure mit konträren Meinungen versuchen, eine kontrollierte Eskalation der Situation zu provozieren, um den jeweils anderen mürbe zu machen. Die Grundlage für dieses Verhalten liegt in der Spieltheorie, insbesondere dem Gefangenendilemma.
-
Kapitel drei beschäftigt sich mit der Spieltheorie und dem Chicken-Game als einer ihrer Grundspielarten. Die Spieltheorie, ursprünglich aus der Mathematik stammend, wurde auf die Wirtschaftswissenschaften übertragen und findet Anwendung in verschiedenen Wissenschaften. Die Spieltheorie ermöglicht die Analyse rationaler Handlungsmuster und die Vorhersage von Handlungen in Entscheidungssituationen. Das Chicken-Game zeichnet sich durch zwei Akteure mit einer dominanten Strategie aus, die in einer konkreten Situation handeln müssen. Die verschiedenen Vorgehensweisen werden in Kooperation und Defektion unterschieden. Das Nash-Gleichgewicht beschreibt die jeweils beste Strategie als Antwort auf mögliche Züge des anderen Spielers. In Situationen mit Informationsasymmetrie wird das Gleichgewicht minimiert, was zu einem asymmetrischen Ergebnis führt. Kommunikation kann als Instrument zur Vorteilsschaffung und Verwirrungsstiftung in einem Entscheidungsprozess eingesetzt werden. Der sequenzielle Verlauf eines Entscheidungsprozesses ermöglicht es, auf die Züge des anderen Akteurs zu reagieren und diesen zu tarieren. Im Chicken-Game riskieren zwei Gegenspieler eine absolute Eskalation, die für beide die denkbar schlechteste Lösung darstellt.
-
Das vierte Kapitel behandelt das aktuelle Beispiel des Fiscal-Cliffs in den USA. Die Situation um die Jahreswende 2012/13 wird beschrieben, bei der das Überschreiten einer selbstgesetzten Schuldengrenze drohte. Die Kombination von Steuererleichterungen, die auslaufen sollten, und automatisch einsetzenden Ausgabenkürzungen führte zu einer Krisensituation. Die politischen Rahmenbedingungen, die zu einer Einigung erst zum letztmöglichen Zeitpunkt führten, werden erläutert. Dazu gehören die Lame Duck Session des Senats, die unklaren Machtverhältnisse zwischen den Parteien und die bevorstehende Wahl. Die Parteien sahen das Risiko und das Potential des Fiscal-Cliffs als Druckmittel gegen die jeweils regierende Partei. Die Voraussetzungen für ein Chicken-Game waren damit erfüllt. Die Verhandlungen wurden intensiviert, die Medien berichteten weltweit über das Risiko und die potentiellen Folgen für die Weltwirtschaft. Die Akteure konnten ihre Motive und Gewinne in dieser Situation kaum einschätzen, was zu einer vagen Vermutung von Präferenzen führte. Beide Parteien sahen ein Nichtlösen des Problems als nicht infrage kommend an und vertrauten darauf, dass der Gegner einlenken würde. Schließlich einigten sich beide Seiten auf einen zeitlich befristeten Kompromiss, da sie sich nicht sicher waren, ob nicht doch die andere Fraktion einlenken würde. Die zeitliche Komponente wurde genutzt, um den Druck zu erhöhen und mögliche Folgen für die Wahlen zu vermeiden. Die Eskalation des Konflikts wurde gezielt in den letzten Wochen des Jahres 2012 herbeigeführt. Beide Parteien zeigten sich wenig kompromissbereit, was zu einem Verhandlungsprozess führte, der schließlich zu einem Kompromiss führte. Der Kompromiss stellt jedoch lediglich eine Vertagung des Problems dar, da die Fristen nur um zwei Monate verschoben wurden. Die Situation kann daher zu einer erneuten Eskalation führen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Chicken-Game, die Spieltheorie, das Gefangenendilemma, der Fiscal Cliff, die US-Politik, die Eskalationspolitik, Informationsasymmetrie, Kommunikation, die Lame Duck Session, die Schuldengrenze, die Steuererleichterungen, die Ausgabenkürzungen, die politische Kompromissfindung und die politische Entscheidungsfindung in den USA.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Fiscal Cliff" in den USA?
Es bezeichnete die drohende Zahlungsunfähigkeit der USA Ende 2012 durch das gleichzeitige Auslaufen von Steuererleichterungen und automatische Ausgabenkürzungen.
Was versteht man unter dem "Chicken-Game" in der Politik?
Ein Spieltheorie-Konzept, bei dem zwei Akteure auf einen Abgrund zusteuern und darauf warten, dass der andere zuerst ausweicht (nachgibt).
Welche Rolle spielt die Spieltheorie bei politischen Krisen?
Sie hilft dabei, rationale Handlungsmuster und Strategien wie das Gefangenendilemma oder das Nash-Gleichgewicht in Entscheidungssituationen zu analysieren.
Warum kam es beim Fiscal Cliff erst in letzter Sekunde zu einer Einigung?
Beide Parteien nutzten die Eskalation als Druckmittel, wobei die "Lame Duck Session" des Senats und Informationsasymmetrien den Prozess verzögerten.
Was war das Ergebnis der Verhandlungen zum Fiscal Cliff?
Es wurde ein befristeter Kompromiss gefunden, der das Problem jedoch nur vertagte, statt eine nachhaltige Lösung zu bieten.
- Quote paper
- Peter Schröder (Author), 2013, "The Fiscal Cliff". Innenpolitisches Chicken-Gaming in den USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271942