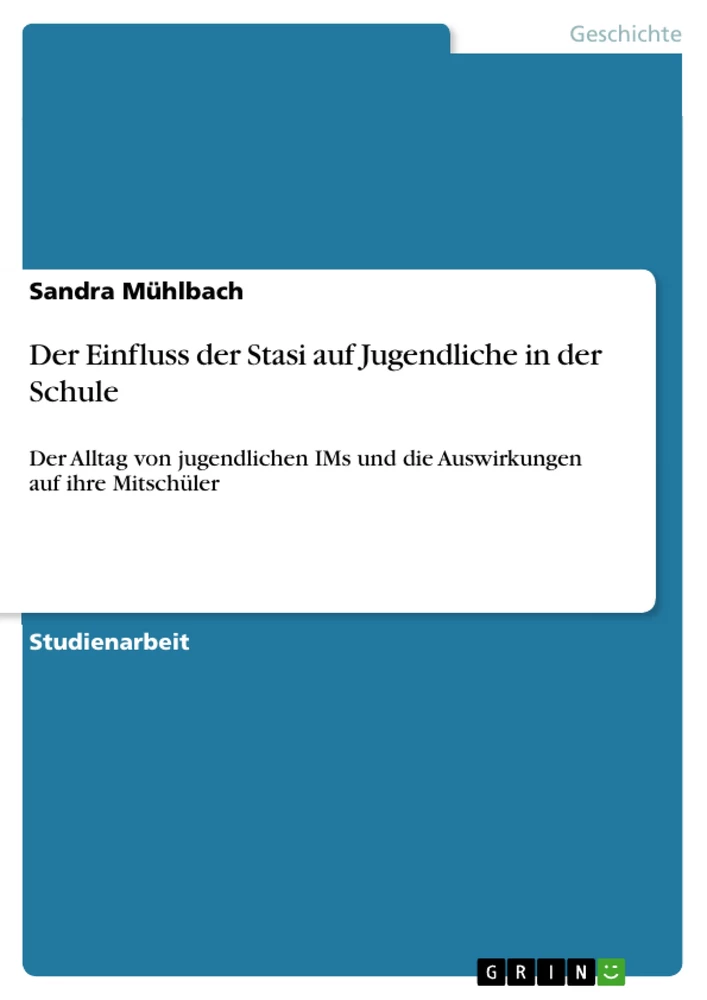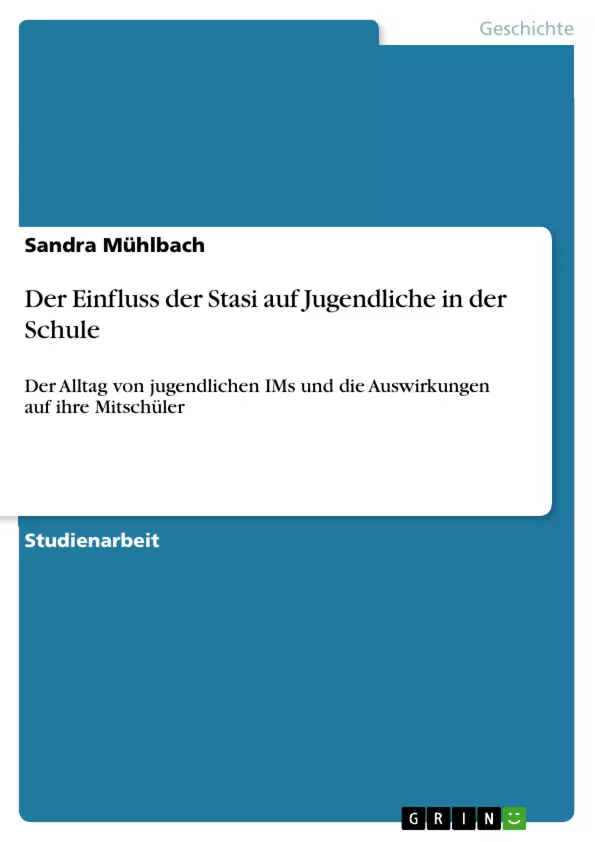Das Ministerium für Staatssicherheit gilt heute als Symbol für das unterdrückte und überwachte Leben in der Diktatur des zweiten deutschen Staates. Die Stasi war der verlängerte Arm der Partei, sie sicherte die Macht der SED um jeden Preis. Seit ihrer Gründung im Jahr 1950 versuchte sie, einen Staat zusammen zu halten, in dem sie ein System der Angst, des gegenseitigen Misstrauens und des Verrats installierte. Schätzungsweise 173.000 inoffizielle Mitarbeiter gab es im Jahr 1989 kurz vor dem Zusammenbruch der DDR. Sie waren angehalten Freunde und Mitmenschen zu überwachen und ihre Geheimnisse, ihre Ängste und Freuden der Stasi preis zu geben.
Heute ist das Bedürfnis der gesamtdeutschen Bevölkerung groß, die Verbrechen des MfS zu rekonstruieren und aufzudecken. Über sechs Millionen Anträge auf Akteneinsicht gingen bei der Bundesbehörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen bis heute ein. Bespitzelte sichten ihre Akten, IMs stellen sich ihrer Vergangenheit. 2006 zieht es die Zuschauer ins Kino um „Das Leben der Anderen“ zu sehen. Ein Drama über einen IM und die Familie, die er bespitzelte.
Die Verbrechen des Ministeriums für Staatssicherheit umfassten unzählige Facetten der Unmenschlichkeit, betreffen eine nicht definierbare Vielzahl an Personengruppen und waren vielfältig in ihrer Intensität. Moralisch besonders verwerflich und zumindest medial bislang wenig thematisiert ist der Missbrauch von Minderjährigen durch das Ministerium für Staatssicherheit. Zirka 6% aller Inoffiziellen Mitarbeiter waren minderjährig; das entspricht etwa 6.000 bis 10.000 Jungen und Mädchen unter 18 Jahren. Sie bespitzelten ihre Freunde und Klassenkameraden teils freiwillig, oft jedoch unter massivem Druck und unter dem Einsatz von Erpressung. Sie leisteten ihren Beitrag zum Kampf der Stasi, gegen die vermeintlichen Staatsfeinde. Die Folgen waren zerstörte Freundschaften, missbrauchtes Vertrauen und langjährige, beziehungsweise dauerhafte Beeinträchtigungen der psychischen und physischen Gesundheit der Betroffenen.
Häufig wurden die Jugendlichen in ihrer Schule angeworben. Ein Raum der für viele neben der FDJ oder anderen Freizeitgestaltungenden am meisten für die Entwicklung intensiver Freundschaften prädestiniert war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hinführung und Fragestellung
- Das Schulsystem der DDR und die dessen Bindung an die SED
- Einfluss der Stasi innerhalb des Schulsystems
- Hauptteil
- Personenverzeichnis
- Tätigkeiten der jugendlichen IMS
- Folgen für den eigenen Alltag und den der Mitschüler
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den Einfluss der Stasi auf den schulischen Alltag von Jugendlichen in der DDR. Der Fokus liegt dabei auf den Tätigkeiten von jugendlichen Inoffiziellen Mitarbeitern (IMs) und deren Auswirkungen sowohl auf die IMs selbst als auch auf ihre Mitschüler.
- Rekrutierung von jugendlichen IMs in der DDR
- Tätigkeiten der jugendlichen IMs in der Schule und im Freundeskreis
- Folgen der IM-Tätigkeit für die IMs und ihre Mitschüler
- Die Rolle des Schulsystems in der DDR als Instrument der SED-Propaganda
- Die psychischen Folgen der IM-Tätigkeit für die betroffenen Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor. Dabei wird zunächst auf die Rolle der Stasi als Instrument der SED-Macht und die Bedeutung der jugendlichen IMs im Kontext der DDR-Geschichte eingegangen. Anschließend wird das Schulsystem der DDR und dessen enge Verzahnung mit der SED-Ideologie beleuchtet. Im letzten Teil der Einleitung wird der Einfluss der Stasi innerhalb des Schulsystems beschrieben und die Rekrutierung von jugendlichen IMs in diesem Kontext thematisiert.
Der Hauptteil der Hausarbeit beleuchtet die Tätigkeiten der jugendlichen IMs und deren Folgen für den eigenen Alltag und den der Mitschüler. Dabei werden die verschiedenen Aufgabenfelder der jugendlichen IMs, wie die Überwachung von Mitschülern und die Bespitzelung von Freundeskreisen, anhand von Fallbeispielen und Zeitzeugenaussagen dargestellt. Außerdem werden die psychischen Folgen der IM-Tätigkeit für die betroffenen Jugendlichen, wie Angst, innere Zerrissenheit und Abhängigkeit, aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Stasi, jugendliche Inoffizielle Mitarbeiter (IMs), DDR-Schulsystem, SED-Ideologie, Überwachung, Bespitzelung, psychischer Missbrauch, Folgen der IM-Tätigkeit, Schulalltag, Freundeskreis, Angst, Abhängigkeit, Zerrissenheit, Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele jugendliche IMs gab es schätzungsweise in der DDR?
Schätzungen zufolge waren etwa 6.000 bis 10.000 Jungen und Mädchen unter 18 Jahren als Inoffizielle Mitarbeiter für die Stasi tätig.
Warum wurden Jugendliche in der Schule angeworben?
Die Schule war ein zentraler Ort für soziale Kontakte und Freundschaften, was sie für die Stasi ideal machte, um Informationen über die Stimmung und „staatsfeindliche“ Tendenzen unter Jugendlichen zu sammeln.
Mit welchen Methoden wurden Schüler zur Mitarbeit bewegt?
Einige handelten freiwillig aus Überzeugung, viele wurden jedoch unter massivem Druck, Erpressung oder durch das Versprechen von Studienplätzen angeworben.
Welche Folgen hatte die IM-Tätigkeit für die Betroffenen?
Die Folgen waren oft zerstörte Freundschaften, missbrauchtes Vertrauen sowie langjährige psychische Belastungen und Identitätskonflikte.
Wie war das DDR-Schulsystem mit der SED verknüpft?
Das Schulsystem diente als Instrument der SED-Propaganda und war eng an die Parteilinie gebunden, um die Jugend im Sinne des Sozialismus zu erziehen.
- Arbeit zitieren
- Sandra Mühlbach (Autor:in), 2013, Der Einfluss der Stasi auf Jugendliche in der Schule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272004