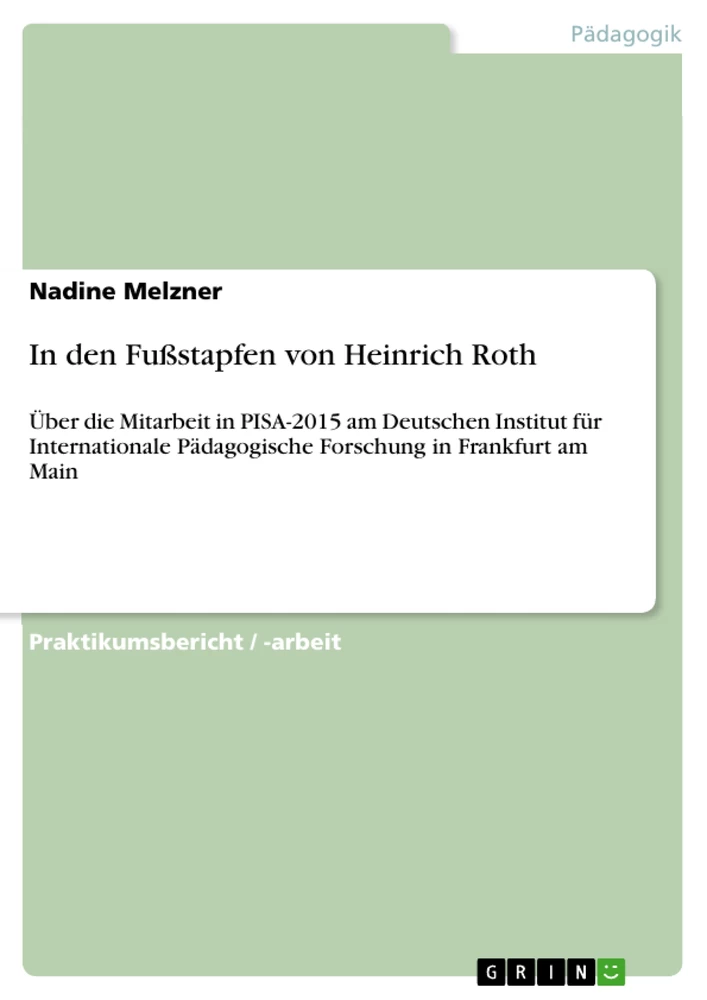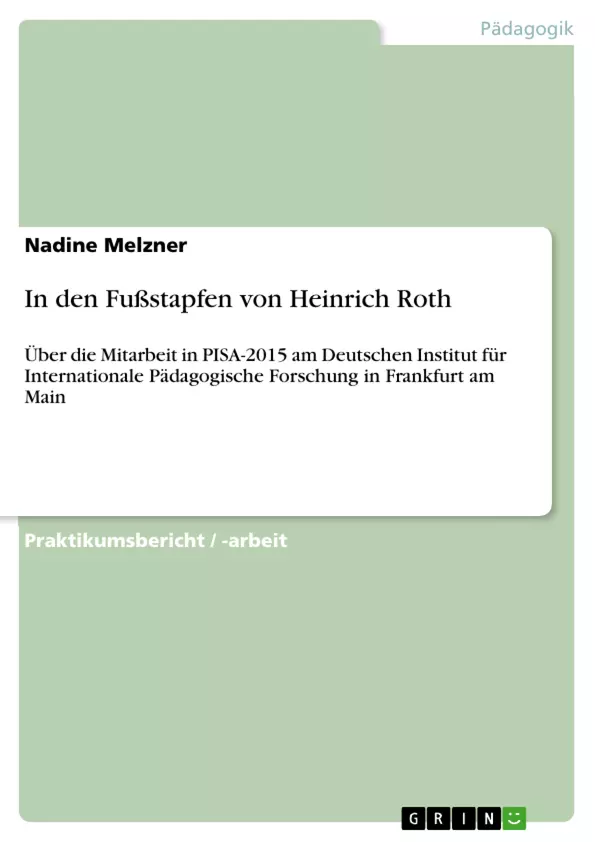Im Bachelor-Studiengang Pädagogik ist an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg nach Wahl eines von drei Schwerpunkten ein Pflichtpraktikum von mindestens 240 Stunden angesetzt. Das Praktikum, welches im folgenden Bericht genauer analysiert wird, wurde im Bereich der Elementar- und Familienpädagogik durchgeführt. Die Auswahl einer geeigneten Stelle erfolgte bereits zu Beginn des vierten Semesters, als im Rahmen der universitären Praktikumsvorbereitung auf die Chance eines Forschungspraktikums hingewiesen wurde. Um diese Chance zu nutzen und zu entscheiden, ob der Master „Empirische Bildungsforschung“ eine geeignete Studienfachwahl nach dem Pädagogikstudium sein könnte, war ein Forschungspraktikum zweifelsfrei die beste Entscheidungshilfe. Institutionsvorschläge lieferte die in der Studienveranstaltung anwesende Dozentin. Die empfohlenen Einrichtungen im näheren Umfeld Bambergs waren bereits bis in den Winter hinein ausgelastet, aber die Anfrage bei dem persönlichen Favoriten stand noch offen. Und so kam die Zusage vom Deutschen Institut für internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt am Main, dem Institut, an dem bereits Heinrich Roth bewundernswerte Forschungsresultate zu Papier brachte.
Durch die universitäre Empfehlung ging der Bewerbungsprozess sehr zügig von der Hand. Ein erstes Kennenlernen, welches im Voraus telefonisch vereinbart wurde, fand an einem Samstag statt, an dem die Praktikums-Betreuerin vom DIPF eine Lehrveranstaltung an der Universität Bamberg hielt. In den Folgemonaten fiel lediglich etwas Formalie an, um die Verschwiegenheitspflicht, die Vergütungsabrechnung, den Aufenthalt etc. entsprechend zu regeln. Das Praktikum erstreckte sich vom 20.08.2013 bis zum 04.10.2013, der Arbeitstag startete täglich um 08:30 und endete um Punkt 17:00 Uhr (in der abschließenden Woche hingegen von 07:30 bis 18:00 Uhr). Aufgrund der Anwesenheiten der am Institut festangestellten Teamkollegen wurden die Praktikumszeiten im Wesentlichen auf die Wochentage Montag – Donnerstag verteilt.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Arbeit und inhaltlicher Aufbau
- Benennung und Begründung der konkreten Fragestellungen
- Hauptteil: Tätigkeitsbericht und Arbeitsbericht
- Wissenschaftliche Bearbeitung des Tätigkeitsberichtes
- Detaillierte Wiedergabe der ersten drei Arbeitstage
- Nachskizzierung der Abschlusstage im Institut
- Zusammenfassung, Quantifizierung: Klassifikation der Tätigkeiten
- Wissenschaftliche Bearbeitung des Arbeitsberichtes
- Anpassungsprozesse im Schnittpunkt weltweiter Vernetzung
- Ergebnis der Adaptationen im Lehrerfragebogen
- Stellenwert der Arbeit für die Angestellten
- Wissenschaftliche Bearbeitung des Tätigkeitsberichtes
- Theoretische Reflexion
- Kritische Überlegungen zu PISA
- Picht, Dahrendorf und die Verdienste der Studie
- Schwachpunkte im Zusammenhang mit PISA
- Bilanzierung / Fazit bezüglich PISA und des Praktikums
- Kritische Überlegungen zu PISA
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Praktikumsbericht befasst sich mit der Mitarbeit der Autorin in PISA-2015 am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt am Main. Der Bericht zeichnet die Arbeitsabläufe und Tätigkeiten während des Praktikums nach und reflektiert die gewonnenen Erkenntnisse im Kontext der PISA-Studie. Ziel ist es, die Rolle des DIPF während der Projektphase zu beleuchten, zentrale Ergebnisse der Adaptationen im Lehrerfragebogen zu analysieren und den Stellenwert der Mitarbeit im PISA-Team für die Mitarbeiter aus privater und dienstlicher Sicht zu erörtern.
- Rolle des DIPF im PISA-Projekt
- Ergebnisse der Adaptationen im Lehrerfragebogen
- Stellenwert der Arbeit im PISA-Team für die Mitarbeiter
- Kritik an PISA
- Verdienste der PISA-Studie
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Entstehung des Praktikums und die Auswahl des DIPF als Praktikumsstelle erläutert. Die Autorin beschreibt die Organisation und den Ablauf des Praktikums und benennt die drei Hauptfragestellungen, die während des Praktikums im Vordergrund standen.
Das zweite Kapitel gliedert sich in einen Tätigkeits- und einen Arbeitsbericht. Der Tätigkeitsbericht beschreibt die Aufgaben und Tätigkeiten der Autorin während des Praktikums, insbesondere die Arbeit mit dem Lehrerfragebogen. Der Arbeitsbericht analysiert die Anpassungsprozesse im Lehrerfragebogen im Kontext der weltweiten Vernetzung, die Ergebnisse der Adaptationen und den Stellenwert der Arbeit im PISA-Team für die Mitarbeiter.
Im dritten Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse im Kontext der PISA-Studie reflektiert. Die Autorin diskutiert die Verdienste der Studie und die Bedeutung der Ergebnisse für die Bildungspolitik. Sie geht auch auf die Kritik an PISA ein und untersucht die Schwachpunkte des Projekts.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die PISA-Studie, das Deutsche Institut für internationale pädagogische Forschung (DIPF), die Anpassungsprozesse im Lehrerfragebogen, die Rolle des DIPF im PISA-Projekt, die Verdienste der PISA-Studie, die Kritik an PISA und die Auswirkungen der PISA-Ergebnisse auf die Bildungspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wo wurde das Forschungspraktikum absolviert?
Das Praktikum fand am Deutschen Institut für internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt am Main statt.
An welcher bekannten Studie hat die Autorin mitgearbeitet?
Die Autorin war an der Projektphase von PISA-2015 beteiligt.
Was war ein zentraler Aufgabenbereich während des Praktikums?
Ein Schwerpunkt lag auf den Adaptationsprozessen und der Arbeit mit dem Lehrerfragebogen im Kontext weltweiter Vernetzung.
Welche kritischen Aspekte werden im Bericht reflektiert?
Der Bericht reflektiert sowohl die Verdienste der PISA-Studie für die Bildungspolitik als auch Schwachpunkte und allgemeine Kritik an dem Projekt.
Warum wurde ein Forschungspraktikum gewählt?
Es diente als Entscheidungshilfe, ob der Masterstudiengang „Empirische Bildungsforschung“ die richtige Wahl nach dem Pädagogikstudium ist.
- Citar trabajo
- Nadine Melzner (Autor), 2013, In den Fußstapfen von Heinrich Roth, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272062