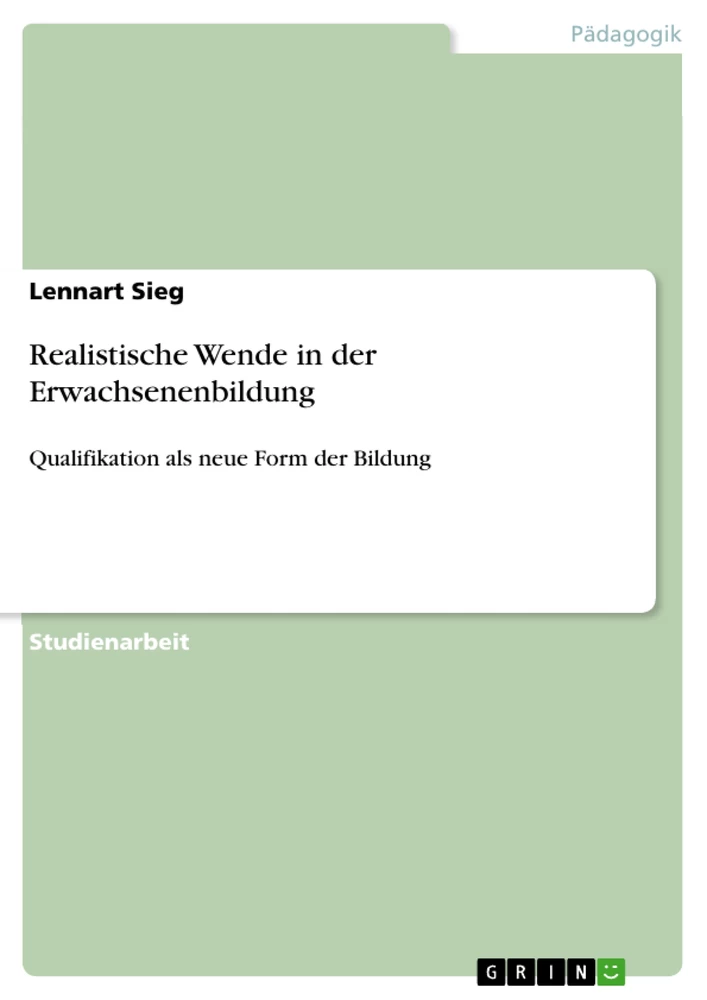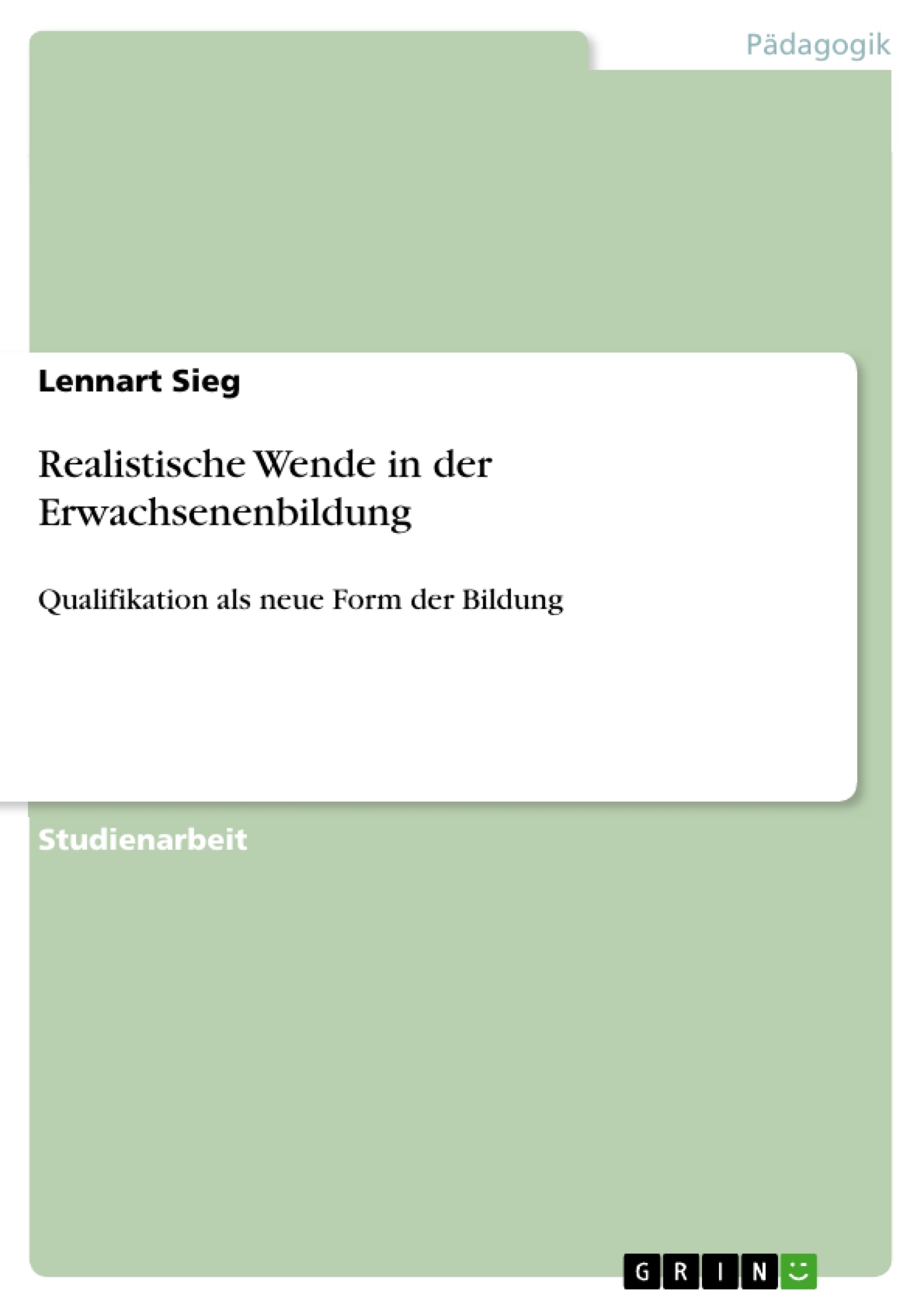In den 1960/1970er Jahren gab es einen Umbruch in der Deutschen Bildungslandschaft, der so massiv war, dass seine Auswirkungen heute nach wie vor zu spüren sind. Die realistische Wende der Erziehungswissenschaft war eine, von einer eher geisteswissenschaftlich geprägten Wissenschaft hin zur Erziehungswissenschaft sozialwissenschaftlicher Prägung. Heute sieht man die Auswirkungen im schulischen Bereich an Phänomenen wie der PISA-Studie. Für den Bereich der Erwachsenenbildung und der Weiterbildung geht die realistische Wende mit der Emergenz von privaten Bildungsträgern, wie z.B. VW Coaching, und der Ökonomisierung der Bildung einher.
Kennzeichnend für den Beginn des Diskurses um Bildung nach sozialwissenschaftlicher Maßgabe in den 1960er und 1970er Jahren ist der Qualifikationsbegriff. Anstatt des klassischen Bildungskanons sollten für die verschiedenen Tätigkeiten eines Erwachsenen Qualifikationen empirisch erarbeitet und für deren Vermittlung dann ein Curriculum erstellt werden.
Ich setze mich in meiner Arbeit mit der Entstehung des Qualifikationsbegriffs im Rahmen curricularer Forschung auseinander. Ziel ist es, die Anfänge des Diskurses um den Qualifikationsbegriff und die Notwendigkeit dieses Konstrukts in der Erziehungswissenschaft, seine Bedeutung und seine Leistungsfähigkeit zu verstehen. Dabei gehe ich zunächst darauf ein, warum einige Wissenschaftler sich überhaupt vom klassischen Bildungsideal trennen wollten. Danach widme ich mich den Konsequenzen der Qualifikationsforschung für die Erwachsenenbildung/Weiterbildung und schließlich wende ich mich den methodischen Problemen, die in der Qualifikationsforschung angelegt sind, zu.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Qualifikationsbegriff — Warum Bildung überwinden?
- Göttinger Studie — Angriff auf den klassischen Bildungsbegriff
- Robinsohns Überlegung zu einer empirisch fundierten Bildung
- Konsequenzen der Qualifikationsforschung für die Erwachsenenbildung/Weiterbildung
- Grundlegende Thesen
- Dequalifizierung und Entberuflichung oder Humanisierung des Arbeitsmarkts
- Methodische Schwächen der Qualifikationsforschung
- Resümee
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entstehung des Qualifikationsbegriffs im Rahmen curricularer Forschung und analysiert dessen Bedeutung für die Erziehungswissenschaft, insbesondere im Kontext der Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Die Arbeit untersucht die Gründe, warum einige Wissenschaftler sich vom klassischen Bildungsbegriff lösen wollten, die Konsequenzen der Qualifikationsforschung für die Erwachsenenbildung und Weiterbildung sowie die methodischen Schwächen der Qualifikationsforschung.
- Die Abkehr vom klassischen Bildungsbegriff und die Notwendigkeit eines neuen Konzepts
- Die Auswirkungen der Qualifikationsforschung auf die Erwachsenenbildung und Weiterbildung
- Die methodischen Herausforderungen und Probleme der Qualifikationsforschung
- Die Bedeutung der Qualifikationsforschung für die Entwicklung der Bildung und des Arbeitsmarktes
- Die Relevanz von Selbstreflexion und Selbstkritik in der Qualifikationsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt die realistische Wende in der Erziehungswissenschaft, die mit der Emergenz des Qualifikationsbegriffs einhergeht. Die Arbeit untersucht die Entstehung des Qualifikationsbegriffs im Kontext der „Göttinger Studie“ und der Überlegungen Saul Robinsohns zur Bildungsreform. Die Göttinger Studie zeigt, dass der klassische Bildungsbegriff in den 1960er Jahren an Bedeutung verloren hatte und als Mittel zur Ausgrenzung fungierte. Robinsohn plädiert für ein sozialwissenschaftlich begründetes Curriculum, das auf empirischen Erkenntnissen basiert und die Bildungsinhalte ständig rationalisiert und objektiviert. Er definiert Qualifikation als Lernbausteine einer modularen Bildung, die auf die Bewältigung von Situationen und die dazu notwendigen Funktionen ausgerichtet ist. Robinsohn formuliert außerdem wesentliche Erziehungsparadigmen wie Kommunikationserziehung, Bereitschaft zur Veränderung, Wahl im Konsum und Autonomie.
Das zweite Kapitel widmet sich den Konsequenzen der Qualifikationsforschung für die Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Thesen zur Entwicklung der Qualifikationsanforderungen an den Arbeiter, wie die These der allgemeinen Höherqualifizierung, die Polarisierungsthese und die Dequalifizierungsthese. Die Arbeit diskutiert auch die Entberuflichung der Arbeitswelt und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Die Arbeit zeigt, dass die Qualifikationsforschung die Entstehung neuer Formen der Weiterbildung und neue soziale Herausforderungen in der Erwachsenenbildung bewirkt.
Das dritte Kapitel analysiert die methodischen Schwächen der Qualifikationsforschung. Die Arbeit kritisiert die mangelnde Klarheit des Qualifikationsbegriffs, die Schwierigkeit der Operationalisierung von Bildung und die Gefahr der Manipulation durch Interessengruppen. Die Arbeit diskutiert außerdem die Bedeutung der Selbstreflexion und Selbstkritik in der Qualifikationsforschung und stellt fest, dass der Kompetenzbegriff im Vergleich zum Qualifikationsbegriff flexibler und umfassender ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Qualifikationsbegriff, die realistische Wende in der Erziehungswissenschaft, die Erwachsenenbildung, die Weiterbildung, die Göttinger Studie, Saul Robinsohn, die Dequalifizierung, die Entberuflichung, die Humanisierung des Arbeitsmarktes, die methodischen Schwächen der Qualifikationsforschung und die Bedeutung von Selbstreflexion und Selbstkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der "realistischen Wende" in der Erziehungswissenschaft?
Es war der Umbruch in den 1960/70er Jahren von einer geisteswissenschaftlich geprägten hin zu einer sozialwissenschaftlich orientierten Erziehungswissenschaft.
Warum wurde der klassische Bildungsbegriff durch den "Qualifikationsbegriff" ersetzt?
Man wollte Bildung empirisch messbar machen und Curricula erstellen, die auf die tatsächlichen Anforderungen der Arbeitswelt und Gesellschaft zugeschnitten sind.
Welche Rolle spielte Saul Robinsohn bei dieser Reform?
Robinsohn plädierte für ein sozialwissenschaftlich begründetes Curriculum und definierte Qualifikationen als Lernbausteine zur Situationsbewältigung.
Was war die zentrale Erkenntnis der "Göttinger Studie"?
Die Studie zeigte, dass der klassische Bildungsbegriff in den 60er Jahren an Bedeutung verloren hatte und oft nur noch als Mittel zur sozialen Ausgrenzung diente.
Welche methodischen Schwächen hat die Qualifikationsforschung?
Kritisiert werden die mangelnde Klarheit des Begriffs, die schwierige Operationalisierung von Bildung und die Gefahr der Manipulation durch Interessengruppen.
Wie wirkt sich die realistische Wende auf die heutige Erwachsenenbildung aus?
Sie führte zur Ökonomisierung der Bildung und zur Entstehung privater Bildungsträger, die sich an Marktbedarfen orientieren.
- Arbeit zitieren
- Lennart Sieg (Autor:in), 2013, Realistische Wende in der Erwachsenenbildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272100