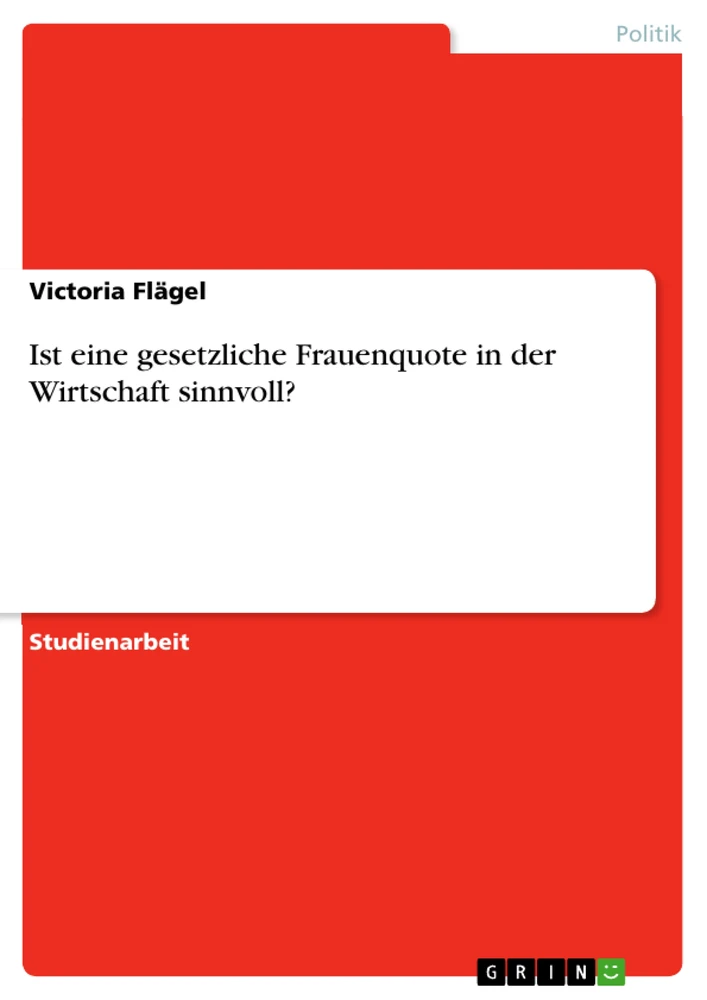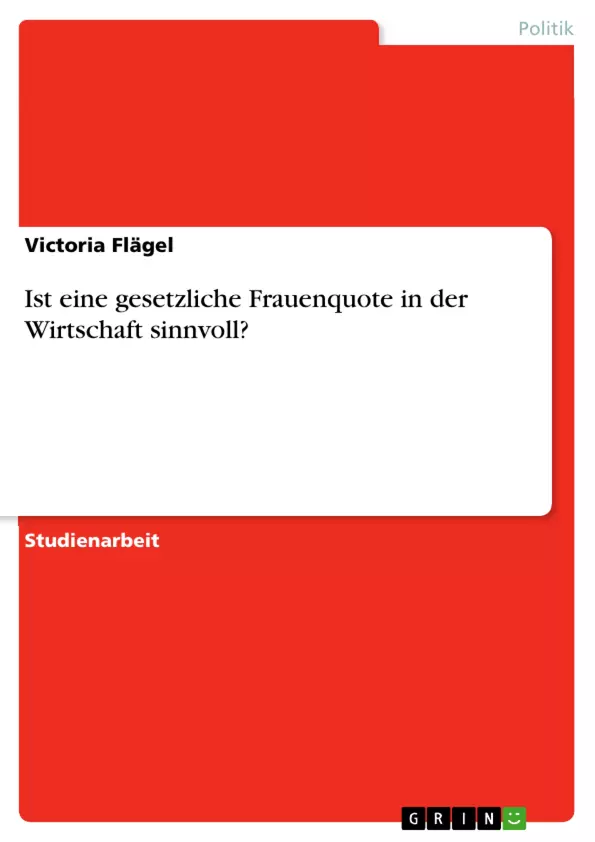Mädchen sind in der Schule besser als Jungen, auch in der akademischen Laufbahn stehen Studentinnen und Absolventinnen ihren männlichen Kommilitonen in nichts nach: 55,7 % der Abiturienten sind weiblich, 51 % der Hochschulabsolventen mit abgeschlossenem Studium sind Frauen. Aber wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kürzlich mitteilte, sind nur 3,2 % der Vorstandsposten in den 200 größten deutschen Konzernen von Frauen besetzt (in den Aufsichtsräten sind 10 % weiblich). Dieser Prozentsatz schrumpft, umso kleiner der Kreis der größten Unternehmen gezogen wird: Bei den 100 größten Unternehmen und den 30 DAX-Unternehmen waren es nur 2,2 %. 27 der 30 DAX-Unternehmen haben keine einzige Managerin in ihrem Vorstand. Und wenn Frauen Top-Positionen besetzen, sind sie schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Frauen verdienen durchschnittlich 1/5 weniger, wobei die Differenz in Führungspositionen sogar noch weiter anwächst. Diese kleinen Prozentsätze und der höchstens marginale Zuwachs an Frauen in Führungspositionen zeigt, dass die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nichts verändert hat.
Bei der öffentlichen Diskussion wird klar, dass verschiedene Möglichkeiten debattiert werden, Frauen in Führungspositionen zu etablieren, dass sich aber etwas ändern muss und dieser skandalöse Zustand nicht beibehalten werden darf und kann, steht hingegen nicht zur Debatte.
In dieser Arbeit geht es um eine flexible Quote, bei welcher Unterrepräsentanz von Frauen vorliegen muss, um bei gleicher Qualifikation mit einem anderen, männlichen Bewerber bevorzugt eingestellt zu werden, wobei überwiegende Kriterien des männlichen Bewerbers berücksichtigt bleiben, solange sie selbst nicht diskriminierend sind (d.h. Definition der Frauenquote nach dem Urteil des EuGH zu Kalanke).
Im Laufe der Arbeit werden die Vor- und Nachteile einer gesetzlichen Frauenquote untersucht und gegeneinander abgewägt. Begonnen wird mit den besonders in der öffentlichen Diskussion beleuchteten Fragen: Was würde sich ändern, wenn Frauen wirtschaftliche Führungsposten übernehmen? Folgend werden definitorische Schwierigkeiten des Begriffs der Chancengleichheit erläutert. Abschließend werden die beiden Hauptargumente, die in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Frauenquote vorwiegend Anwendung finden, erläutert und deren Tragbarkeit untersucht. Um am Ende die Fragen zu klären: Ist eine Quote sinnvoll, ist sie gerecht und durchsetzbar: Frauenquote – ja oder nein?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – der Stand der Dinge
- 2. Frauen in Führungspositionen
- 2.1 Brauchen Unternehmen Frauen in Führungspositionen?
- 2.2 Wandel der Unternehmenskultur: Vorteil für Frauen und Männer
- 3. Die Chancengleichheit – ein zweischneidiges Schwert
- 3.1 Der formale Begriff der Chancengleichheit
- 3.2 Der substantielle Begriff der Chancengleichheit
- 4. Ist die Quote moralisch vertretbar?
- 4.1 ,,Kompensation für erlittenes Unrecht“
- 4.2 ,,Verwirklichung von Verteilungsgerechtigkeit“
- 5. Die Quote als „Katalysator“ - Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Debatte um die gesetzliche Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorständen führender Wirtschaftsunternehmen in der BRD. Sie untersucht die Argumente für und gegen die Quote und beleuchtet dabei insbesondere die Frage, ob eine Quote sinnvoll, gerecht und durchsetzbar ist.
- Der aktuelle Stand der weiblichen Repräsentation in Führungspositionen in Deutschland
- Die Auswirkungen einer Frauenquote auf Unternehmenskultur und -erfolg
- Die moralischen und rechtlichen Aspekte der Frauenquote
- Die Frage der Chancengleichheit und die verschiedenen Definitionen des Begriffs
- Die Debatte um die Sinnhaftigkeit und Durchsetzbarkeit der Frauenquote
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation dar und beleuchtet die Diskrepanz zwischen dem hohen Anteil von Frauen im Bildungsbereich und ihrer geringen Repräsentation in Führungspositionen. Das zweite Kapitel widmet sich der Frage, ob Unternehmen Frauen in Führungspositionen brauchen und analysiert Studien, die einen Zusammenhang zwischen dem Frauenanteil in Führungspositionen und Unternehmenserfolg belegen. Das dritte Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Definitionen des Begriffs der Chancengleichheit. Im vierten Kapitel werden die beiden Hauptargumente für die Frauenquote, Kompensation für erlittenes Unrecht und die Verwirklichung von Verteilungsgerechtigkeit, diskutiert.
Schlüsselwörter
Frauenquote, Chancengleichheit, Führungspositionen, Unternehmenskultur, Verteilungsgerechtigkeit, Moral, Recht, Wirtschaft, Unternehmenserfolg, Fachkräftemangel.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird über eine gesetzliche Frauenquote diskutiert?
Trotz hoher Bildungsabschlüsse sind Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten massiv unterrepräsentiert. Da freiwillige Selbstverpflichtungen der Wirtschaft kaum Wirkung zeigten, wird die Quote als Instrument zur Durchsetzung von Chancengerechtigkeit debattiert.
Was ist der Unterschied zwischen formaler und substantieller Chancengleichheit?
Formale Chancengleichheit bedeutet, dass die Regeln für alle gleich sind. Substantielle Chancengleichheit berücksichtigt bestehende strukturelle Nachteile und versucht, diese durch gezielte Förderung (wie die Quote) auszugleichen.
Gibt es wirtschaftliche Vorteile durch mehr Frauen in Führungspositionen?
Studien deuten darauf hin, dass gemischte Teams zu einem Wandel der Unternehmenskultur führen, innovativer sind und oft bessere wirtschaftliche Ergebnisse erzielen.
Was besagt das EuGH-Urteil zu "Kalanke" im Kontext der Frauenquote?
Das Urteil besagt, dass eine starre Quote unzulässig ist. Eine Bevorzugung von Frauen bei gleicher Qualifikation ist jedoch rechtens, sofern keine diskriminierenden Kriterien gegen den männlichen Bewerber sprechen (flexible Quote).
Ist die Frauenquote moralisch als "Kompensation" zu rechtfertigen?
Ein Argument lautet, dass die Quote als Ausgleich für jahrzehntelanges strukturelles Unrecht und Diskriminierung dient, um eine faire Verteilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft herzustellen.
Wie hoch ist der Anteil von Frauen in DAX-Vorständen aktuell?
Zum Zeitpunkt der Untersuchung lag der Anteil bei nur ca. 2,2 % bis 3,2 %, wobei ein Großteil der DAX-Unternehmen keine einzige Frau im Vorstand hatte.
- Quote paper
- Victoria Flägel (Author), 2011, Ist eine gesetzliche Frauenquote in der Wirtschaft sinnvoll?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272109