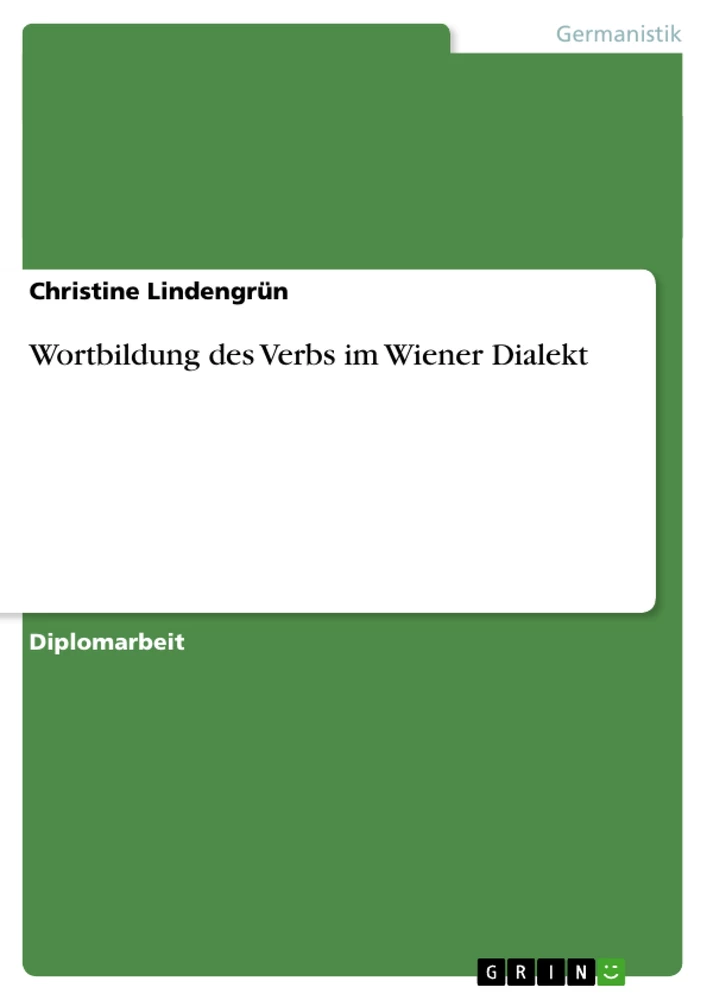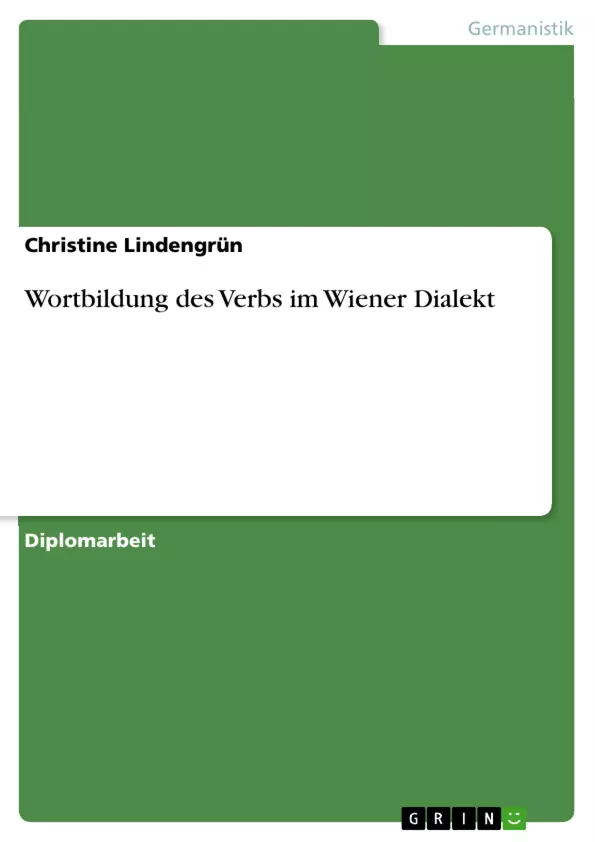Unter Wortbildung verstehen wir die regelhafte Synthese neuer Wörter. Die Wortbildungslehre ist daher ein Bereich, der sowohl der Lexik als auch der Morphologie angehört.
Wortbildung stellt das wichtigste Mittel zur Wortschatzerweiterung einer Sprache dar: Die Wortfamilie um ein Simplizium kann über 500 Wörter fassen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der okkasionellen Wortbildung: Etwa ein Drittel aller Wortbildungskonstruktionen eines Zeitungstextes sind nicht im Wörterbuch verzeichnet.
In der Dialektologie wird der Bereich der Wortbildung selten berücksichtigt, da Dialekt gegenüber Standardsprache als defizitäres Sprachsystem betrachtet wird. Dialekt weist eine geringere Ausstattung auf grammatischer Ebene auf: Der Wortschatz ist kleiner, die syntaktischen und morphologischen Möglichkeiten sind herabgesetzt, das Inventar an grammatischen Kategorien ist geringer. Trotzdem erfüllt jeder Dialekt alle Anforderungen, die an ein funktionierendes Sprachsystem gestellt werden. Alles, was in Standardsprache ausgedrückt werden kann, kann auch in einem Dialekt ausgedrückt werden.
Unter Berücksichtigung semantischer und funktionalpragmatischer Aspekte erweist sich der Dialekt sogar als leistungsfähiger. Dialekt bietet mehr Möglichkeiten der semantischen Differenzierung als die Standardsprache.
"In der sprachlichen Beschreibung feinster Differenzierung des konkreten täglichen Lebens. z.B. den Sinnbezirken der Bewegung, der Emotionalität, der konkreten Sinneseindrücke, ist der noch voll ausgestattete Dialekt, wenn er darüberhinaus noch expansiv ist, der Hochsprache an Zahl und Nuancierung der Wörter überlegen."
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- 1 Zielsetzung
- 2 Theoretische Voraussetzungen
- 2.1 Dialekt
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Wiener Dialekt
- 2.2 Wortbildung
- 2.2.1 Definition
- 2.2.2 Wortbildungsmorpheme
- 2.2.3 Wortbildungsarten
- 2.2.4 Verbale Wortbildungsmuster des Deutschen in historischer Entwicklung
- 2.1 Dialekt
- 3 Methodische Voraussetzungen
- 3.1 Korpus
- 3.2 Abgrenzung
- 3.2.1 Wortbildungskonstruktion vs. syntaktisches Gefüge
- 3.2.2 Sind Partikelverben Komposita oder Derivate?
- 3.3 Funktionen der verbalen Wortbildung
- 3.3.1 Syntaktische/grammatische Funktionen
- 3.3.2 Semantische Funktionen
- 3.3.3 Pragmatische Funktionen
- II Korpusanalyse
- 1 Komposition mit Substantiven
- 2 Komposition mit Adjektiven
- 3 Komposition mit Verben
- 4 Komposition mit Partikeln
- 4.1 Trennbare Partikeln
- 4.2 Doppelförmige Partikeln
- 5 Präfigierung
- 6 Suffigierung
- III Möglichkeiten und Funktionen der verbalen Wortbildung im Wiener Dialekt
- 1 Allgemeine Ergebnisse
- 2 Partikelkomposition
- 2.1 Einfache trennbare Partikeln
- 2.2 Doppelförmige Partikeln
- 2.3 Orts- und Richtungsadverbien
- 2.3.1 Formale Besonderheiten zusammengesetzter Richtungsadverbien
- 2.3.2 Zusammengesetzte Richtungsadverbien als Verbpartikeln
- 3 Präfigierung
- 4 Suffigierung
- 5 Komposition mit Substantiven, Adjektiven, Verben
- 6 Präferierte Basisverben
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten der verbalen Wortbildung im Wiener Dialekt. Ziel ist die formale Erfassung und funktionale Interpretation der Wortbildung von Verben. Die Analyse basiert auf älteren und neueren Wörterbüchern sowie einem Korpus aus einem Wiener Dialekttext.
- Formale und funktionale Analyse der verbalen Wortbildung im Wiener Dialekt
- Häufigkeit und Produktivität verschiedener Wortbildungsmuster
- Syntaktische, semantische und pragmatische Funktionen der verbalen Wortbildung
- Bevorzugte semantische Klassen von Basisverben
- Etymologische Aspekte einzelner Wortbildungsmuster
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Diese Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, welche die Erforschung der verbalen Wortbildung im Wiener Dialekt umfasst. Sie erläutert die theoretischen Grundlagen der Dialektologie und Wortbildung, wobei der Wiener Dialekt als eigenständiges, funktionsfähiges Sprachsystem dargestellt wird, das trotz vermeintlicher Defizite gegenüber der Standardsprache eine hohe semantische Differenzierungsfähigkeit aufweist. Die methodischen Vorgehensweisen, einschließlich der Korpusbildung aus Wörterbüchern und einem Wiener Dialekttext, werden detailliert beschrieben. Die zentralen Forschungsfragen betreffen die realisierten, bevorzugten und produktiven Wortbildungsmuster, deren Funktionen und die Bedeutung von Effektivität und Effizienz im Wiener Dialekt. Die Einbeziehung etymologischer Aspekte unterstreicht die Notwendigkeit einer Kombination aus synchroner und diachroner Betrachtungsweise.
II Korpusanalyse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Korpusanalyse, die sich auf verschiedene Arten der verbalen Wortbildung im Wiener Dialekt konzentriert. Es werden systematisch die Kompositionen mit Substantiven, Adjektiven und Verben sowie die Kompositionen mit Partikeln (trennbare und doppelförmige) analysiert. Die Kapitel behandeln Präfigierung und Suffigierung als weitere bedeutende Wortbildungsverfahren. Die detaillierte Untersuchung jedes dieser Bereiche liefert eine umfassende Übersicht über die morphologischen Strukturen der verbalen Wortbildung im untersuchten Korpus.
III Möglichkeiten und Funktionen der verbalen Wortbildung im Wiener Dialekt: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Korpusanalyse zusammen und interpretiert die gefundenen Wortbildungsmuster in Bezug auf ihre Funktionen und Möglichkeiten im Wiener Dialekt. Es analysiert Partikelkompositionen (einschließlich einfacher trennbarer Partikeln, doppelförmiger Partikel und Orts-/Richtungsadverbien), Präfigierung, Suffigierung und Kompositionen mit Substantiven, Adjektiven und Verben. Die Untersuchung der bevorzugten Basisverben und der Zusammenfassung bietet eine umfassende Synthese der gewonnenen Erkenntnisse und legt Schlussfolgerungen über die Eigenschaften der verbalen Wortbildung im Wiener Dialekt dar.
Schlüsselwörter
Wiener Dialekt, Verb, Wortbildung, Komposition, Präfigierung, Suffigierung, Partikelverb, Semantik, Pragmatik, Syntax, Korpusanalyse, Wortbildungsmuster, Produktivität, Effektivität, Effizienz, Etymologie.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Verbale Wortbildung im Wiener Dialekt
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die verbale Wortbildung im Wiener Dialekt. Sie analysiert die formalen Möglichkeiten und funktionalen Aspekte der Wortbildung von Verben in diesem Dialekt.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Analyse basiert auf älteren und neueren Wörterbüchern des Wiener Dialekts sowie einem Korpus aus einem Wiener Dialekttext. Die Arbeit kombiniert eine formale Erfassung der Wortbildungsmuster mit einer funktionalen Interpretation unter Berücksichtigung syntaktischer, semantischer und pragmatischer Aspekte.
Welche Arten der verbalen Wortbildung werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Arten der verbalen Wortbildung, darunter Komposition mit Substantiven, Adjektiven und Verben, Komposition mit Partikeln (trennbare und doppelförmige Partikel, Orts- und Richtungsadverbien), Präfigierung und Suffigierung.
Welche Aspekte der Wortbildung werden betrachtet?
Die Analyse betrachtet sowohl die formalen Eigenschaften der Wortbildungsmuster (z.B. Häufigkeit, Produktivität) als auch deren funktionale Aspekte (syntaktische, semantische und pragmatische Funktionen). Es werden auch etymologische Aspekte einzelner Wortbildungsmuster berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Eine Einleitung mit Zielsetzung, theoretischen und methodischen Voraussetzungen; eine Korpusanalyse, die die verschiedenen Arten der verbalen Wortbildung systematisch untersucht; und einen Schlussteil, der die Ergebnisse zusammenfasst und interpretiert, wobei die Funktionen und Möglichkeiten der verbalen Wortbildung im Wiener Dialekt im Fokus stehen. Die Einleitung beschreibt außerdem den Wiener Dialekt als eigenständiges Sprachsystem.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert detaillierte Ergebnisse der Korpusanalyse, die die Häufigkeit und Produktivität verschiedener Wortbildungsmuster aufzeigen. Sie beleuchtet die syntaktischen, semantischen und pragmatischen Funktionen der analysierten Wortbildungen und identifiziert bevorzugte semantische Klassen von Basisverben. Die Schlussfolgerungen geben Aufschluss über die Eigenschaften der verbalen Wortbildung im Wiener Dialekt und die Bedeutung von Effektivität und Effizienz in diesem Kontext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wiener Dialekt, Verb, Wortbildung, Komposition, Präfigierung, Suffigierung, Partikelverb, Semantik, Pragmatik, Syntax, Korpusanalyse, Wortbildungsmuster, Produktivität, Effektivität, Effizienz, Etymologie.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, Dialektologen, und alle, die sich für die sprachliche Struktur und Funktionalität des Wiener Dialekts interessieren. Sie bietet wertvolle Einblicke in die morphologischen und semantischen Besonderheiten der verbalen Wortbildung in diesem Dialekt.
- Quote paper
- Christine Lindengrün (Author), 2004, Wortbildung des Verbs im Wiener Dialekt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27212