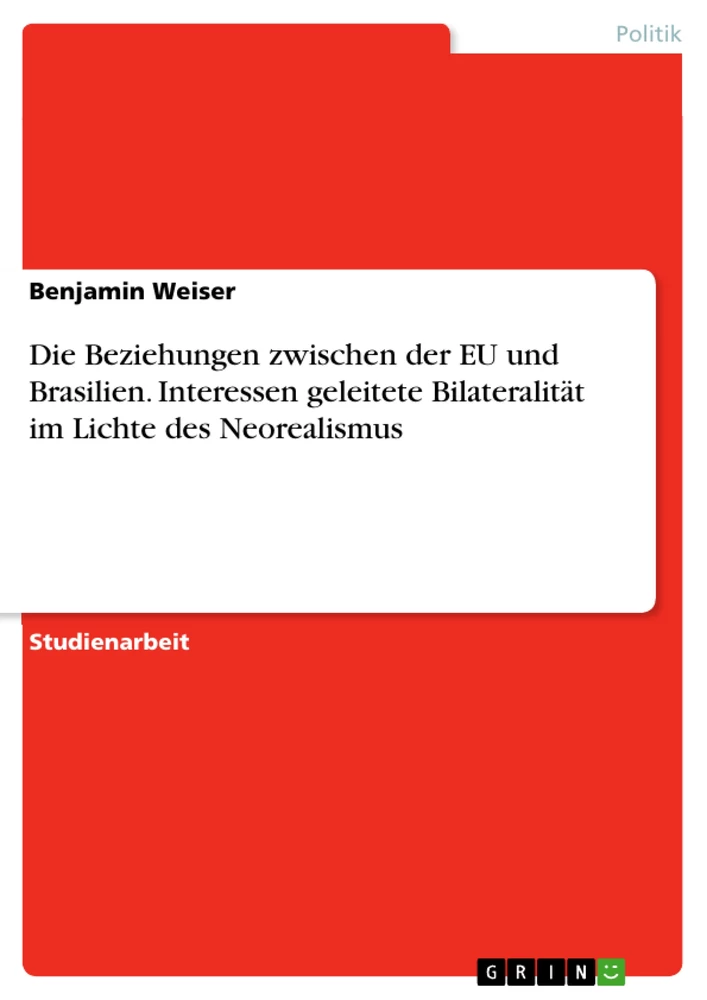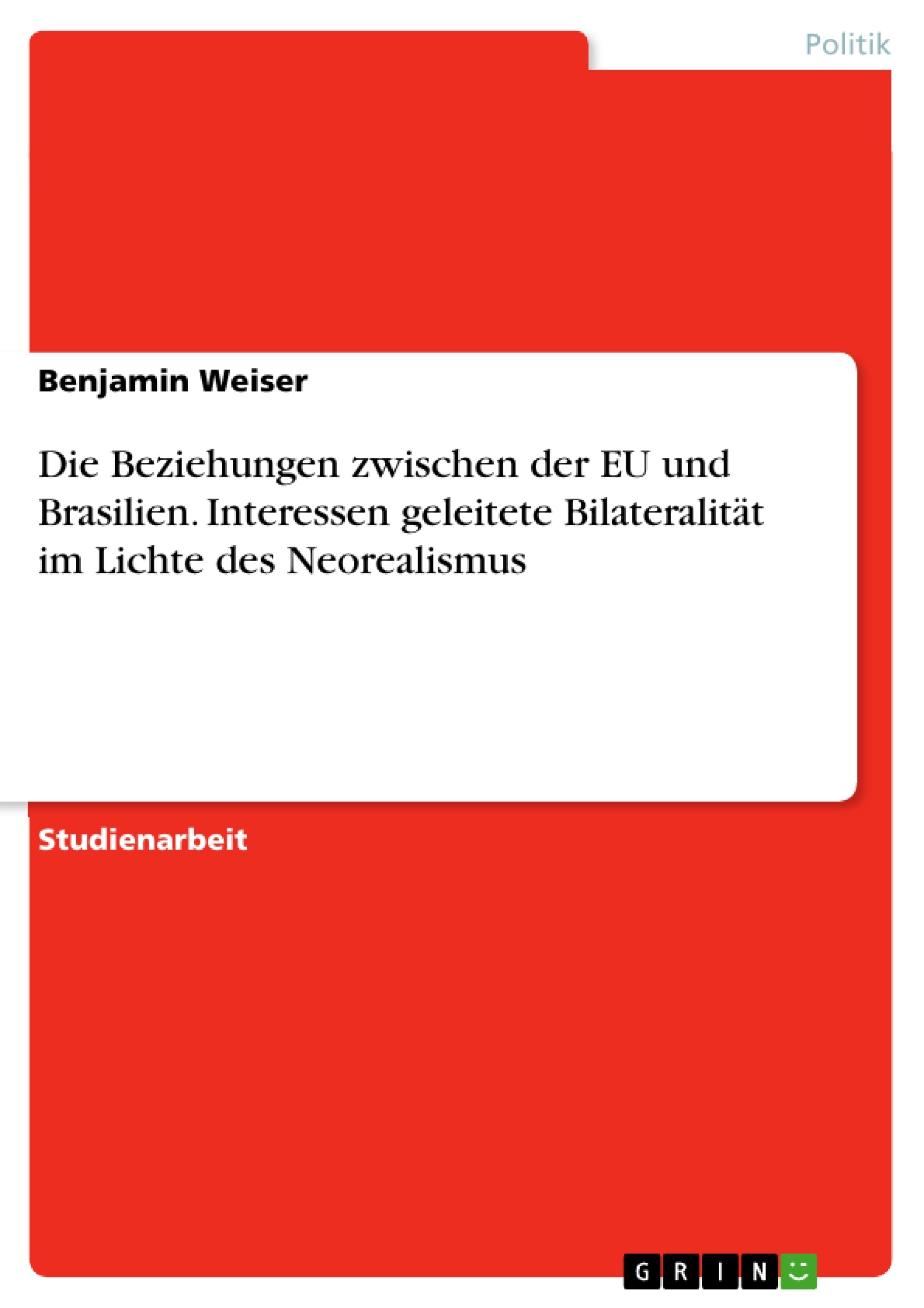Mit der Auflösung der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre ist nicht nur der Ost-West-Konflikt (OWK) Geschichte, sondern damit einhergehend auch eine wichtige Konstante im internationalen System: die Bipolarität zwischen den USA und der Sowjetunion als den zwei Hegemonialmächten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aus der darauffolgenden unipolaren Stellung des einzig verbliebenen Hegemons – der USA – ist jedoch spätestens mit dem durch die Globalisierung provozierten Aufkommen neuer (Wirtschafts-)Mächte Anfang des 21. Jahrhunderts eine neue Unübersichtlichkeit bzw. Unsicherheit entstanden, welche Wissenschaft, Politik und Gesellschaft gleichermaßen vor große Herausforderungen stellt.
Insbesondere die neorealistische Denkschule der internationalen Beziehungen ist durch die mangelnde Prognosekraft in Bezug auf das Ende des „Kalten „Krieges“, v.a. durch idealistisch-liberale Gegenpositionen, in Kritik geraten.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die spannende Frage, ob der Neorealismus noch (oder wieder) geeignet ist, aktuelle Funktionslogiken in der internationalen Politik adäquat zu erklären. Basierend auf der Annahme sich verschiebender Machtverhältnisse in der Welt wird in der vorliegenden Arbeit folgender Fragestellung nachgegangen: wie lassen sich die bilateralen Beziehungen zwischen der EU und Brasilien anhand der neorealistischen Denkschule interpretieren?
Inhaltsverzeichnis
- Einführungsteil
- Einleitung
- Hauptteil
- Konzeptualisierung
- Definition relevanter Begriffe
- Theoretisches Gerüst der Analyse
- Operationalisierung (OP)
- Unabhängige/erklärende Variablen
- Abhängige Variablen
- Empirische Analyse
- Schluss
- Konklusion
- Konzeptualisierung
- Zusätzliches
- Abkürzungsverzeichnis
- Vermerke
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den bilateralen Beziehungen zwischen der EU und Brasilien, wobei der Fokus auf der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Akteuren liegt. Ziel der Analyse ist es, die Funktionsbedingungen von Politik zwischen den beiden Staaten im Lichte des Neorealismus zu untersuchen und herauszufinden, inwiefern die Beziehungen von den jeweiligen staatlichen Interessen geleitet werden.
- Die Bedeutung des Machtbegriffs im Neorealismus und die Rolle von nationalem Interesse.
- Die Analyse der Machtressourcen der EU und Brasiliens im internationalen System.
- Die Überprüfung der verschiedenen neorealistischen Ansätze von Kenneth Waltz, Stephen Walt, Randall Schweller und Robert Gilpin im Kontext der EU-Brasilien Beziehungen.
- Die Rolle von internationalen Organisationen und Institutionen in der strategischen Partnerschaft.
- Die Bedeutung von ökonomischen und handelspolitischen Synergien im Verhältnis zwischen der EU und Brasilien.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Interpretierbarkeit der bilateralen Beziehungen zwischen der EU und Brasilien anhand der neorealistischen Denkschule. Es wird die systemische Theorie-Fundierung der Arbeit erläutert und die Zielsetzung der Analyse definiert.
Das Kapitel „Konzeptualisierung" beschäftigt sich mit der Definition wichtiger Begriffe wie Macht, nationales Interesse, Anarchie und Bilateralismus. Es wird auch auf den „klassischen" Realismus und seine Kritikpunkte eingegangen und die theoretische Basis der Arbeit anhand der neorealistischen Ansätze von Kenneth Waltz, Stephen Walt, Randall Schweller und Robert Gilpin erläutert.
Im Kapitel „Operationalisierung" werden die Variablenkonstmkte vorgestellt, die der Überprüfung der aufgestellten Hypothesen dienen. Es werden die unabhängigen/erklärenden und abhängigen Variablen nach den verschiedenen neorealistischen Ansätzen definiert.
Das Kapitel „Empirische Analyse" beleuchtet die Machtressourcen der EU, Brasiliens und weiterer wichtiger Akteure im internationalen System anhand einer Tabelle, die verschiedene Machtressourcen wie BIP, Exporte, Importe, Fläche und Bevölkerung vergleicht. Es wird die Frage nach der Dominanz der USA als Hegemon und der Entwicklung hin zu einer Multipolarität im internationalen System diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Neorealismus, die Beziehungen zwischen der EU und Brasilien, die strategische Partnerschaft, Machtpolitik, nationales Interesse, Sicherheitsdilemma, Multipolarität, ökonomische Ressourcen, Handelspolitik, internationale Organisationen und Institutionen, sowie die Entwicklungszusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern des Neorealismus in der internationalen Politik?
Der Neorealismus geht davon aus, dass das internationale System anarchisch ist und Staaten primär nach Macht und Sicherheit streben, um ihre nationalen Interessen zu wahren.
Wie lässt sich die Partnerschaft zwischen der EU und Brasilien neorealistisch deuten?
Die Beziehung wird als interessengeleitete Bilateralität gesehen, bei der beide Akteure versuchen, ihre Position in einer sich wandelnden, multipolaren Weltordnung zu stärken.
Welche Machtressourcen bringt Brasilien in die Beziehung ein?
Brasilien punktet durch seine wachsende Wirtschaftskraft (BIP), seine große Bevölkerung, enorme Rohstoffvorkommen und seine regionale Vormachtstellung in Südamerika.
Spielen internationale Organisationen im Neorealismus eine Rolle?
Im Neorealismus werden Organisationen oft als Instrumente mächtiger Staaten gesehen, um deren eigene Interessen zu verfolgen oder Machtverhältnisse zu stabilisieren.
Befindet sich die Welt auf dem Weg zur Multipolarität?
Ja, das Aufkommen neuer Mächte wie Brasilien deutet darauf hin, dass die unipolare Stellung der USA schwindet und sich ein System mit mehreren Machtzentren entwickelt.
- Quote paper
- Benjamin Weiser (Author), 2014, Die Beziehungen zwischen der EU und Brasilien. Interessen geleitete Bilateralität im Lichte des Neorealismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272124