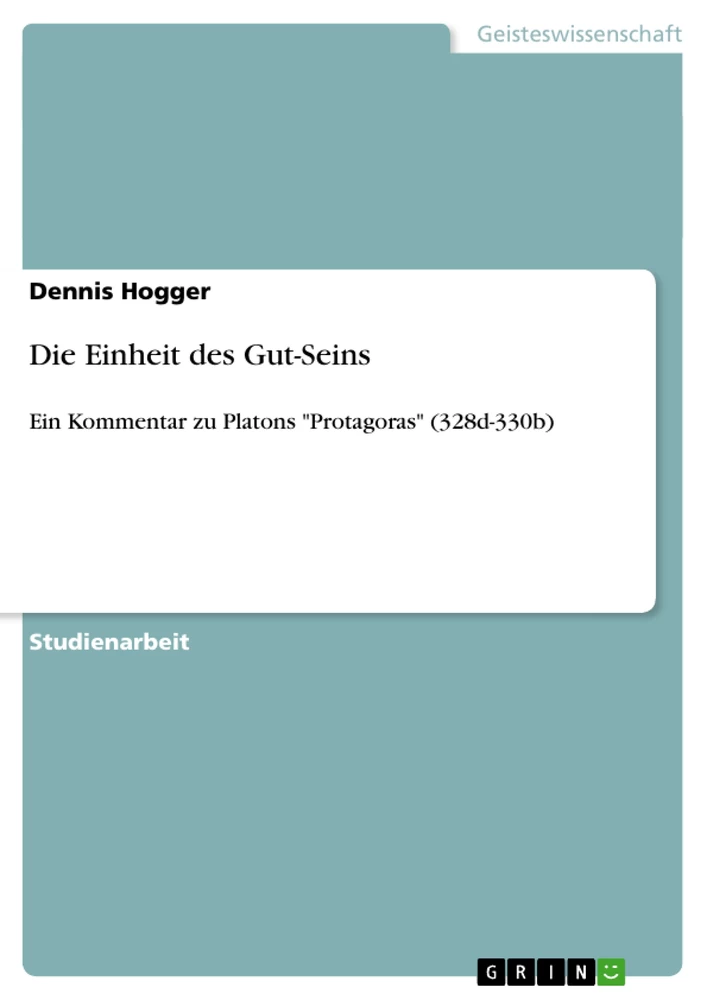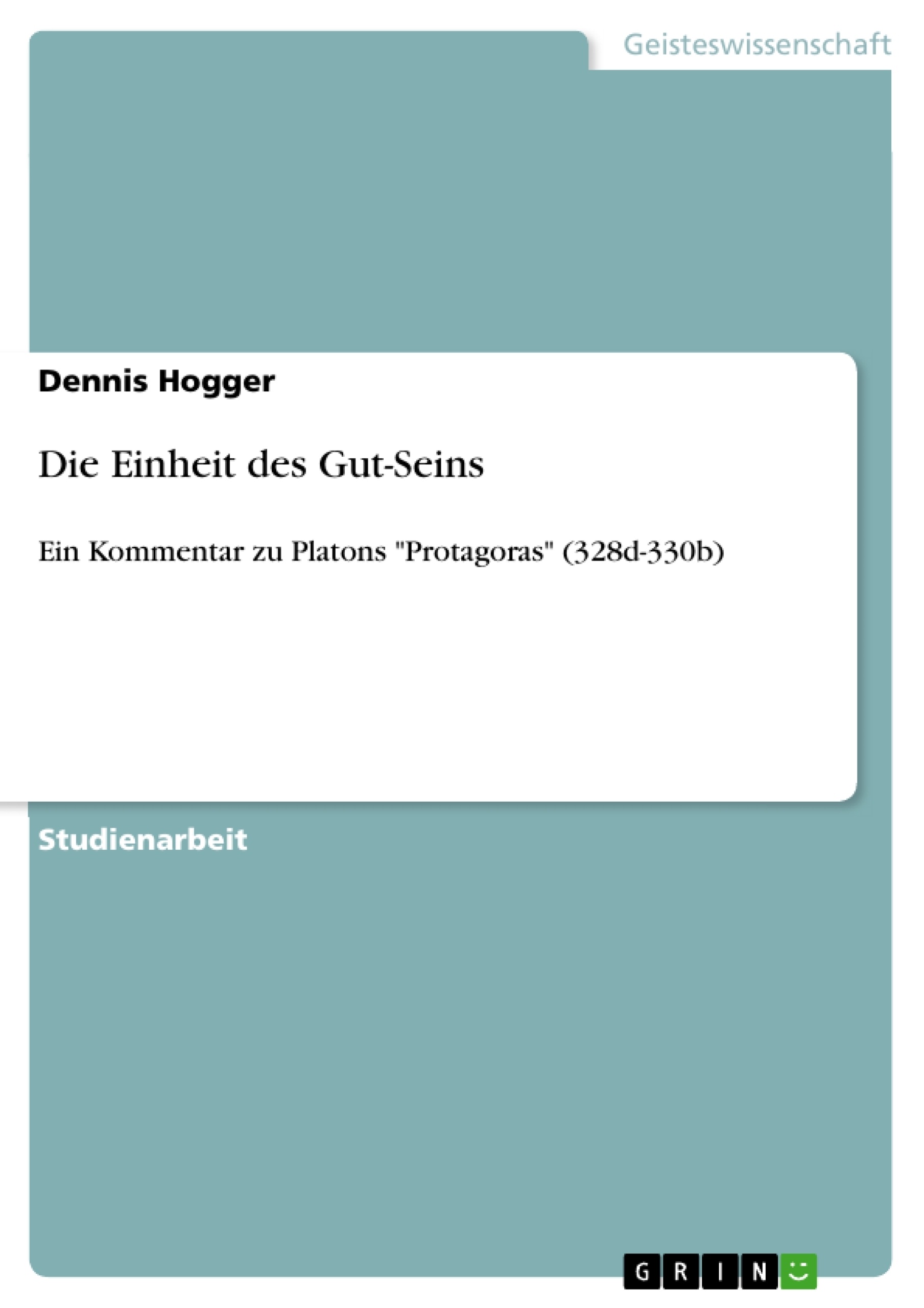Platons Dialog Protagoras in seiner Gesamtheit zu überblicken, ist selbst für erfahrene Platon-Interpreten eine mühevolle Angelegenheit. Einem solchen Vorhaben steht einerseits der stark fragmentierte Aufbau des Werkes entgegen, andererseits die schiere Menge an behandelten Themen – so besteht nicht einmal Konsens darüber, was man als Hauptthema des Dialogs ansehen kann. Dazu gesellt sich das für die Platon-Interpretation fundamentale Problem, ob die in den Dialogen von Sokrates vertretenen Positionen tatsächlich mit der Position von Sokrates und/oder Platon identisch sind.
In dieser Arbeit soll ein wichtiges (jedoch nicht das einzige) Thema, das im Protagoras behandelt wird, besprochen werden. Es ist die Frage nach der Einheit der Tugend bzw. (nach der hier verwendeten Übersetzung von Bernd Manuwald) des Gut-Seins (aretē). Konkret soll hier eine inhaltlich zentrale Stelle ausführlich kommentiert werden, nämlich Prot. 328d-330b. An dieser Stelle wird die Frage nach der Einheit des Gut-Seins erstmals explizit gestellt. Im Anschluss wird aufgezeigt, wie sich das Problem durch den ganzen restlichen Dialog zieht. Zuvor soll jedoch noch ein kurzer Abriss des Geschehens bis zu der kommentierten Stelle gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Platons Dialog Protagoras
- Zusammenfassung der Kapitel
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit einem zentralen Thema im Platonschen Dialog Protagoras: der Frage nach der Einheit der Tugend, genauer gesagt, des Gut-Seins (aretê).
- Die Einheit des Gut-Seins
- Die Beziehung zwischen einzelnen Tugenden und dem Gut-Sein
- Die Rolle der Weisheit und Tapferkeit
- Die Kritik an Protagoras' Argumentation
- Die Interpretation von Sokrates' Position
Zusammenfassung der Kapitel
- Platons Dialog Protagoras
- Sokrates und Hippokrates besuchen Protagoras
- Protagoras' Definition der Politikê Techne
- Sokrates' Zweifel an der Lehrbarkeit der Politikê Techne
- Protagoras' Mythus und Logos
- Die Einführung des Begriffs der Aretê
- Protagoras' Rede über verschiedene Tugenden
- Die implizite Prämisse des Gut-Seins in Protagoras' Rede
- Sokrates' "Bezauberung" durch Protagoras' Rede
- Sokrates' Frage nach der Einheit des Gut-Seins
- Sokrates' Exkurs über die Fähigkeit zum Dialog
- Sokrates' "Kleinigkeit" und die Frage nach dem Verhältnis zwischen den Tugenden und dem Gut-Sein
- Sokrates' sechs Fragen an Protagoras
- Frage A: Sind die einzelnen Tugenden Teile des Gut-Seins oder Synonyme für das Gut-Sein?
- Frage B: Ist das Gut-Sein wie ein Gesicht mit unterschiedlichen Teilen oder wie Gold mit quantitativen Unterschieden?
- Frage C: Kann man eine Tugend ohne die anderen besitzen?
- Frage D: Sind Weisheit und Tapferkeit Teile des Gut-Seins?
- Frage E: Ist jeder Teil des Gut-Seins anders als die anderen?
- Frage F: Hat jeder Teil des Gut-Seins eine andere Fähigkeit?
- Sokrates' Schlussfolgerung: Die absolute Trennung der Teile des Gut-Seins
- Sokrates' Einwände gegen die absolute Trennung der Teile des Gut-Seins
- Das Verhältnis von Gerechtigkeit und Frömmigkeit
- Die Identität von Weisheit und Vernünftigkeit
- Die Verbindung von Tapferkeit mit den anderen Teilen des Gut-Seins
- Zusammenfassung der Argumentation im Protagoras
- Kontroverse Interpretationen von Sokrates' Position
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Einheit der Tugend, das Gut-Sein (aretê), die einzelnen Tugenden (z.B. Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Weisheit, Tapferkeit), das Verhältnis zwischen den Tugenden und dem Gut-Sein, sowie die Interpretation von Sokrates' Position im Dialog Protagoras.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Platons Dialog "Protagoras"?
Der Dialog behandelt die Frage, ob Tugend (Gut-Sein) lehrbar ist und ob die verschiedenen Tugenden eine Einheit bilden.
Was ist das Problem der "Einheit der Tugend"?
Sokrates untersucht, ob Tugenden wie Weisheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit separate Teile oder lediglich verschiedene Namen für ein und dieselbe Sache sind.
Welche Position vertritt Protagoras?
Protagoras behauptet, dass Politikê Techne (bürgerliche Tugend) lehrbar ist, gerät aber bei der logischen Verknüpfung der einzelnen Tugenden in Erklärungsnot.
Wie argumentiert Sokrates gegen die Trennung der Tugenden?
Er versucht aufzuzeigen, dass z.B. Tapferkeit ohne Weisheit lediglich Tollkühnheit wäre, wodurch die Untrennbarkeit der Tugenden untermauert wird.
Was bedeutet "Aretē" in diesem Kontext?
Aretē wird hier als "Gut-Sein" oder Tugend übersetzt und bezeichnet die hervorragende Qualität oder Tüchtigkeit eines Menschen.
- Arbeit zitieren
- Dennis Hogger (Autor:in), 2014, Die Einheit des Gut-Seins, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272143