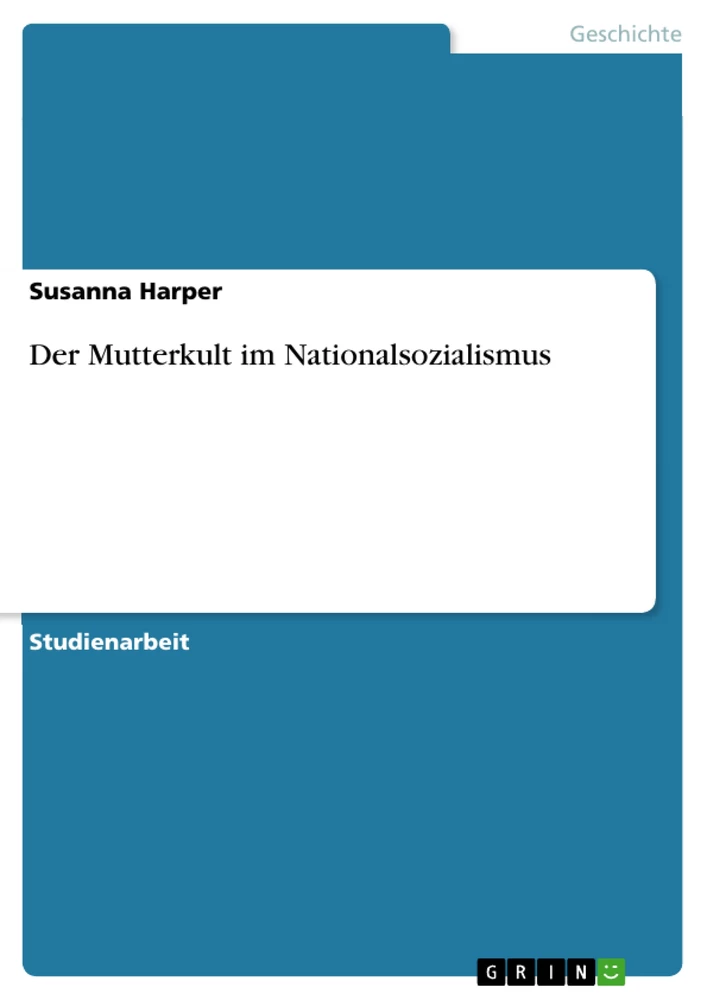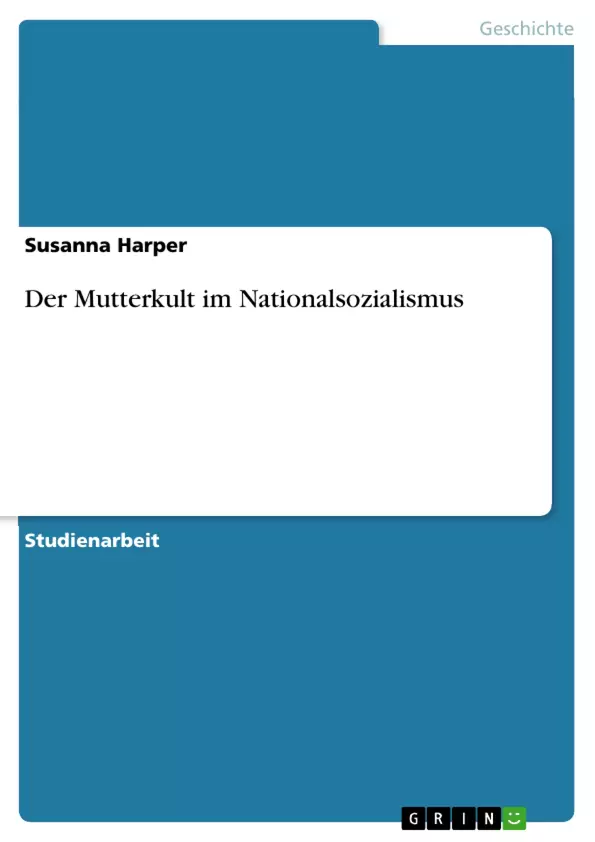„´Hm . . . also, man sieht Ihnen ja mit einem Blick an, dass Sie nichts anderes sein können als eine reinblütige Arierin´, sagte er.
Unvermittelt knallte er mit lautem Ächzen seinen Stempel auf das Formular. >Deutschblütig< stand endlich in meinen Papieren." (Beer 2009, S.203-204)
Mit diesen Worten beschreibt Edith Hahn Beer ihren Auftritt beim Standesamt in Brandenburg, wo sie als untergetauchte Jüdin um die Heiratserlaubnis mit einem NS-Offizier bangte. Wie viel Angst und Leid diesem Ereignis vorausgegangen war, ist kaum fassbar; wie viel dieser Stempel zu jener Zeit in Deutschland verhindern oder dessen Abwesenheit an Schrecken herbei führen konnte, jenseits aller Vorstellungskraft. Edith Hahn Beer hatte Glück.
In kaum mehr als einem Jahr war [sie] von der niedrigsten Kreatur im Dritten Reich – einer gesuchten jüdischen Sklavin, die sich vor dem Transport nach Polen gedrückt hatte – zu einer der angesehensten Volksgenossinnen geworden, einer gebärenden arischen Hausfrau.
Dieser kurze Auszug aus Beers Autobiographie bringt die wichtigsten Elemente des NS-Mutterkults auf den Punkt: >Deutschblütigkeit< und >Mutterschaft< waren die entscheidenden Kriterien, die einer Frau im Dritten Reich Ansehen und Ehre verschaffen konnten. Sie brachten nicht nur soziale, sondern auch finanzielle Vorteile mit sich und wurden von der gesamten Bevölkerung anerkannt.
So wie der Antisemitismus, die Bevölkerungspolitik, die Eugenik und die Rassenhygiene bereits vor 1933 existierten, so auch der >Mutterkult<, der mit der Einführung des Muttertages 1923 an immer mehr überzeugter Anhängerschaft gewann. Während alle diese Richtungen vor der Nazi-Herrschaft mehr oder weniger eigenständig waren, so verschmolzen sie nun zu einer Gesamtideologie, die die bislang extremste Radikalisierung der einzelnen Teilaspekte in der deutschen Geschichte zur Folge hatte.
Die Vorstellung, Menschen könnten und müssten nach ihrem vermeintlichen >Erbwert< gegliedert werden, war weit verbreitet und führte letztlich zum Massenmord an den europäischen Juden sowie den Sinti und Roma. So nah bei einander lagen also Ehrung und Verachtung, Bevorzugung und Diskriminierung, Mutterkult und Massenmord.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Frau und Politik
- Der „ureigene Beruf der Mutterschaft"
- „Mädchen von heute — Mütter von morgen"
- Die >deutsche Frau< berichtet
- Das Mutterkreuz
- >Erbbiologische Maßnahmen<
- Mutterschutz vs. Mutterschändung
- Reflexion und Kritik
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Mutterkult im Nationalsozialismus. Ziel ist es, die Rolle der Frau in der NS-Ideologie zu beleuchten, insbesondere ihre Bedeutung als „Mutter der Nation" und ihre Einbindung in die rassenhygienischen Ziele des Regimes.
- Die Rolle der Frau in der NS-Politik und ihre Diskriminierung in Bezug auf Bildung und Karriere
- Der Mutterkult als Instrument der NS-Bevölkerungspolitik und seine Verbindung zur Rassenhygiene
- Die ideologischen Grundlagen und die konkrete Umsetzung des Mutterkults, z.B. durch den Muttertag, das Mutterkreuz und die Euthanasie
- Die Auswirkungen des Mutterkults auf das Familienleben und die Erziehung der Kinder
- Die kritische Reflexion des Mutterkults im Kontext der NS-Ideologie und der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt mit einem persönlichen Beispiel von Edith Hahn Beer in die Thematik des Mutterkults im Nationalsozialismus ein und verdeutlicht dessen Bedeutung für die NS-Ideologie.
Das Kapitel „Frau und Politik" beleuchtet die politische Situation der Frauen in der Weimarer Republik und die Veränderungen, die sich durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten ergaben. Der Muttertag wird als ein Instrument der NS-Propaganda vorgestellt, das die Frau in ihre traditionelle Rolle als Mutter und Hausfrau zurückführen sollte.
Das Kapitel „Der „ureigene Beruf der Mutterschaft"“ analysiert die NS-Bevölkerungspolitik und die Maßnahmen, die zur Steigerung der Geburtenrate ergriffen wurden. Darunter fallen z.B. zinslose Darlehen für Ehen, die Einschränkung von Verhütungsmitteln und die Wiedereinführung von Strafen für Abtreibungen.
Das Kapitel „„Mädchen von heute — Mütter von morgen"“ beschreibt die schulische und außerschulische Erziehung der Mädchen im Dritten Reich, die auf die Heranziehung „erbgesunder deutscher Mütter" ausgerichtet war. Der Bund Deutscher Mädel (BDM) und die NS-Frauenschaft spielten dabei eine zentrale Rolle.
Das Kapitel „Die >deutsche Frau< berichtet" beleuchtet die subjektiven Erfahrungen von Frauen im Nationalsozialismus, die oft von der NS-Propaganda geprägt waren und den Mutterkult als eine positive Aufgabe empfanden.
Das Kapitel „Das Mutterkreuz" analysiert die Auszeichnung mit dem „Ehrenkreuz der deutschen Mutter" und dessen Bedeutung für die Rassenhygiene. Die Kriterien für die Verleihung des Mutterkreuzes werden erläutert und die Auswirkungen einer Ablehnung auf die betroffenen Frauen dargestellt.
Das Kapitel „>Erbbiologische Maßnahmen<" beschreibt die eugenischen und rassenhygienischen Maßnahmen des NS-Regimes, die zur „Reinigung" und „Verbesserung" der deutschen Bevölkerung beitragen sollten. Die Sterilisation „erbkranker" Menschen und die Euthanasie werden als Beispiele für diese Politik genannt.
Das Kapitel „Mutterschutz vs. Mutterschändung" zeigt, dass der NS-Mutterschutz, der die „deutsche Mutter" vor Überlastung schützen sollte, gleichzeitig zu einer Ausbeutung von Frauen aus anderen Ländern führte. Die Zwangsarbeit von Frauen in der Rüstungsindustrie wird als Beispiel für die brutale Seite des NS-Regimes dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Mutterkult, die NS-Rassenpolitik, die Frau im Nationalsozialismus, die Bevölkerungspolitik, die Eugenik, die Rassenhygiene, der Muttertag, das Mutterkreuz, die Euthanasie, die Zwangsarbeit, die NS-Propaganda und die NS-Erziehung.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern des NS-Mutterkults?
Entscheidend waren „Deutschblütigkeit“ und Mutterschaft; Frauen wurden primär als Gebärerinnen für die „Volksgemeinschaft“ angesehen.
Welche Rolle spielte das Mutterkreuz?
Das „Ehrenkreuz der deutschen Mutter“ war eine staatliche Auszeichnung für kinderreiche Frauen, die als „erbgesund“ und politisch zuverlässig galten.
Wie wurden Mädchen auf ihre Rolle vorbereitet?
Durch Organisationen wie den Bund Deutscher Mädel (BDM) und eine spezifische Schulerziehung, die Mutterschaft als den „ureigenen Beruf“ der Frau darstellte.
Was versteht man unter „erbbiologischen Maßnahmen“?
Dies umfasst Eugenik und Rassenhygiene, einschließlich Zwangssterilisationen und Euthanasie zur „Reinigung“ des Volkskörpers.
Gab es Vorteile für kinderreiche Familien?
Ja, es gab finanzielle Anreize wie zinslose Ehestandsdarlehen, die pro geborenem Kind teilweise erlassen wurden.
- Arbeit zitieren
- Susanna Harper (Autor:in), 2011, Der Mutterkult im Nationalsozialismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272284