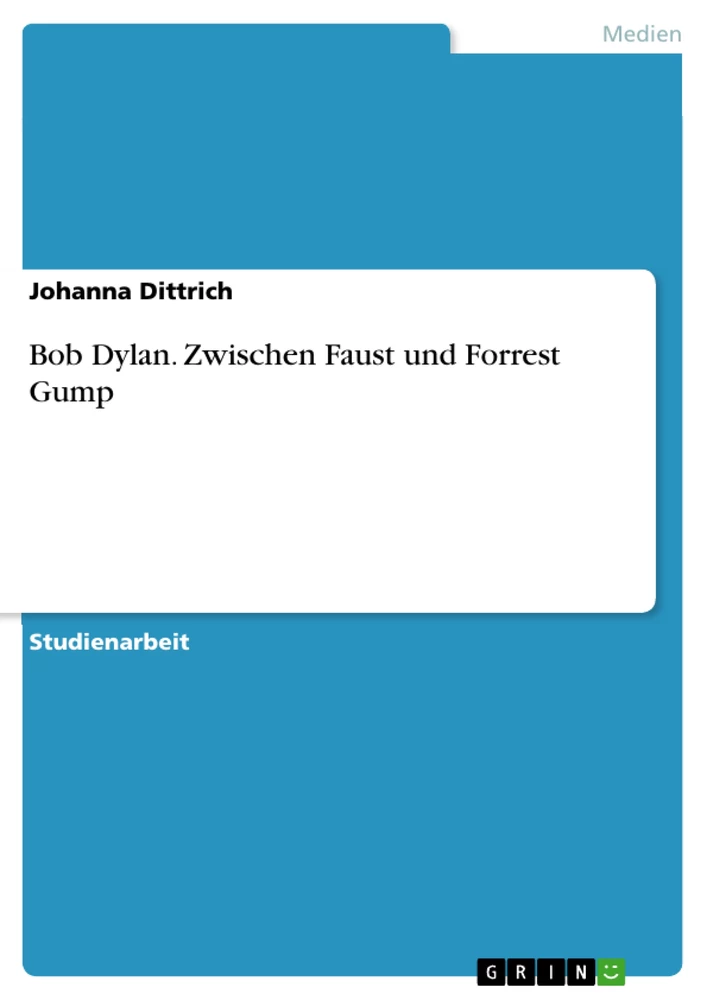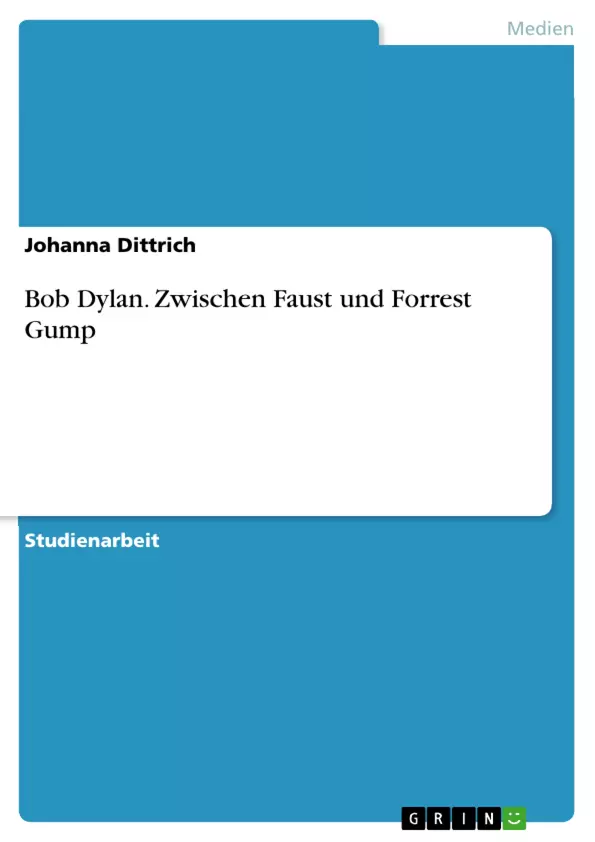Vielleicht ist es nicht klug so etwas einer solchen Arbeit voranzusetzen, aber die Autorin kannte Bob Dylan vor dem Seminar Hollywood Music Biopic in einem Sinne, der landläufig als „vom Hörensagen“ bezeichnet wird.
Die erste Begegnung mit Bob Dylan fand durch „I´m not there“ statt. Es entstand der Eindruck, dass es sich bei diesem Künstler um eine bewegende Persönlichkeit zu handeln scheint. Da „I`m not there“ jedoch ein Biopic ist, wundert es zunächst nicht, dass Bob Dylan dort als eine solche dargestellt wird.
Die weitere Suche und Recherche in Büchern, die sich dem Thema Folk gewidmet haben, zeigt, dass es sich bei Bob Dylan tatsächlich um eine Ausnahmeerscheinung handelt. Der Blick in das Personenregister des Buches Folk von C.-L. Reichert zeigt: 25 Einträge zu Bob Dylan, selbst Woody Guthrie schafft es hier nur auf 7. In Folksong von Denselow und anderen beträgt das Verhältnis immerhin 37 zu 16.
Diese Fakten und ersten Eindrücke lassen Feuer fangen und wecken den Wunsch, mehr zu erfahren über diesen Mann, der als die Personifizierung des Folkrevival2 bezeichnet wird und anscheinend in Newport die Gemeinde ebenjenes Genres gehörig vor den Kopf gestoßen hat. (...)
Diese Arbeit ist daher nicht als ein Versuch zu verstehen, möglichst viele Fäden des Mysteriums zu verstricken, sondern mehr als das Häkeln mit einer Nadel. Dies soll in dem Versuch geschehen, einige Muster in dem Kult um Bob Dylan zu erkennen. Ein besonderes Phänomen ist, dass er als Identifikationsfigur seiner Generation gebraucht wurde- er selbst dies jedoch als Missbrauch empfand. Diese „paranoische Flucht vor der Vereinnahmung durch andere“6 unterscheidet ihn von anderen Künstlern ähnlicher Ausdruckskraft. Es stellt sich die Frage, warum gerade er sein Publikum dazu brachte, als ihr Sprachrohr (miss-) verstanden zu werden. Dieser Frage soll im Sinne eines Einstiegs zu Beginn dieser Arbeit nachgegangen werden.
Der Song Rainy Day Women #12 & 35 ist ein ausgewähltes Beispiel anhand dessen gezeigt werden soll, wie Bob Dylan seine Songs einem Kaleidoskop gleich nutzt, um scheinbare Facetten seiner Person zu völlig neuen Mustern zusammenzusetzen.
Es wird sich der Frage zugewendet, was dafür spricht, diesen Song als der Drogenszene zu gehörig zu interpretieren und welche Indizien eine religiöse Motivation erkennen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- His Name lt ls Nothin' ? Eine Einleitung
- Blowln In The Wlnd: Versuche, einen Künstler zu fassen.
- Ralny Day Women & 35- Analyse
- Ralny Day Women #12 & 35- Interpretationen
- Go and lets get stoned!
- Der Messlas
- Don't Think TWIce, All Right! Ein Fant
- Anhang: Songtext Ralny Day Women & 35
- Literaturverzelchnls
- Abblldungsverzelchnls
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen Bob Dylan und versucht, die Vielschichtigkeit seiner Person und seines Werkes anhand des Songs „Rainy Day Women #12 & 35" zu beleuchten. Sie analysiert den Song und seine Interpretationen, wobei insbesondere die Rolle von Drogenkonsum und religiösen Einflüssen untersucht wird. Die Arbeit versucht, die komplexen Beziehungen zwischen Dylan, seinem Publikum und der politischen und kulturellen Landschaft der 1960er Jahre zu verstehen.
- Bob Dylans Rolle als Identifikationsfigur seiner Generation und seine Flucht vor der Vereinnahmung durch andere
- Dylans Umgang mit Drogen und die Interpretation des Songs „Rainy Day Women #12 & 35" als Drogensong
- Dylans Verhältnis zur Religion und die Rolle biblischer Inhalte in seiner Musik
- Die Bedeutung des Songs „Rainy Day Women #12 & 35" für die politische und kulturelle Landschaft der 1960er Jahre
- Dylans Verhältnis zu seinem Publikum und die Frage nach seiner „wahren" Botschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Bob Dylan als Ausnahmeerscheinung im Folkgenre und die Schwierigkeiten, ihn als Künstler und Person zu fassen. Es wird die Frage aufgeworfen, warum Dylan sein Publikum dazu brachte, ihn als Sprachrohr zu verstehen, und es wird der Song „Rainy Day Women #12 & 35" als Beispiel für Dylans Fähigkeit, seine Songs als Kaleidoskop zu nutzen, um Facetten seiner Person neu zu kombinieren, vorgestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Versuchen, Bob Dylan als Künstler zu fassen, und beleuchtet seine Abkehr vom „reinen" Folkgenre. Es werden die beiden entscheidenden Momente in Dylans Karriere beschrieben, die bis heute Auswirkungen haben: seine „Elektrifizierung" in Newport 1965 und seine Hinwendung zum Gospel 1979. Es wird gezeigt, wie Dylan sich jeder Art von Etikettierung entzog und die Erwartungen seines Publikums immer wieder hinterfragte.
Das dritte Kapitel analysiert den Song „Rainy Day Women #12 & 35" im Detail. Es werden die musikalische Gestaltung, die Harmonien und die Instrumente des Songs beschrieben. Es wird auch die besondere Rolle der Mundharmonika in Dylans Musik hervorgehoben. Die Bedeutung des Songs für die Zeit seines Entstehens, die 1960er Jahre, wird ebenfalls beleuchtet.
Das vierte Kapitel widmet sich den Interpretationen des Songs „Rainy Day Women #12 & 35". Es werden verschiedene Deutungen des Songs, insbesondere die Interpretation als Drogensong, diskutiert. Die Rolle des Drogenkonsums in Dylans Leben und Werk wird beleuchtet, und es werden die verschiedenen Perspektiven auf den Drogenkonsum in den 1960er Jahren dargestellt.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Songs „Rainy Day Women #12 & 35" als Ausdruck von Dylans persönlicher Geschichte und seiner Beziehung zu seinem Publikum. Es werden die Themen des Generationenkonflikts, der Suche nach Glück und die Schwierigkeiten, sich selbst zu verwirklichen, im Song beleuchtet. Es wird auch die Frage aufgeworfen, warum Dylan 50 Jahre nach dem Erscheinen des Songs die Apostelgeschichte als Inspiration für den Song nennt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Bob Dylan, Rainy Day Women #12 & 35, Folkmusik, Rockmusik, Gospel, Drogenkonsum, Religion, Generationenkonflikt, politische und kulturelle Landschaft der 1960er Jahre, Identifikationsfigur, Vereinnahmung, Interpretation, Botschaft, Kaleidoskop, Apostelgeschichte, Stephanus, Tempelkult.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Bob Dylan als Identifikationsfigur seiner Generation?
In den 1960er Jahren wurden seine Texte als Sprachrohr für politische und kulturelle Veränderungen verstanden, obwohl er sich selbst oft gegen diese Vereinnahmung wehrte.
Worum geht es in dem Song „Rainy Day Women #12 & 35“?
Der Song wird oft als Drogensong („Everybody must get stoned“) interpretiert, weist aber auch tiefere religiöse und biblische Bezüge auf.
Was war der Skandal von Newport 1965?
Dylan schockierte die Folk-Gemeinde, indem er mit einer elektrisch verstärkten Rockband auftrat und sich damit vom „reinen“ Folk abwandte.
Welche Rolle spielt die Religion in Dylans Werk?
Dylan nutzt oft biblische Metaphern; 1979 wandte er sich explizit dem Gospel zu, was seine ständige Neuerfindung als Künstler unterstreicht.
Was bedeutet die Metapher „Zwischen Faust und Forrest Gump“?
Sie beschreibt Dylans Vielschichtigkeit zwischen intellektuellem Tiefgang (Faust) und seiner Rolle als scheinbar naiver Beobachter der Zeitgeschichte (Forrest Gump).
- Citation du texte
- Johanna Dittrich (Auteur), 2013, Bob Dylan. Zwischen Faust und Forrest Gump, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272318