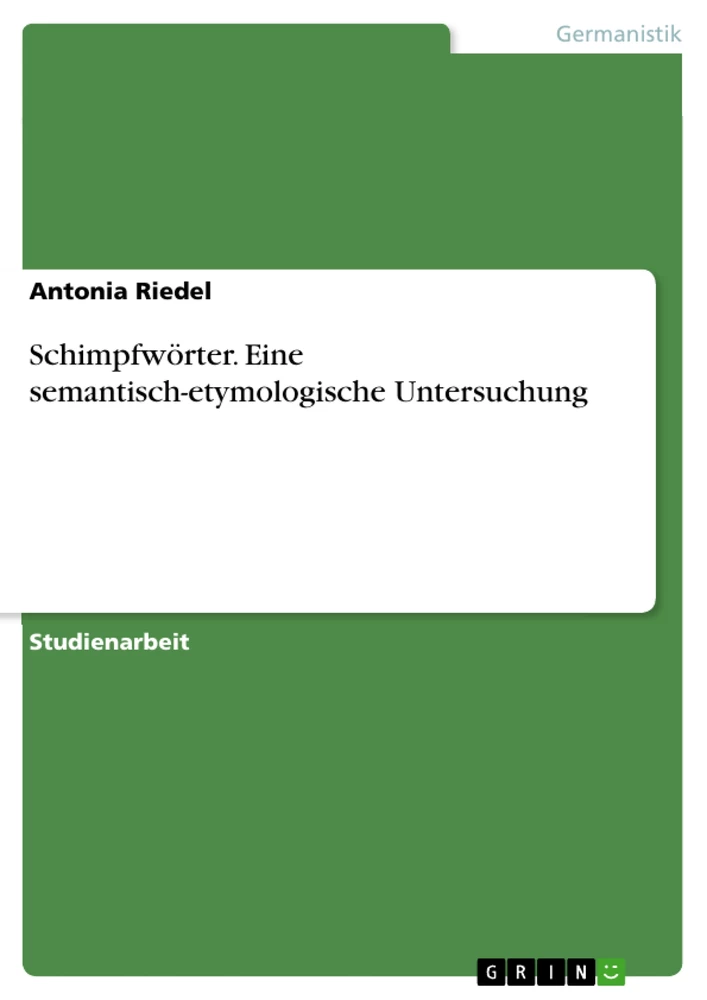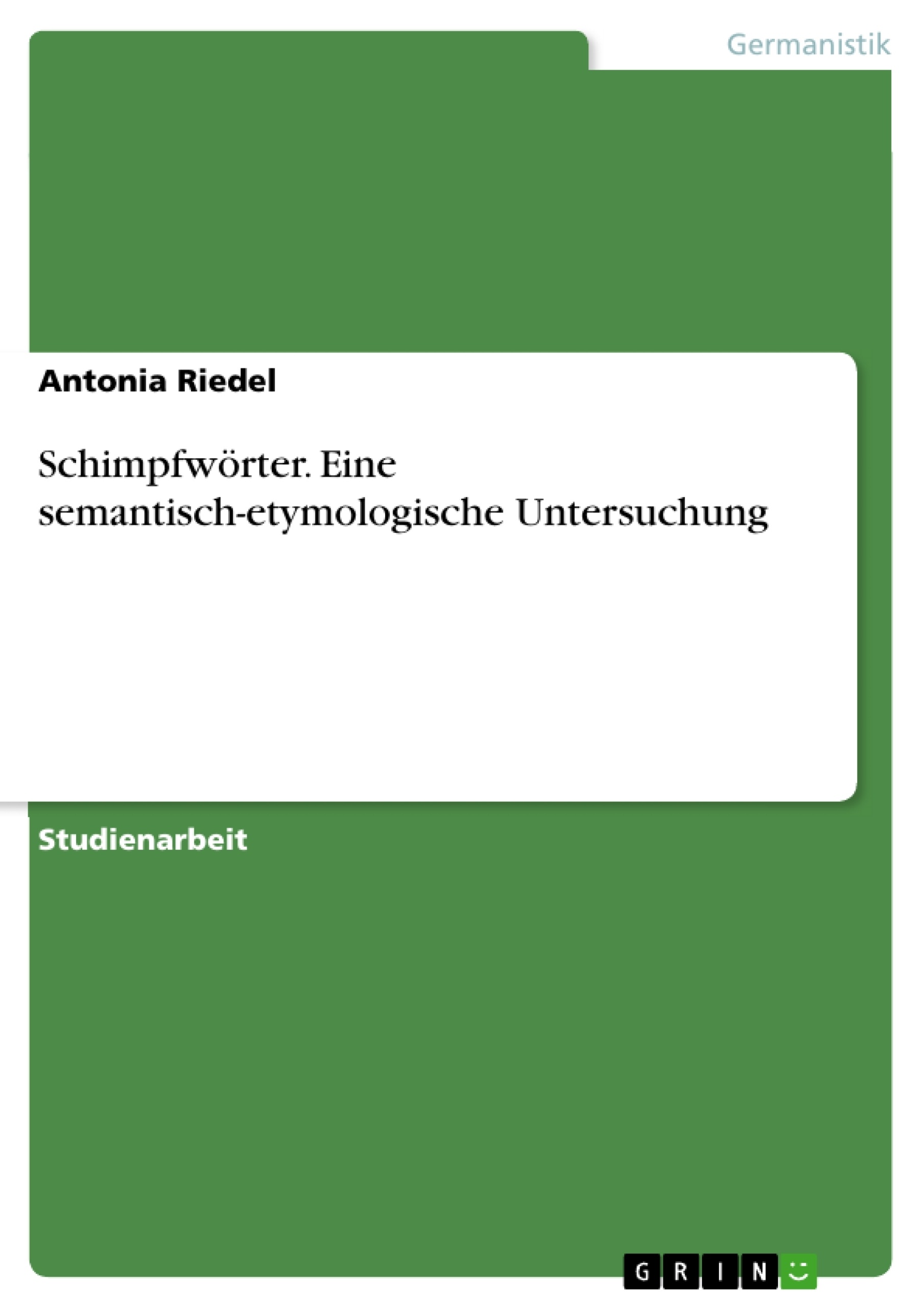Schimpfwörter - jeder nutzt sie, doch über die ursprüngliche Bedeutung ist man sich meist nicht bewusst. In dieser Arbeit stehen die konventionellen Schimpfwörter im Vordergrund; im zweiten Teil der Arbeit werden einige von ihnen beispielhaft etymologisch untersucht, um ihre Wortwurzel frei von pejorisierenden Sprechakten zu betrachten und um zu sehen, ob bereits dort negative oder positive Bewertungen in der Bedeutung vorhanden sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Unterschied zwischen Schimpfwörtern und Spottnamen
- 3. Wirkungsweise von Schimpfwörtern
- 3.1. Schimpfende und Beschimpfte
- 4. Forschungslage
- 5. Untersuchung
- 5.1. Vorgehensweise
- 5.2. Datenerhebung
- 5.3. Analyse
- 6. Exkurs: Schimpfen und kosen mit einem Wort
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht konventionelle Schimpfwörter, sowohl semantisch als auch etymologisch. Ziel ist es, die ursprüngliche Bedeutung der Wörter zu erforschen und deren Wandel im Laufe der Zeit zu analysieren. Besonderes Augenmerk liegt auf der Untersuchung der Beleidigungsfähigkeit und der Affinität zum Funktionswandel. Die Arbeit beleuchtet auch den Unterschied zwischen Schimpfwörtern und Spottnamen.
- Untersuchung der semantischen und etymologischen Entwicklung von Schimpfwörtern
- Analyse der Wirkungsweise von Schimpfwörtern und deren Kontextualisierung
- Differenzierung zwischen Schimpfwörtern und Spottnamen
- Erfassung der Forschungslage zum Thema Schimpfwörter
- Beispielhafte Untersuchung der Doppelbelegung von Wörtern als Schimpf- und Kosewörter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Schimpfwörter ein und stellt die Forschungsfrage nach der ursprünglichen Bedeutung und dem Wandel dieser Wörter im Zeitverlauf in den Mittelpunkt. Sie betont den sozialen Kontext von Sprache und den Gebrauch von Schimpfwörtern als Ausdruck von Aggression und Abwertung. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse konventioneller Schimpfwörter und deren etymologische Untersuchung, um deren ursprüngliche Bedeutung und den Einfluss auf die heutige Beleidigungskraft zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung von Unterschieden in der Beleidigungsfähigkeit verschiedener Wörter und deren unterschiedlicher Affinität zum Funktionswandel.
2. Unterschied zwischen Schimpfwörtern und Spottnamen: Dieses Kapitel differenziert zwischen Schimpfwörtern und Spottnamen. Es hebt hervor, dass Spottnamen passiv erworben werden und die Persönlichkeit und Würde des Betroffenen bedrohen. Im Gegensatz dazu werden Schimpfwörter situationsabhängig gebraucht und sind konventionalisiert. Das Kapitel verdeutlicht die fließenden Übergänge zwischen beiden Kategorien und erklärt, warum eine eindeutige Identifizierung nicht immer einfach ist. Die Analyse beleuchtet die unterschiedliche Wirkungsweise und den jeweiligen Wahrheitsanspruch beider Kategorien im Hinblick auf die Verletzung des "face" des Betroffenen.
3. Wirkungsweise von Schimpfwörtern: Dieses Kapitel beleuchtet die Wirkungsweise von Schimpfwörtern, unter Berücksichtigung der Perspektive sowohl des Schimpfenden als auch des Beschimpften. Es wird der Aspekt der Verletzung der sozialen Identität und des „face“ des Beschimpften diskutiert. Dabei wird der oft unreflektierte Gebrauch von sexistischen, antisemitischen und rassistischen Beschimpfungen hervorgehoben, die konventionalisierte Muster übertragen, ohne den Kontext zu berücksichtigen.
4. Forschungslage: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die bestehende Forschung zum Thema Schimpfwörter, unter Bezugnahme auf relevante Wissenschaftler und deren Arbeiten (Scheffler, Marehn, Acke/Hornscheidt/Jana/Marehn). Er dient als Grundlage für die eigene Untersuchung und die Einordnung der Ergebnisse in den wissenschaftlichen Kontext.
5. Untersuchung: Das Kapitel beschreibt die Vorgehensweise, Datenerhebung und Analyse der Untersuchung. Es erläutert die Methodik, die zur Identifizierung und Analyse verschiedener Arten von Schimpfwörtern verwendet wurde, und fokussiert auf die Nutzer, die aktuelle und ursprüngliche Bedeutung sowie den Gebrauchszeitraum der untersuchten Wörter.
6. Exkurs: Schimpfen und kosen mit einem Wort: Dieser Exkurs untersucht beispielhaft die Doppelbelegung von Wörtern als Schimpf- und Kosewörter. Er analysiert, wie ein und dasselbe Wort je nach Kontext eine positive oder negative Konnotation haben kann und wie sich diese semantische Ambiguität entwickelt hat.
Schlüsselwörter
Schimpfwörter, Spottnamen, Semantik, Etymologiem Beleidigung, Wirkungsweise, Kontext, Sprachwandel, Soziolinguistik, Lexikologie, Lexikographie.
Häufig gestellte Fragen zu: Untersuchung konventioneller Schimpfwörter
Was ist der Gegenstand der Untersuchung?
Die Arbeit untersucht konventionelle Schimpfwörter, sowohl semantisch als auch etymologisch. Ziel ist es, die ursprüngliche Bedeutung der Wörter zu erforschen und deren Wandel im Laufe der Zeit zu analysieren. Besonderes Augenmerk liegt auf der Untersuchung der Beleidigungsfähigkeit und der Affinität zum Funktionswandel. Die Arbeit beleuchtet auch den Unterschied zwischen Schimpfwörtern und Spottnamen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Untersuchung umfasst die semantische und etymologische Entwicklung von Schimpfwörtern, die Analyse ihrer Wirkungsweise und Kontextualisierung, die Differenzierung zwischen Schimpfwörtern und Spottnamen, einen Überblick über die Forschungslage und eine exemplarische Untersuchung der Doppelbelegung von Wörtern als Schimpf- und Kosewörter.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Unterschied zwischen Schimpfwörtern und Spottnamen, Wirkungsweise von Schimpfwörtern, Forschungslage, Untersuchung (Vorgehensweise, Datenerhebung, Analyse), Exkurs: Schimpfen und Kosen mit einem Wort, und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was ist der Unterschied zwischen Schimpfwörtern und Spottnamen?
Spottnamen werden passiv erworben und bedrohen die Persönlichkeit und Würde des Betroffenen. Schimpfwörter hingegen werden situationsabhängig gebraucht und sind konventionalisiert. Die Übergänge zwischen beiden Kategorien sind fließend, eine eindeutige Identifizierung ist nicht immer einfach. Die Analyse beleuchtet die unterschiedliche Wirkungsweise und den jeweiligen Wahrheitsanspruch beider Kategorien im Hinblick auf die Verletzung des "face" des Betroffenen.
Wie funktioniert die Wirkungsweise von Schimpfwörtern?
Dieses Kapitel beleuchtet die Wirkungsweise von Schimpfwörtern aus der Perspektive des Schimpfenden und des Beschimpften. Es wird die Verletzung der sozialen Identität und des „face“ des Beschimpften diskutiert. Der oft unreflektierte Gebrauch von sexistischen, antisemitischen und rassistischen Beschimpfungen und die Übertragung konventionalisierter Muster ohne Berücksichtigung des Kontextes wird hervorgehoben.
Welche Forschungsarbeiten wurden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante Wissenschaftler und deren Arbeiten (z.B. Scheffler, Marehn, Acke/Hornscheidt/Jana/Marehn) zum Thema Schimpfwörter. Diese dienen als Grundlage für die eigene Untersuchung und die Einordnung der Ergebnisse in den wissenschaftlichen Kontext.
Wie wurde die Untersuchung durchgeführt?
Das Kapitel "Untersuchung" beschreibt die Vorgehensweise, Datenerhebung und Analyse. Es erläutert die Methodik zur Identifizierung und Analyse verschiedener Arten von Schimpfwörtern und fokussiert auf die Nutzer, die aktuelle und ursprüngliche Bedeutung sowie den Gebrauchszeitraum der untersuchten Wörter.
Was ist die Kernaussage des Exkurses?
Der Exkurs untersucht die Doppelbelegung von Wörtern als Schimpf- und Kosewörter. Er analysiert, wie ein und dasselbe Wort je nach Kontext eine positive oder negative Konnotation haben kann und wie sich diese semantische Ambiguität entwickelt hat.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schimpfwörter, Spottnamen, Semantik, Etymologiem Beleidigung, Wirkungsweise, Kontext, Sprachwandel, Soziolinguistik, Lexikologie, Lexikographie.
- Arbeit zitieren
- BA Antonia Riedel (Autor:in), 2013, Schimpfwörter. Eine semantisch-etymologische Untersuchung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272320