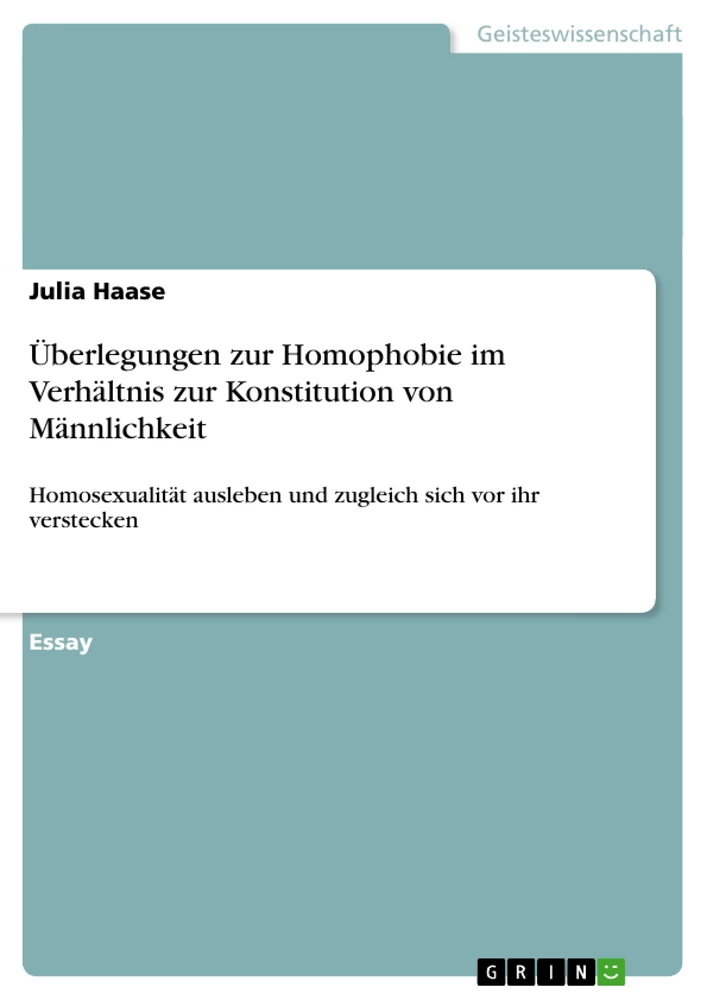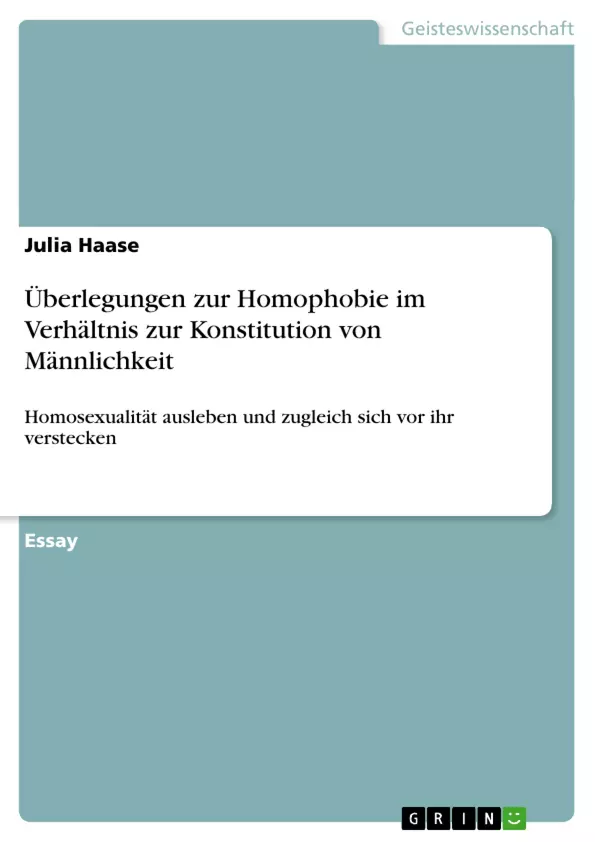Homosexuelle stehen auf der Skala der Binnenhierarchie der Männer ganz unten. Sie werden als „verweiblichte Männer“ betrachtet und zumeist von ihren Geschlechtsgenossen verachtet, gehasst und teils auf grausame Weise verfolgt. Die Entstehung dieses homophoben Hasses soll im Folgenden näher betrachtet werden.
Im männlichen Kampf gegen die als „weiblich“ konnotierten Erfahrungen von Abhängigkeit und Schwäche und für männliche Hegemonie hängen die Strategien zur Abwehr von Homosexualität eng mit den Strategien der Weiblichkeitsabwehr zusammen. Die Parallelen gehen bis in die Kindheit zurück: Im Zuge der Rekategorisierung wird alles Weibliche als „schwach, weil abhängig“ und somit dem „stark, weil unabhängig“ dargestellten Männlichen unterlegen eingeordnet. Ebenso werden auch Jungen im pubertären Entwicklungsstadium, die durch Sensibilität und Einfühlsamkeit und nicht „im besten Fall durch Ungezogenheit, im schlimmsten Fall durch Gewalttätigkeit“ auffallen, als „anders“ und „mädchenhaft“ betrachtet.
„Homosexualität ausleben und zugleich sich vor ihr verstecken“ –
Überlegungen zur Homophobie im Verhältnis zur Konstitution von Männlichkeit
Homosexuelle stehen auf der Skala der Binnenhierarchie der Männer ganz unten. Sie werden als „verweiblichte Männer“[1] betrachtet und zumeist von ihren Geschlechtsgenossen verachtet, gehasst und teils auf grausame Weise verfolgt. Die Entstehung dieses homophoben Hasses soll im Folgenden näher betrachtet werden.
Im männlichen Kampf gegen die als „weiblich“ konnotierten Erfahrungen von Abhängigkeit und Schwäche und für männliche Hegemonie hängen die Strategien zur Abwehr von Homosexualität eng mit den Strategien der Weiblichkeitsabwehr zusammen.[2] Die Parallelen gehen bis in die Kindheit zurück: Im Zuge der Rekategorisierung wird alles Weibliche als „schwach, weil abhängig“ und somit dem „stark, weil unabhängig“ dargestellten Männlichen unterlegen eingeordnet. Ebenso werden auch Jungen im pubertären Entwicklungsstadium, die durch Sensibilität und Einfühlsamkeit und nicht „im besten Fall durch Ungezogenheit, im schlimmsten Fall durch Gewalttätigkeit“[3] auffallen, als „anders“ und „mädchenhaft“ betrachtet.
Der Ausdruck „schwul“ als ausgrenzendes Schimpfwort ist bereits im Wortschatz von Jungen im Grundschul-, wenn nicht sogar Kindergartenalter fest verankert.[4] Auch wenn die psychosoziale Tragweite der Bedeutung noch nicht erfasst werden kann, so ist den Jungen doch klar, dass sie eines auf keinen Fall sein dürfen, nämlich „schwul“. An diesem Befund zeigt sich, dass Homophobie schon früh praktiziert wird und auf scheinbar natürliche Weise als Bestandteil des männlichen Habitus in die Köpfe und Körper der Jungen eingeschrieben wird. Während der Kampf gegen alles Homosexuelle in der Kindheit vorbereitet wird, so brechen im späteren Jugendalter mit der Herstellung einer als „normal“ angesehenen, genitalzentrierten, homosexuellen Männlichkeit die radikalen Abwehrmechanismen hervor und führen zu einer Verstärkung der generell in dieser Zeit bei männlichen Jugendlichen anzutreffenden Hass- und Gewaltbereitschaft.[5]
Eine Zielgruppe, auf die sich die Hass- und Gewaltpotentiale beziehen, sind sämtliche weibliche Wesen, wobei es sich dabei um verschobenen, projizierten Hass handelt. Die Abwertung der Frau vollzieht sich unbewusst und gründet sich auf Feindseligkeit gegenüber den als „weiblich“ rekategorisierten und somit als fremd und unmännlich empfundenen eigenen Charakteranteilen. Es handelt sich hierbei eigentlich um Selbsthass gegenüber den unerwünschten Anteilen am eigenen Geschlecht,[6] deren Existenz auf das „andere“ Geschlecht zurückgeführt wird, das gemäß der Zuschreibung von geschlechtsspezifischen Charakteristika alleiniger Träger dieser Anteile sein sollte: Das Weibliche. Stellvertretend für die Mutter als erste Pflege- und Bezugsperson, aber auch als erstes Liebesobjekt und somit „Verantwortliche“ für den auszumerzenden Zustand der Abhängigkeit, werden in der Adoleszenz weibliche Wesen allgemein für Gefühle von Zärtlichkeit oder Zuneigung verantwortlich gemacht. Jede Empfindung, die eindeutig als „bindend“ und „abhängigkeitserzeugend“ identifiziert werden kann, muss aus dem Ich verbannt und im Äußeren vernichtend verfolgt werden. So ist Frauenhass im Grunde der Hass gegen eigene „weibliche“ Merkmale und wird erst mithilfe archaischer Abwehrmechanismen der Abspaltung, Verschiebung und Projektion vom Selbst auf ein äußeres Objekt gerichtet.
Mit der Abwehr der Homosexualität verhält es sich sehr ähnlich, auch wenn behauptet wird, dass der Unterschied der beiden Abwehrformen darin besteht, dass im Falle der Frauenverachtung angstauslösende innere Objekte projiziert und im Äußeren verfolgt werden, während bei der Homophobie eigene Triebregungen abgewehrt werden, was den Schluss zulässt, dass Frauen das Fremde und Schwule zumindest zunächst das Eigene repräsentieren.[7]
Diese Feststellung ist diskussionswürdig insofern, als dass das Weibliche zunächst auch das Eigene ist, bis es während der Rekategorisierung als „fremd“ beziffert wird und in der ersten Phase der Produktion von Männlichkeit restlos ausgetrieben werden soll, um den Zwängen gerecht zu werden, die mit der gesellschaftlichen Einforderung zur hegemonialen Männlichkeit einher gehen. Auch die Triebregungen gegenüber Mädchen werden während der Pubertät besonders rigide, bis zur „Verbannung des Eros“ abgewehrt und tauchen unter ambivalenten bis misogynen Vorzeichen erst wieder nach dem Durchlaufen aller drei Phasen der Männlichkeitsherstellung auf. Die letzte Phase ist die der „Angliederung“, des „Wiedereinstiegs“ in den heterosozialen Raum, die sich an die Phasen der Trennung vom Weiblichen und der Umwandlung zum rein Männlichen anschließt.
[...]
[1] Pohl, Rolf: Feindbild Frau. Männliche Sexualität, Gewalt und die Abwehr des Weiblichen. Hannover: Offizin 2004. Pohl gemäß Connell. S. 328.
[2] Vgl. Pohl. Ebd.
[3] Pohl gemäß Kaplan. S. 326.
[4] Vgl. Pohl. S. 330.
[5] Vgl. Pohl. S. 328.
[6] Vgl. Pohl. Ebd.
[7] Vgl. Pohl. S. 329.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Homophobie und die Konstitution von Männlichkeit zusammen?
Homophobie dient oft als Abwehrmechanismus, um alles „Weibliche“ oder „Schwache“ aus der männlichen Identität auszuschließen und eine hegemoniale Männlichkeit zu sichern.
Warum wird „schwul“ oft als Schimpfwort unter Jungen verwendet?
Bereits im Kindesalter wird der Begriff genutzt, um eine Abgrenzung zum Nicht-Männlichen zu markieren, noch bevor die sexuelle Bedeutung voll verstanden wird.
Was bedeutet „Weiblichkeitsabwehr“ in diesem Kontext?
Es ist der Versuch, Eigenschaften wie Sensibilität oder Abhängigkeit als „unmännlich“ abzuwerten und aus dem eigenen Selbstbild zu verbannen.
Welche Rolle spielt die Adoleszenz bei der Entstehung von Homophobie?
In der Jugendphase verstärken sich oft radikale Abwehrmechanismen, um eine „normale“ heterosexuelle Männlichkeit zu demonstrieren, was zu Hass- und Gewaltbereitschaft führen kann.
Ist Frauenhass mit Homophobie vergleichbar?
Ja, beide basieren laut der Arbeit auf der Projektion und Abspaltung eigener, als „weiblich“ empfundener Charakteranteile, die im Außen bekämpft werden.
- Quote paper
- Julia Haase (Author), 2007, Überlegungen zur Homophobie im Verhältnis zur Konstitution von Männlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272551