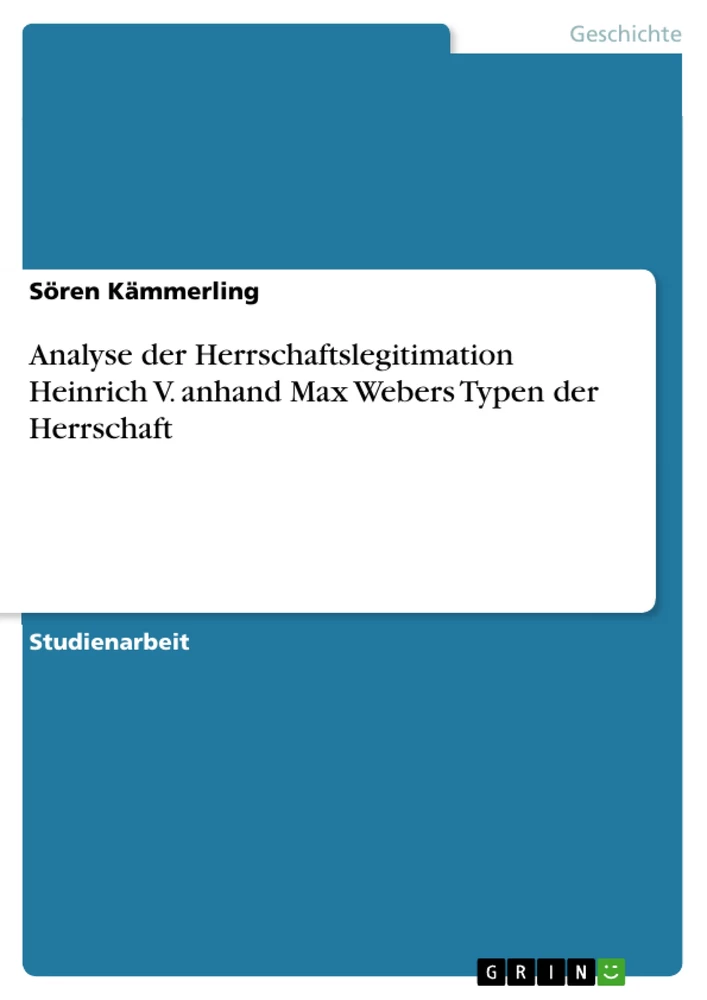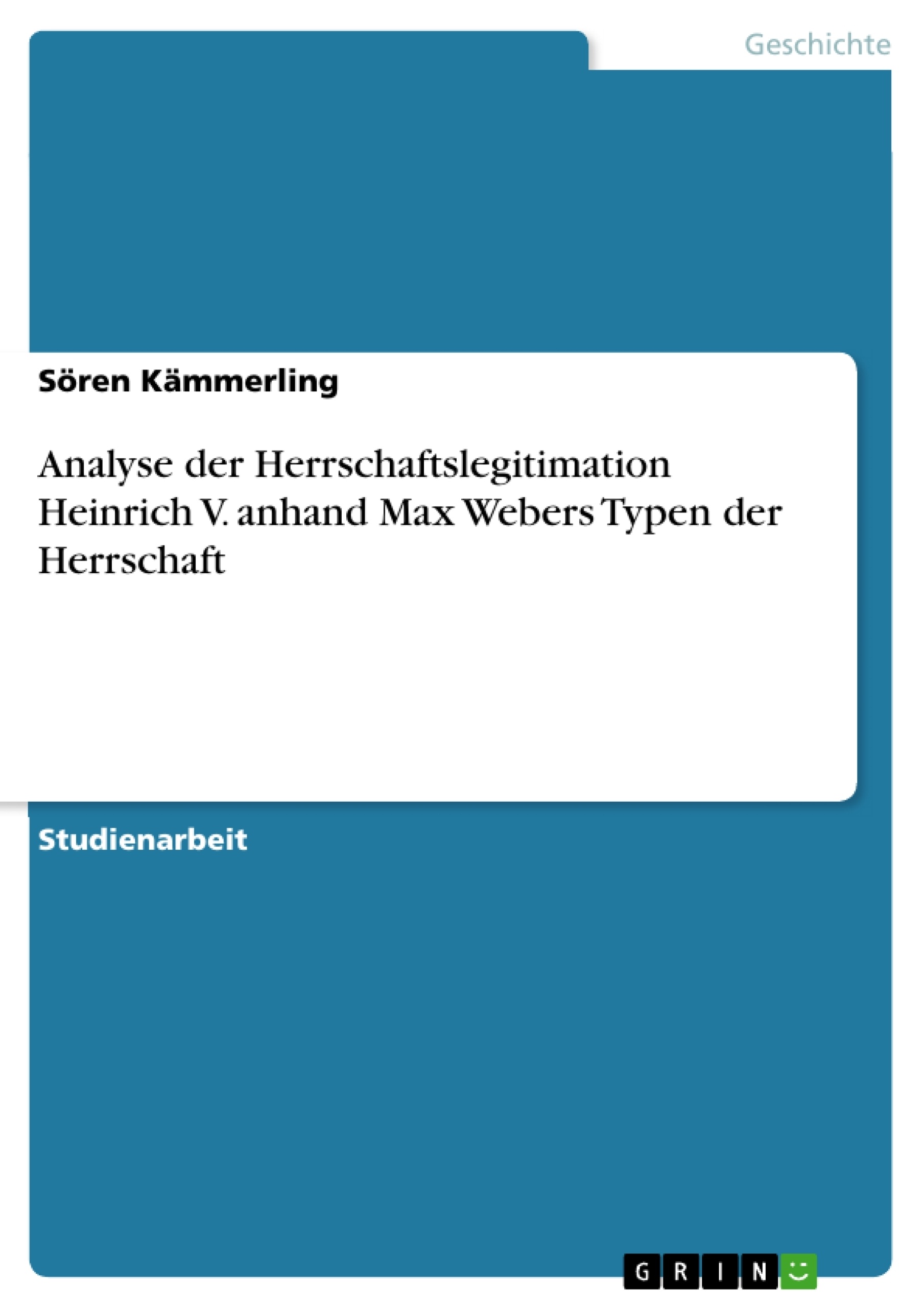Heinrich V. gehört zu den bisher am wenigsten erforschten Herrschern in der Zeit der Salier. Dies ist besonders verwunderlich, da dessen Herrschaftsübernahme und die damit verbundene Absetzung seines Vaters Heinrich IV. historisch unverwechselbar ist. Heinrich V. wird in der Forschung häufig sehr geringschätzig beurteilt, allerdings gab es in den letzten Jahren, durch Stefan Weinfurter, Jutta Schlick und Jürgen Dendorfer, den Versuch einer Neubewertung. Die Frage nach dem Charakter Heinrich V. und der Bewertung seiner Herrschaftsübernahme wird bis heute in der Forschung kontrovers diskutiert und somit können in dieser Arbeit nur verschiedene Standpunkte beleuchtet werden, um einen Einblick in Heinrich V. Herrschaftslegitimation zu geben.
„Niemand ist in der Sinnflut gerettet worden außerhalb der Arche, welche die Gestalt der Kirche trug.“
Dieser Hinweis, den die sächsischen Grafen in einem ihrer Briefe an den Grafen Berengar von Sulzbach richteten, soll Heinrich V. als einer der wichtigsten Motive gedient haben, sich gegen seinen Vater zu stellen. Sowohl Heinrich V., als auch seine fürstlichen Unterstützer, handelten demnach aus Angst um ihr Seelenheil. Mit Blick auf die Wichtigkeit, die Heinrich V. diesem Motiv beimaß, wird der erhebliche Einfluss, den die katholische Kirche in der damaligen Zeit auf politische Entscheidungsprozesse nahm, deutlich. Auch Weber betont in seinem Werk die maßgebliche Rolle religiöser Institutionen im Mittelalter, beispielsweise in der mittelalterlichen Stadt.
„Die oft recht bedeutende Rolle, welche die kirchliche Gemeinde bei der verwaltungstechnischen Einrichtung der mittelalterlichen Stadt gespielt hat , ist nur eines von vielen Symptomen für das starke Mitspielen dieser, die Sippenbande auflösenden und dadurch für die Bildung der mittelalterlichen Stadt grundlegend wichtigen Eigenschaften der christlichen Religion.“
Es wird somit offenkundig, dass die Kirche durch ihre Macht in nicht unerheblichem Maße dazu beitrug, die Herrschaft der Könige bzw. Kaiser zu sichern und zu beschränken.
Max Weber differenziert in dieser Hinsicht recht klar zwischen Macht und Herrschaft, wobei ein fließender Übergang von der reinen Machausübung hin zur legitimierten Herrschaft deutlich wird. Weber beschreibt Macht als das Vorhandensein von Möglichkeiten den eigenen Willen gegen den Willen anderer, auch beim Vorliegen unterschiedlicher Interessenslagen, durch verschiedenste Mittel durchzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Historischer Kontext Heinrich V
3. Quelleninterpretation
3.1 Quellenanalyse
3.2 Kritische Auseinandersetzung mit der Quelle
4. Heinrichs Herrschaftslegitimation
4.1 Legitimation gegenüber dem Vater
4.2 Legitimation gegenüber den Fürsten
4.3 Legitimation gegenüber der Kirche
5. Fazit
6. Quellen- und Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie legitimierte Heinrich V. seinen Machtanspruch gegenüber seinem Vater?
Heinrich V. rechtfertigte die Absetzung seines Vaters Heinrich IV. unter anderem mit der Sorge um das Seelenheil und der Notwendigkeit der Versöhnung mit der Kirche.
Welche Rolle spielt Max Webers Herrschaftstypologie in dieser Arbeit?
Die Arbeit nutzt Webers Konzepte von Macht und legitimer Herrschaft, um die politische Positionierung Heinrich V. im mittelalterlichen Gefüge zu analysieren.
Warum war die katholische Kirche für Heinrich V. so wichtig?
Die Kirche war im Mittelalter eine zentrale Legitimationsquelle; ohne ihre Anerkennung war eine stabile Herrschaft über das Reich kaum möglich.
Wie beurteilt die moderne Forschung Heinrich V.?
Während er früher oft geringschätzig betrachtet wurde, gibt es in der neueren Forschung (z.B. durch Stefan Weinfurter) Versuche einer differenzierteren Neubewertung seiner Herrschaft.
Was war das Motiv der sächsischen Grafen bei der Unterstützung Heinrichs?
Die Grafen sahen in Heinrich V. eine Möglichkeit, die Konflikte des Investiturstreits zu beenden und die Ordnung im Reich wiederherzustellen.
- Quote paper
- Sören Kämmerling (Author), 2013, Analyse der Herrschaftslegitimation Heinrich V. anhand Max Webers Typen der Herrschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272646