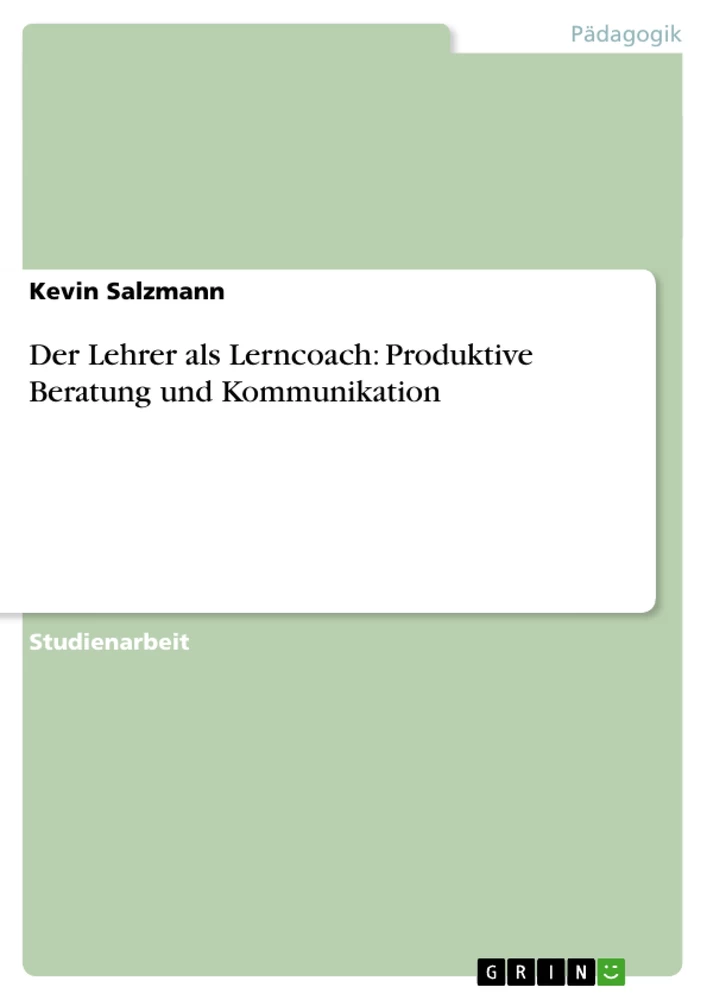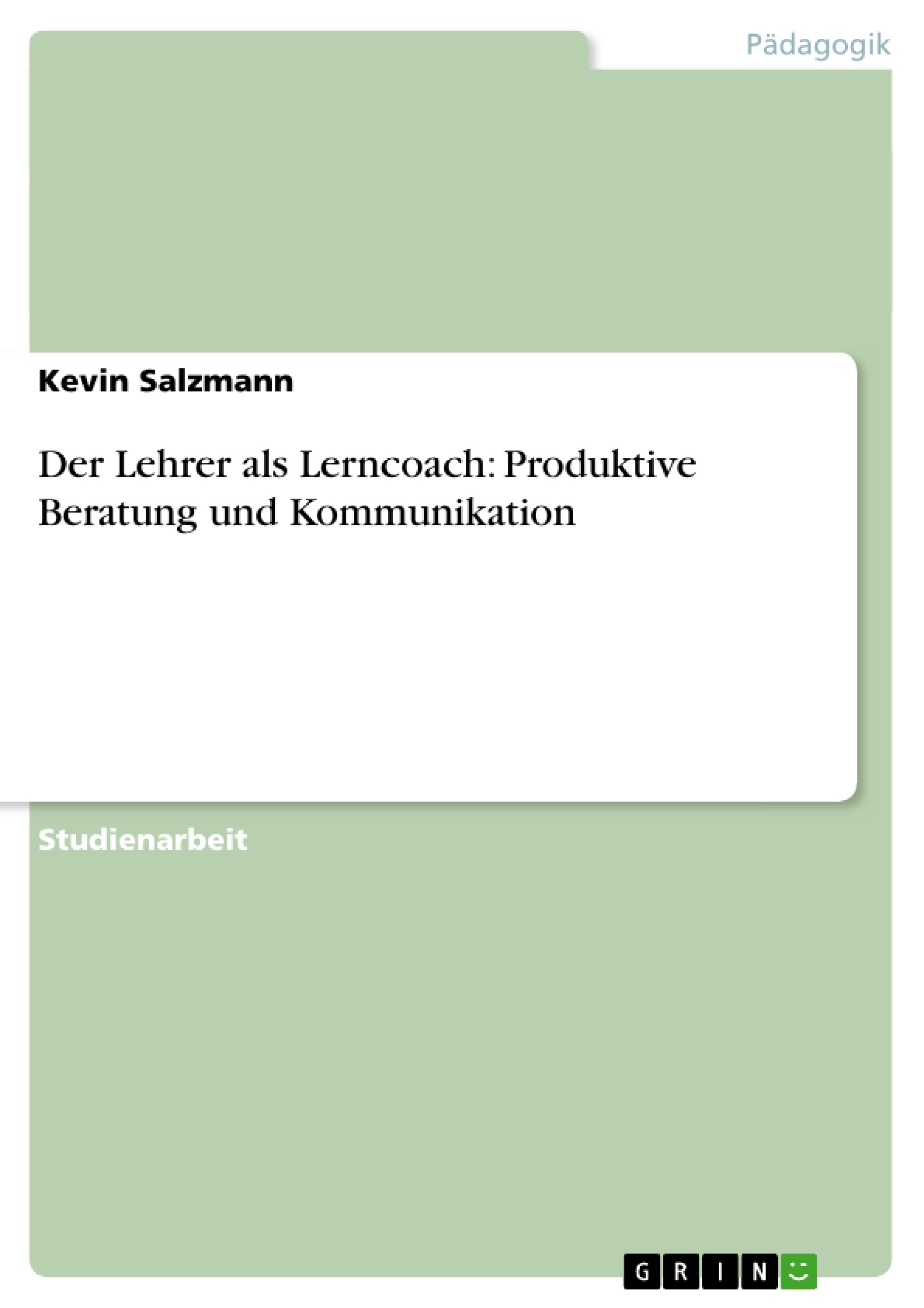Betrachtet man die vielseitigen Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern, so steht dabei neben erzieherischen und bürokratischen Angelegenheiten klar die Vermittlung von Wissen im Mittelpunkt. LehrerInnen bereiten Fachwissen didaktisch auf und sorgen so dafür, dass ihre SchülerInnen etwas lernen; sie nehmen also eine vermittelnde Funktion ein.
Die Betrachtung der Lehrperson als reinen Wissensvermittler ist nach wie vor weit verbreitet, obgleich dieses Konzept vom Ansatz des „Lehrers als Lerncoach“ in Frage gestellt wird. Die Idee des Lehrers als Lerncoach unterscheidet sich von der klassischen Definition der Lehrperson vorzugsweise im Bereich der preofessionellen Beratung: „Der Ansatz des Lerncoachings basiert auf der Idee, durch professionelle Beratung die vorhandenen Lerndispositionen des Lerners zu erkennen und zu optimieren. Lerncoaching bedeutet individuelle (auch gruppale) Beratung und geht über die übliche Didaktisierung des Lehrens und Lernens hinaus.“1
Es geht also nicht um reine Wissensvermittlung, sondern vielmehr um das professionelle Begleiten des Lerners und die damit verbundene Berücksichtigung individueller Leistungsniveaus. Die Lehrperson ist ein Berater, der seine SchülerInnen dabei unterstützt, Lernverhalten und Leistungsmotivation zu fördern sowie Stärken und Schwächen zu erkennen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Lerncoaching - Eine Definition
1.2 Beratungsprozesse im Bereich des Lerncoachings
1.3 Produktive Kommunikation
2. Hauptteil
2.1 Beratung im schulischen Kontext im Sinne des Lerncoachings
2.2 Gesprächsführung und aktives Zuhören
3. Fazit
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Lerncoaching - Eine Definition
Betrachtet man die vielseitigen Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern, so steht dabei neben erzieherischen und bürokratischen Angelegenheiten klar die Vermittlung von Wissen im Mittelpunkt. LehrerInnen bereiten Fachwissen didaktisch auf und sorgen so dafür, dass ihre SchülerInnen etwas lernen; sie nehmen also eine vermittelnde Funktion ein. Die Betrachtung der Lehrperson als reinen Wissensvermittler ist nach wie vor weit verbreitet, obgleich dieses Konzept vom Ansatz des „Lehrers als Lerncoach“ in Frage gestellt wird. Die Idee des Lehrers als Lerncoach unterscheidet sich von der klassischen Definition der Lehrperson vorzugsweise im Bereich der preofessionellen Beratung: „Der Ansatz des Lerncoachings basiert auf der Idee, durch professionelle Beratung die vorhandenen Lerndispositionen des Lerners zu erkennen und zu optimieren. Lerncoaching bedeutet individuelle (auch gruppale) Beratung und geht über die übliche Didaktisierung des Lehrens und Lernens hinaus.“1
Es geht also nicht um reine Wissensvermittlung, sondern vielmehr um das professionelle Begleiten des Lerners und die damit verbundene Berücksichtigung individueller Leistungsniveaus. Die Lehrperson ist ein Berater, der seine SchülerInnen dabei unterstützt, Lernverhalten und Leistungsmotivation zu fördern sowie Stärken und Schwächen zu erkennen.
1.2 Beratungsprozesse im Bereich des Lerncoachings
„Beratung gehört zu den grundlegenden Formen pädagogischen Handelns.“2 Nicht nur in therapeutischen Einrichtungen, sondern auch in Schulen ist die Aufgabe des Beratens von besonderer Bedeutung. Primäres Ziel der Beratung im Bereich des Lerncoachings ist es, SchülerInnen dazu zu bringen, das eigene Problem selbst zu erkennen, um es so gemeinsam lösungsorientiert zu beseitigen. Den SchülerInnen werden Perspektiven eröffnet, welche bestimmte Lösungsmöglichkeiten zulassen. Man spricht hierbei von „Hilfe zur Selbsthilfe“:
„Sie dient der Weiterentwicklung der Problemlösekompetenz.“3
Die Beratung durch einen Lehrer als Lerncoach unterscheidet sich von einer alltäglichen Beratung (bspw. durch Freunde oder Bekannte), indem sie in einem institutionalisertem (schulischem) Setting sowie halbformalisiert stattfindet, da LehrerInnen in der Regel nicht primär als BeraterInnen fungieren, da sie in diesem Gebiet nicht explizit ausgebildet wurden. Dennoch wird einer Lehrkraft heutzutage vermehrt die Aufgabe der systemischen Beratung zugewiesen, bei der es darum geht, durch Ratschläge eine produktive Prozessbegleitung einzunehmen, die darauf abzielt, dass der Ratsuchende selbst für die Problemlösung verantwortlich ist.4
1.3 Produktive Kommunikation
Wie bereits dargestellt wurde, sollen SchülerInnen im kooperativen Setting des Lerncoachings zu kompetenten Problemlösungsstrategien hingeführt werden, wobei sie von der Lehrperson unterstützt werden. Die Wichtigkeit der professionellen Beratung wurde diesbezüglich bereits kurz umrissen und wird im Hauptteil detaillierter fokussiert.
Damit aber eine professionelle Beratung durch einen Lerncoach gelingen kann, bedarf es ebenso einer produktiven Kommunikation zwischen dem Lehrer bzw. der Lehrerin und dem Schüler bzw. der Schülerin. Hierfür ist eine „personenzentrierte Gesprächsführung“5 von besonderer Wichtigkeit. Diese setzt sich zusammen aus verschiedenen Elementen, welche als Lernberater zu beachten sind: Aufmerksames Zuhören, Gedanken und Gefühle wiedergeben, Stellung nehmen, aber auch die Aufgabe, Lösungsvorschläge zu sammeln und zu evaluieren, können hierbei beispielhaft genannt werden.6
Kern dieses kooperativen Beratungsgesprächs bleibt nach wie vor ein lösungsorientierter Ansatz, bei dem sich weniger auf das eigentliche Problem konzentriert wird, sondern die Suche nach einer adäquaten Lösung für das individuelle Problem im Mittelpunkt steht.
2. Hauptteil
2.1 Beratung im schulischen Kontext im Sinne des Lerncoachings
Die professionelle Beratung vonseiten der Lehrkraft ist besonders dann wichtig, wenn der Unterricht „offen“ gestaltet wird. SchülerInnen sollen weitgehend selbstgesteuert lernen und in kooperativen Lernformen individuell gefordert und gefördert werden. Dies stellt eine besondere Herausforderung an die Lehrperson dar, weil sie in solch einer Lernumgebung nicht immer die Kontrolle darüber hat, auf welchem Lernstandsnivau sich die SchülerInnen befinden. Die SchülerInnen sollen selbst erkennen, was sie bereits können und was nicht und somit selbst entscheiden, welchen Schwierigkeitsgrad die einzelnen Aufgaben haben, die sie bearbeiten.
Da den SchülerInnen so die Aufgabe überlassen wird, den eigenen Lernprozess immer wieder aufs Neue zu reflektieren und selbst entscheiden zu müssen, an was für Aufgaben und intellektuelle Herausforderungen sie sich herantrauen oder nicht, geht diese „moderne“ Form des Unterrichts oft mit einigen Problemen einher: SchülerInnen laufen Gefahr, in ihren individuellen Lernstrategien zu scheitern, sie schaffen es nicht, mit selbstgesteuerten Lernformen umzugehen oder entwickeln womöglich Abwehrhaltungen gegen den Lernstoff, da sie sich überfordert fühlen. In solchen Fällen von Lernschwierigkeiten kommt die Lernberatung durch den Lerncoach zum tragen. Die Lehrperson muss hier gezielt intervenieren und den jeweiligen Schüler bzw. die Schülerin professionell beraten.
Wie der Titel dieser Arbeit bereits erwähnt, ist die Beratung eine Kernkompetenz der Lehrperson im Bereich des Lerncoachings. Die Beratung basiert auf drei Ebenen, durch deren Beachtung und Einhaltung eine Lernberatung erfolgreich sein kann: Information, Unterstützung und Steuerung. Diese sollen im Folgenden genauer beleuchtet werden. Allgemein lässt sich sagen, dass „das persönliche Beratungsgespräch mit ihnen [den SchülerInnen] grundlegend für den Beratungserfolg ist“7. Wird ein Schüler oder eine Schülerin beispielsweise aufgrund von Lernschwierigkeiten in Mathematik beraten, muss in der Informationsphase zunächst einmal gemeinsam besprochen werden, wo genau das Problem liegt. SchülerIn und Lehrperson versuchen herauszufinden, wie das Problem beseitigt werden kann, wobei hier dem Schüler bzw. der Schülerin immer die Möglichkeit gegeben werden muss, selbst zu überlegen und die eigene Lernsituation zu reflektieren.
[...]
1 Pallasch & Hamayer: Lerncoaching. Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele zu einer didaktischen Herausforderung. Juventa Verlag Weinheim und München, 2008. S. 10
2 Schnebel, Stefanie: Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule. 2. Aufl. Beltz Verlag 2012, S. 29. Zit. n.: Aurin 1984, S. 13; Engel 2004, S.103
3 Schnebel (2012), S.17
4 Vgl. Bogdanow, Pamela (2013): Der Lehrer als Lerncoach: Vom Erzieher zum Begleiter (SS 2013). Skript zum Blockseminar, S. 15
5 Vgl. Schnebel (2012), S. 151
6 Schnebel (2012), S. 153. Die beispielhaft genannten Aspekte beziehen sich auf Abb. 19: Elemente einer kooperativen Gesprächsführung (Redlich 1994)
7 Vgl. Schnebel (2012), S. 71. Zit. n. Neumann (2005), S. 198
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Lehrer und einem Lerncoach?
Während der klassische Lehrer primär Wissen vermittelt, fungiert der Lerncoach als professioneller Berater, der individuelle Lernprozesse begleitet und optimiert.
Was bedeutet „Hilfe zur Selbsthilfe“ im Lerncoaching?
Das Ziel ist es, Schüler dazu zu bringen, ihre Lernprobleme selbst zu erkennen und eigenständig lösungsorientierte Strategien zu entwickeln.
Welche Rolle spielt die Kommunikation im Lerncoaching?
Eine produktive, personenzentrierte Gesprächsführung ist essenziell. Dazu gehören aktives Zuhören, das Spiegeln von Gefühlen und das gemeinsame Sammeln von Lösungen.
Warum ist Lernberatung besonders in „offenem Unterricht“ wichtig?
In offenen Lernformen steuern Schüler ihr Lernen selbst. Der Lerncoach muss intervenieren, wenn Schüler sich überfordert fühlen oder an ihren eigenen Strategien scheitern.
Welche drei Ebenen sind für den Beratungserfolg entscheidend?
Eine erfolgreiche Lernberatung basiert auf den drei Ebenen: Information (Problemklärung), Unterstützung (Begleitung) und Steuerung (Strukturierung des Prozesses).
- Quote paper
- Kevin Salzmann (Author), 2013, Der Lehrer als Lerncoach: Produktive Beratung und Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272679