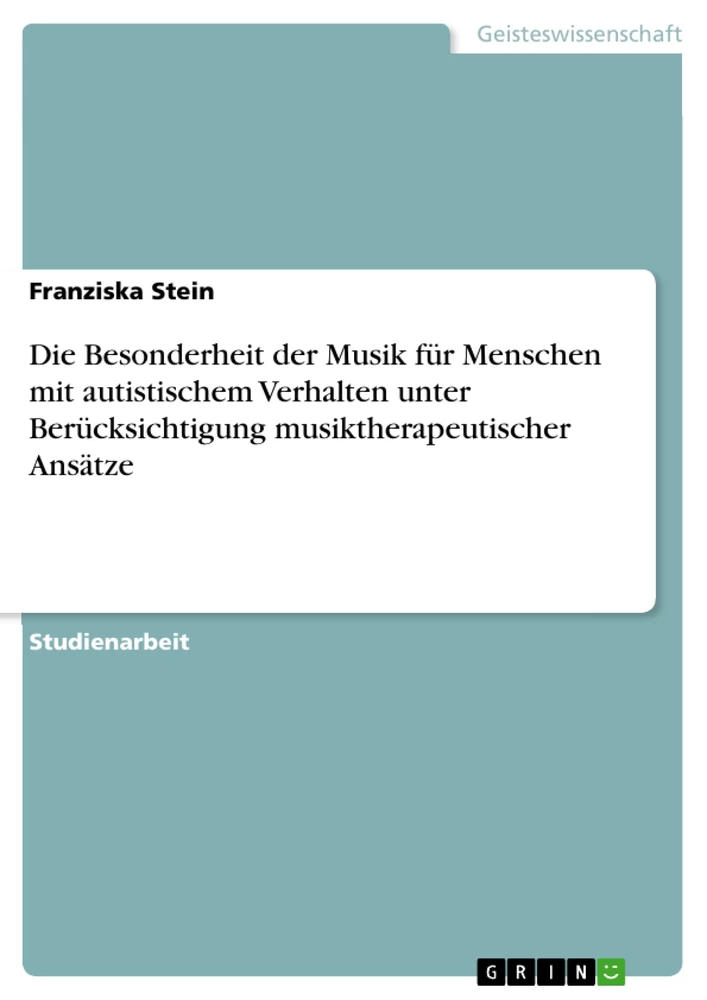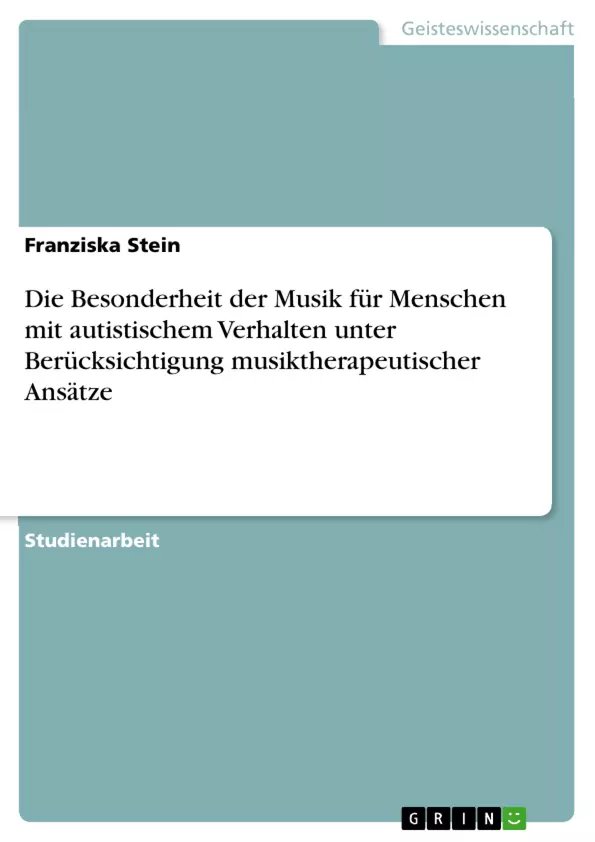Die Musik ist für jeden von uns wichtig, für manche mehr und für manche weniger. Durch sie wird es uns ermöglicht Gefühle auszudrücken oder auszuleben. Doch was für eine Bedeutung hat die Musik für einen Menschen, der nicht in der Lage ist mit Worten, Mimik oder Gestik seine Gefühle äußern zu können? Dieser Frage bin ich in meiner Hausarbeit auf den Grund gegangen und nehme zusätzliche auf die therapeutische Funktion der Musik Bezug.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Zur Geschichte des Begriffs Autismus
1.2 Definition der Autismus- Spektrum- Störung
1.3 Symptome und Verhaltensmuster
1.4 Besondere Auffälligkeiten der Sprache
2. Was ist Musik?
2.1 Die Wirkung der Musik auf den Menschen
2.2 Die Wirkungsweise der Musik
3. Musiktherapie
3.1 Definition und Zielsetzung
3.2 Die Methodik der Musiktherapie
3.3 Das Setting
3.4 Musiktherapeutische Förderung von Menschen mit autistischem Verhalten
4. Musiktherapeutische Ansätze
5. Ein Exemplarischer Verlauf einer Musiktherapie
6. Der Bezug zum Seminar
7.Fazit Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Franziska Stein (Author), 2014, Die Besonderheit der Musik für Menschen mit autistischem Verhalten unter Berücksichtigung musiktherapeutischer Ansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272712