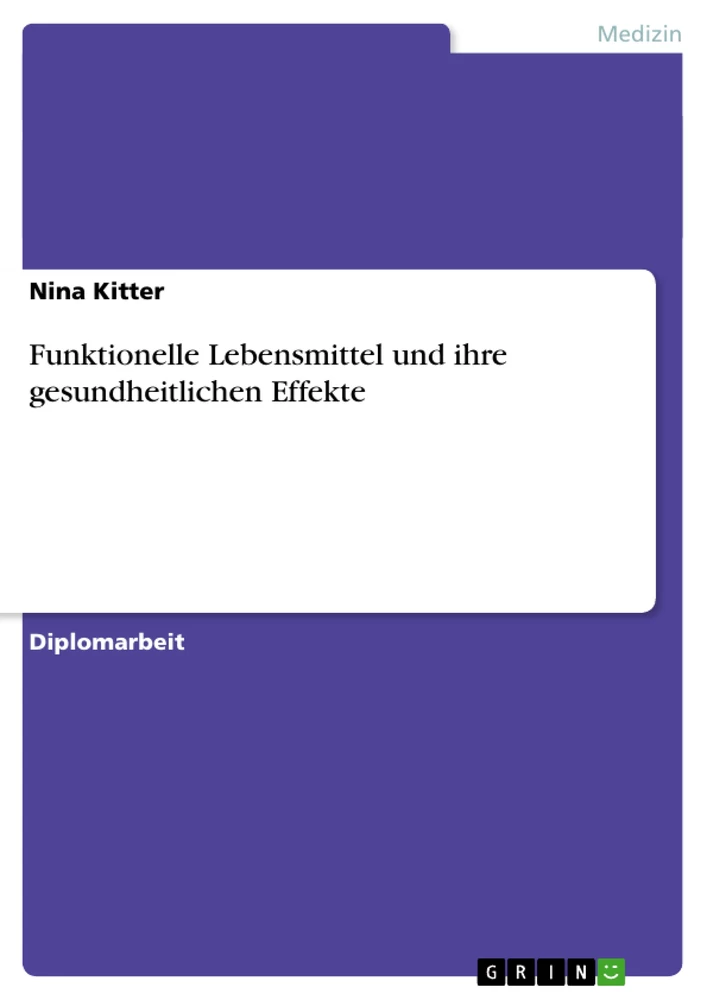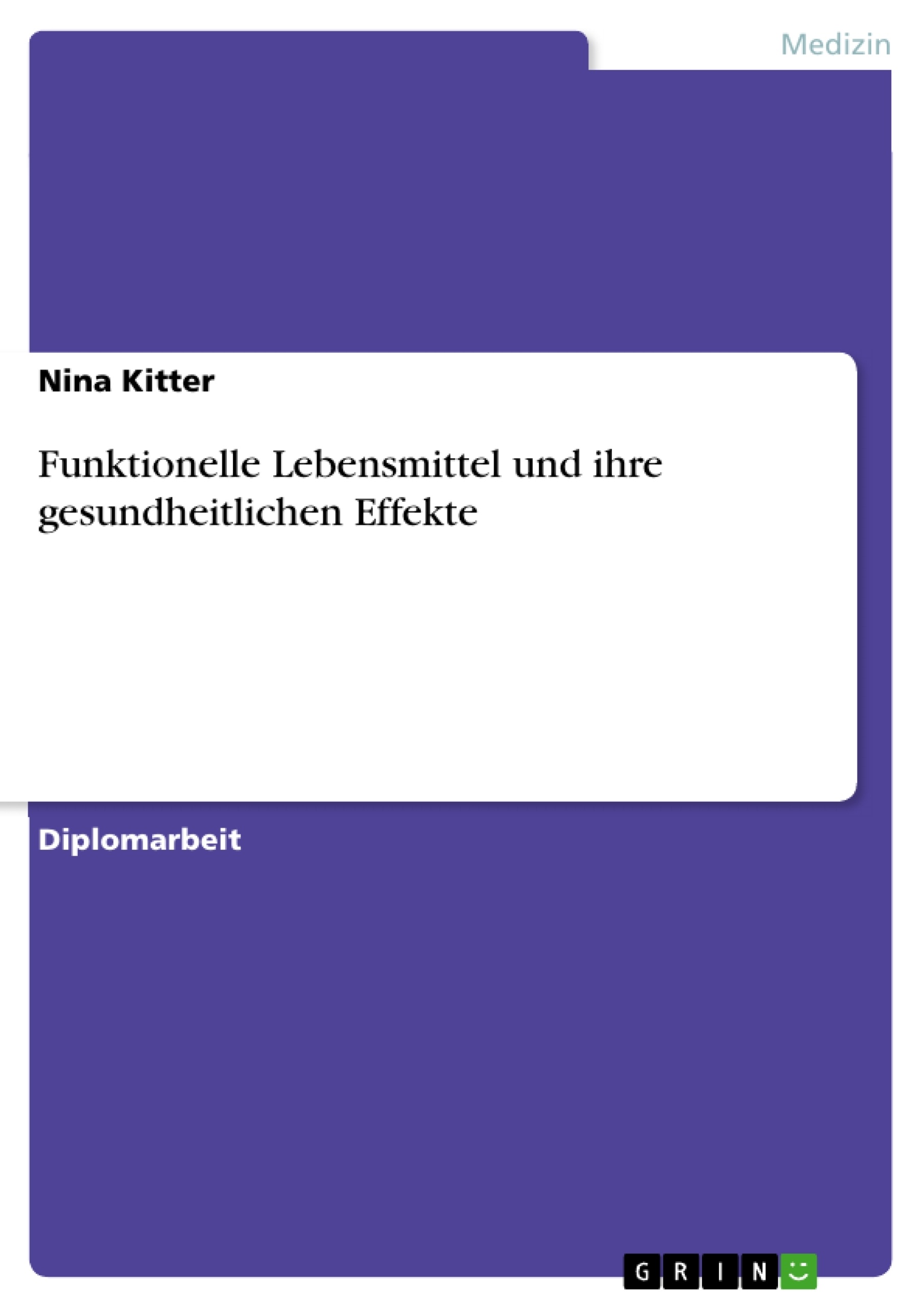„Nahrung soll eure Medizin und Medizin eure Nahrung sein“ (Milner 1999). So forderte der griechische Philosoph und Naturgelehrte Hippokrates vor rund 2500 Jahren. Auch wenn er nicht der Erfinder von so genannten funktionellen Lebensmitteln ist, zeigt dies, dass die Idee von Nahrungsmitteln mit gesundheitlichem Nutzen nicht erst in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Im 19. Jahrhundert war die Philosophie „Lebensmittel als Medizin“ durch die moderne Arzneimitteltherapie in Vergessenheit geraten, indessen gewann im Laufe des 20. Jahrhunderts die wichtige Rolle der Ernährung als Prävention gegen Krankheiten wieder an Bedeutung (Hasler 2002, Palou et al. 2003). Gesundheitsbezogene Effekte von bestimmten Lebensmittelinhaltsstoffen wurden weiter untersucht und rückten wieder in den Blickpunkt der Forschung. Um diese positiven Eigenschaften von Lebensmittelinhaltsstoffen zu nutzen und der breiten Masse zugänglich zu machen, wurden so genannte funktionelle Lebensmittel entwickelt. Vielverzehrte Lebensmittel wurden durch Zusätze wie Vitamine oder probiotische Mikroorganismen sowie durch Neuzüchtung von beispielsweise hypoallergenem Reis mit einem zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen versehen.
Lebensmittel mit einem positiven Effekt auf die Gesundheit liegen im Trend und wachsen zu einer immer größer werdenden Produktschiene heran (Wolters et al. 2001). Zudem ist das Bewusstsein für funktionelle Lebensmittel in der Gesellschaft gestiegen. Das Umsatzvolumen von funktionellen Lebensmitteln liegt in Deutsch- land bei ca. 715 Millionen Euro und einem Marktanteil von 5-10% des Lebensmit- telmarktes (Wolters et al. 2001). Experten prognostizieren bis zum Jahr 2010 ei- nen Anstieg des Produktangebots im Bereich der funktionellen Lebensmittel auf 20% (Kiefer et al. 2002). Probiotische Lebensmittel wurden 1996 als erste funk- tionelle Lebensmittel auf dem deutschen Lebensmittelmarkt eingeführt und wiesen 1999 bereits einen Marktanteil von 14% bei Joghurt- und Milchgetränken auf. Im Laufe der Zeit kamen weitere funktionelle Lebensmittel wie Prebiotika oder Le- bensmittel mit sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen, ω-3-Fettsäuren oder Bal- laststoffen auf den Markt (Wolters et al. 2001).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von funktionellen Lebensmitteln
- Begriffsbestimmung
- Rechtliche Einordnung von funktionellen Lebensmitteln
- Rechtliche Einordnung in Deutschland und in der EU
- Rechtliche Einordnung in Japan und den USA
- Abgrenzung der funktionellen Lebensmittel von herkömmlichen Lebensmitteln
- Abgrenzung der funktionellen Lebensmittel von Arzneimitteln
- Abgrenzung der funktionellen Lebensmittel von Nahrungsergänzungsmitteln
- Abgrenzung der funktionellen Lebensmittel von Novel Food
- Diskussion
- Funktionelle Lebensmittel, ihre Inhaltsstoffe und ihre Effekte auf den Gesundheitszustand
- Probiotische funktionelle Lebensmittel
- Inhaltsstoffe
- Effekte der Probiotika
- Einfluss auf das Immunsystem
- Wirkung auf die Blutlipide
- Diskussion
- Prebiotische funktionelle Lebensmittel
- Inhaltsstoffe
- Fructooligosaccharide
- Inulin
- Oligofructose
- Effekte der Prebiotika
- Einfluss auf die Besiedlung der Darmflora
- Einfluss auf die Bioverfügbarkeit von Calcium
- Wirkung auf Blutlipide
- Antikarzinogene Wirkung
- Diskussion
- Inhaltsstoffe
- Funktionelle Lebensmittel mit sekundären Pflanzenstoffen
- Inhaltsstoffe
- Phytosterine
- Effekte der sekundären Pflanzenstoffe
- Einfluss auf den Cholesterinspiegel
- Diskussion
- Probiotische funktionelle Lebensmittel
- Schlussbetrachtung
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht funktionelle Lebensmittel und deren gesundheitliche Effekte. Ziel ist es, die verschiedenen Arten funktioneller Lebensmittel zu definieren, rechtlich einzuordnen und ihre Wirkung auf den menschlichen Körper zu beleuchten. Dabei werden insbesondere probiotische, prebiotische und Lebensmittel mit sekundären Pflanzenstoffen betrachtet.
- Definition und rechtliche Einordnung funktioneller Lebensmittel
- Gesundheitliche Effekte probiotischer Lebensmittel
- Gesundheitliche Effekte prebiotischer Lebensmittel
- Gesundheitliche Effekte von Lebensmitteln mit sekundären Pflanzenstoffen
- Vergleich und Abgrenzung zu herkömmlichen Lebensmitteln, Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der funktionellen Lebensmittel ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie betont die wachsende Bedeutung funktioneller Lebensmittel für die Gesundheit und die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung ihrer Eigenschaften und Wirkungen.
Begriffsbestimmung und Abgrenzung von funktionellen Lebensmitteln: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition funktioneller Lebensmittel und grenzt sie klar von herkömmlichen Lebensmitteln, Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Novel Food ab. Es beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen in verschiedenen Ländern (Deutschland, EU, Japan, USA) und diskutiert die Herausforderungen bei der eindeutigen Klassifizierung dieser Lebensmittel.
Funktionelle Lebensmittel, ihre Inhaltsstoffe und ihre Effekte auf den Gesundheitszustand: Dieser zentrale Teil der Arbeit untersucht detailliert drei Kategorien funktioneller Lebensmittel: probiotische, prebiotische und Lebensmittel mit sekundären Pflanzenstoffen. Für jede Kategorie werden die relevanten Inhaltsstoffe, ihre Wirkungsmechanismen und die nachgewiesenen oder vermuteten positiven Effekte auf den Gesundheitszustand (z.B. Immunsystem, Blutlipide, Darmflora, Cholesterinspiegel) umfassend beschrieben. Die Diskussion der jeweiligen Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und beleuchtet vorhandene Forschungslücken.
Schlüsselwörter
Funktionelle Lebensmittel, Probiotika, Prebiotika, Sekundäre Pflanzenstoffe, Gesundheit, Immunsystem, Blutlipide, Darmflora, Cholesterin, Rechtliche Einordnung, Nahrungsergänzungsmittel, Wirkmechanismen.
Häufig gestellte Fragen zu: Funktionelle Lebensmittel
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über funktionelle Lebensmittel. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine genaue Begriffsbestimmung und Abgrenzung von funktionellen Lebensmitteln inklusive der rechtlichen Einordnung in verschiedenen Ländern (Deutschland, EU, Japan, USA), eine detaillierte Betrachtung probiotischer, prebiotischer und Lebensmittel mit sekundären Pflanzenstoffen sowie deren Auswirkungen auf den menschlichen Körper (Immunsystem, Blutlipide, Cholesterin, Darmflora), eine Schlussbetrachtung, eine Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis. Die Arbeit analysiert die Inhaltsstoffe, Wirkmechanismen und gesundheitlichen Effekte der verschiedenen Kategorien funktioneller Lebensmittel.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, funktionelle Lebensmittel zu definieren, rechtlich einzuordnen und ihre gesundheitlichen Effekte zu untersuchen. Die Schwerpunkte liegen auf der Definition und rechtlichen Einordnung, den gesundheitlichen Effekten probiotischer, prebiotischer und Lebensmittel mit sekundären Pflanzenstoffen sowie dem Vergleich und der Abgrenzung zu herkömmlichen Lebensmitteln, Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln.
Welche Arten von funktionellen Lebensmitteln werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei Hauptkategorien funktioneller Lebensmittel: probiotische Lebensmittel, prebiotische Lebensmittel und Lebensmittel mit sekundären Pflanzenstoffen. Für jede Kategorie werden die relevanten Inhaltsstoffe, Wirkungsmechanismen und gesundheitlichen Effekte detailliert beschrieben.
Wie werden funktionelle Lebensmittel rechtlich eingeordnet?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen für funktionelle Lebensmittel in Deutschland, der EU, Japan und den USA. Sie diskutiert die Herausforderungen bei der eindeutigen Klassifizierung und Abgrenzung von herkömmlichen Lebensmitteln, Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Novel Food.
Welche gesundheitlichen Effekte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Effekte funktioneller Lebensmittel auf das Immunsystem, die Blutlipide, die Darmflora und den Cholesterinspiegel. Es werden sowohl nachgewiesene als auch vermutete positive Effekte beschrieben.
Welche Inhaltsstoffe werden im Detail betrachtet?
Im Detail werden folgende Inhaltsstoffe behandelt: Probiotika, Prebiotika (Fructooligosaccharide, Inulin, Oligofructose), sekundäre Pflanzenstoffe und Phytosterine.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst die Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung und Abgrenzung, Funktionelle Lebensmittel, ihre Inhaltsstoffe und Effekte, Schlussbetrachtung, Zusammenfassung und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel widmet sich einem spezifischen Aspekt der Thematik funktioneller Lebensmittel.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse jedes Kapitels, die die Kernaussagen und Schlussfolgerungen prägnant zusammenfasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Funktionelle Lebensmittel, Probiotika, Prebiotika, Sekundäre Pflanzenstoffe, Gesundheit, Immunsystem, Blutlipide, Darmflora, Cholesterin, Rechtliche Einordnung, Nahrungsergänzungsmittel, Wirkmechanismen.
- Arbeit zitieren
- Nina Kitter (Autor:in), 2004, Funktionelle Lebensmittel und ihre gesundheitlichen Effekte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27271