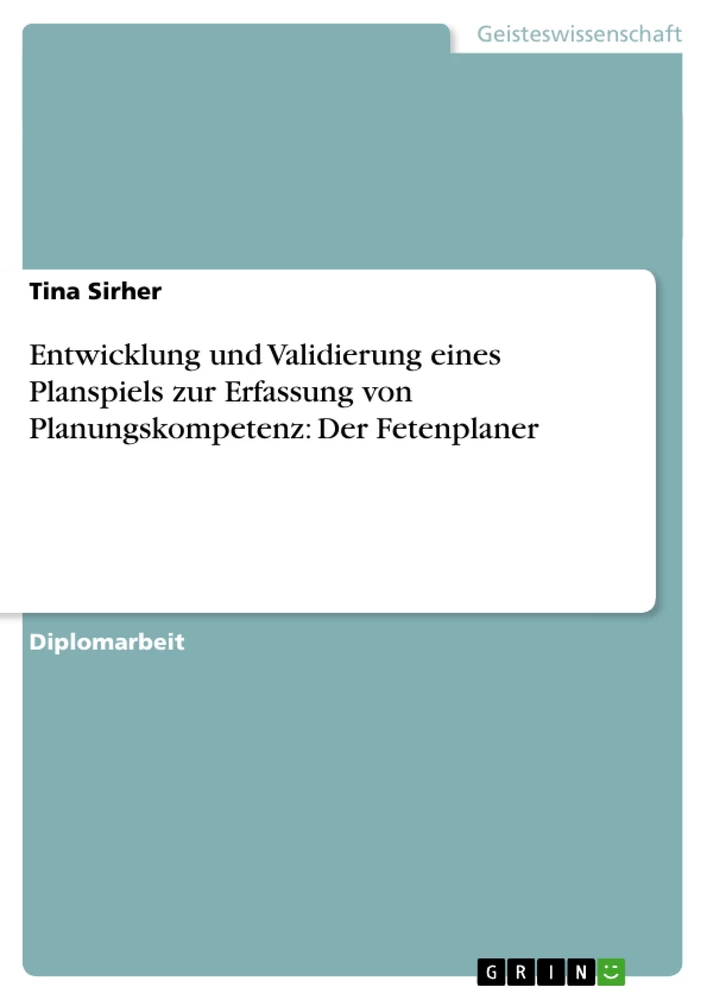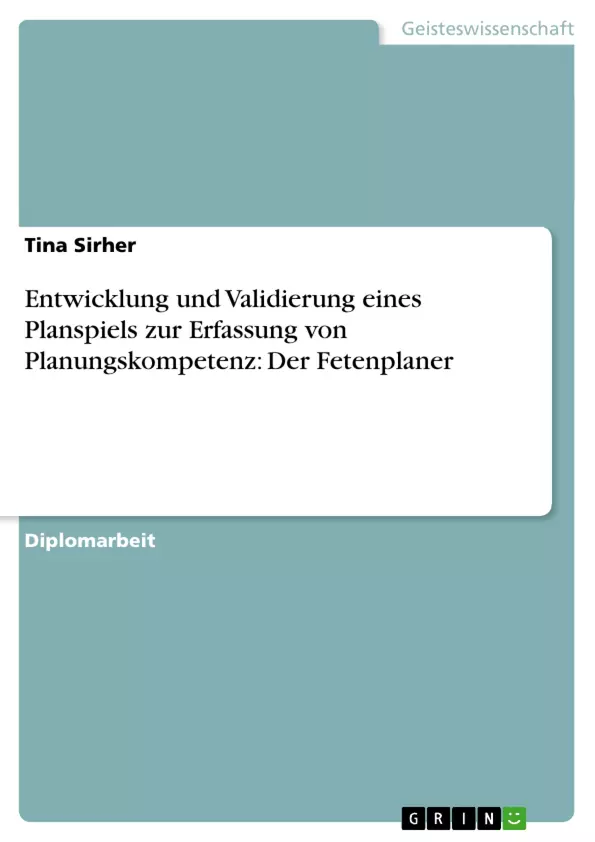„Ohne Pläne wäre menschliches Handeln ziellos.“ (Funke & Fritz, 1995, S. 2). Die Problematik eines angemessenen Auflösungsgrades einer Planung erkennen auch Funke und Glodowski (1990) und definieren „Planen“ als den „Entwurf einer Handlungsabfolge, die auf unterschiedlichen Auflösungsniveaus betrachtet werden kann, unter Beachtung von einschränkenden Randbedingungen und bei einem gegebenen Kenntnisstand“ (Funke & Glodowski, 1990, S. 140). Dörner et al. (1993) betonen ebenfalls den geeigneten Auflösungsgrad einer Planung, ansonsten kann es beim Planen entsprechend zu einer Unterplanung oder einer Überplanung kommen. Bei der Unterplanung wird ohne Zusammenhang agiert bzw. es wird lediglich reagiert. Bei der Überplanung wird bis ins letzte Detail jede Eventualität bedacht. Dadurch verzögert sich das tatsächliche Handeln. Im schlimmsten Fall wird das Planen zum Selbstzweck und eine Umsetzung des Plans somit verhindert. Burschaper (2000) beschreibt Planen als „die Kunst des Weglassens“ (Burschaper, 2000, S.165). Die wahre Kunst besteht dabei natürlich darin, nicht das Falsche wegzulassen. Dörner und Tisdale (1993) bringen die Problematik des Planens auf den Punkt und merken an: „Planen ist ein schwieriges Geschäft“ (Dörner & Tisdale, 1993, S. 219).
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Theorie
- Historischer Hintergrund des Planspiels
- Konstruktion eines Parallelplanspiels
- Merkmale von Planspielen
- Anforderungen an Parallelverfahren
- Die Paralleltestmethode
- Begrifflichkeiten
- Planen
- Problemlösen
- Die Theorie von Funke & Glodowski (1990)
- Ziel der Untersuchung
- Methode
- Die Verfahren
- Der Tour-Planer (To)
- Der Fetenplaner (Fe)
- Der Vergleichsfragebogen (VFB)
- Der Selbsteinschätzungsbogen (SEB)
- Das Validierungsdreieck
- Die Hypothesen
- Parallelitätshypothesen
- Reihenfolgehypothesen
- Planungskompetenzhypothesen
- Die Untersuchung
- Die Stichprobe
- Die Durchführung
- Die Auswertung
- Die Verfahren
- Ergebnisse
- Verteilungsanalysen
- Verteilung des Gesamtscores im Fetenplaner
- Verteilung des Gesamtscores im Tour-Planer
- Verteilung der Gesamtscores im Selbsteinschätzungsbogen
- Itemanalysen
- Itemanalyse des Fetenplaners
- Itemanalyse des Tour-Planers
- Itemanalyse des Selbsteinschätzungsbogens
- Überprüfung der Hypothesen
- Überprüfung der Parallelitätshypothesen
- Überprüfung der Reihenfolgehypothesen
- Überprüfung der Planungskompetenzhypothesen
- Häufigkeitsverteilungen des Vergleichsfragebogens
- Faktorenanalyse des Selbsteinschätzungsbogens
- Verteilungsanalysen
- Diskussion
- Die Parallelität des Fetenplaners zum Tour-Planer
- Reihenfolgeeffekte bei der Bearbeitung beider Planspiele
- Die Kriteriumsvalidierung und der Selbsteinschätzungsbogen
- Bewertung der beiden Planspiele Fetenplaner und Tour-Planer
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und Validierung eines Planspiels zur Erfassung von Planungskompetenz. Das Planspiel „Fetenplaner“ wurde konzipiert, um die Fähigkeit zur Planung von komplexen Aufgaben und Prozessen zu messen. Ziel ist es, ein valides und reliables Instrument zur Erfassung von Planungskompetenz bereitzustellen, das sowohl in Forschung als auch in Praxis eingesetzt werden kann.
- Entwicklung und Validierung eines neuen Planspiels zur Erfassung von Planungskompetenz
- Analyse der Parallelität des Fetenplaners zum etablierten Planspiel „Tour-Planer“
- Untersuchung von Reihenfolgeeffekten bei der Bearbeitung der beiden Planspiele
- Kriteriumsvalidierung des Fetenplaners mithilfe eines Selbsteinschätzungsbogens
- Bewertung der beiden Planspiele Fetenplaner und Tour-Planer hinsichtlich ihrer Eignung zur Messung von Planungskompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung erläutert die Relevanz der Planungskompetenz in verschiedenen Lebensbereichen und stellt die Forschungsfrage nach einem validen Instrument zur Erfassung dieser Kompetenz dar.
- Theorie: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund der Forschung. Es werden die Geschichte des Planspiels, seine Merkmale und die Anforderungen an Parallelverfahren erläutert. Außerdem werden wichtige Begrifflichkeiten wie Planen und Problemlösen definiert und die Theorie von Funke & Glodowski (1990) zur Planungskompetenz vorgestellt.
- Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methode der Untersuchung. Es werden die verwendeten Verfahren vorgestellt, wie der Tour-Planer, der Fetenplaner, der Vergleichsfragebogen und der Selbsteinschätzungsbogen. Außerdem werden das Validierungsdreieck und die Hypothesen der Untersuchung dargelegt.
- Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden Verteilungsanalysen, Itemanalysen, die Überprüfung der Hypothesen, Häufigkeitsverteilungen des Vergleichsfragebogens und die Faktorenanalyse des Selbsteinschätzungsbogens dargestellt.
- Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Untersuchung im Kontext der Literatur und der Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Planungskompetenz, Planspiel, Fetenplaner, Tour-Planer, Paralleltestmethode, Validierung, Reliabilität, Selbsteinschätzung, Forschung, Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der "Fetenplaner"?
Der Fetenplaner ist ein neu entwickeltes Planspiel, das dazu dient, die Planungskompetenz von Personen in komplexen Situationen zu messen.
Wie wird Planungskompetenz in diesem Kontext definiert?
Planen wird als Entwurf einer Handlungsabfolge unter Beachtung von Randbedingungen definiert, wobei der richtige Auflösungsgrad (weder Unter- noch Überplanung) entscheidend ist.
Was ist der "Tour-Planer"?
Der Tour-Planer ist ein bereits etabliertes Planspiel, das in der Studie als Vergleichsinstrument zur Validierung des Fetenplaners genutzt wurde.
Was versteht man unter Unterplanung und Überplanung?
Unterplanung führt zu bloßem Reagieren ohne Zusammenhang; Überplanung verzögert das Handeln, da jedes Detail bedacht wird, was das Planen zum Selbstzweck macht.
Wie wurde das Planspiel validiert?
Die Validierung erfolgte über die Paralleltestmethode (Vergleich mit dem Tour-Planer) sowie mithilfe von Selbsteinschätzungsbögen der Teilnehmer.
- Quote paper
- Dipl. Sportpsychologin Tina Sirher (Author), 2003, Entwicklung und Validierung eines Planspiels zur Erfassung von Planungskompetenz: Der Fetenplaner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27284