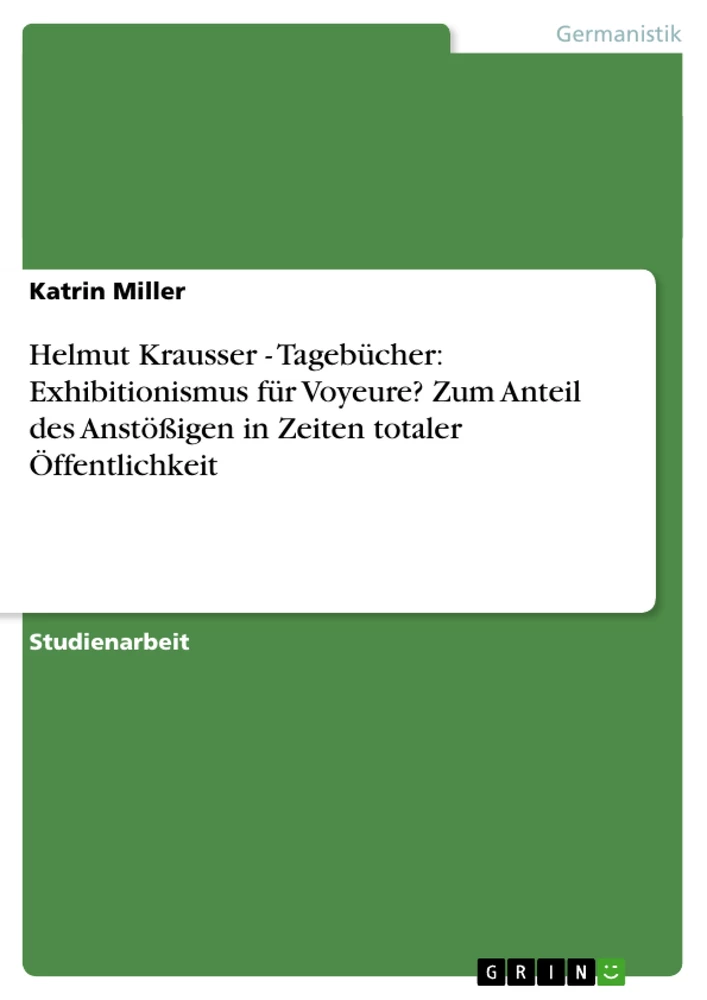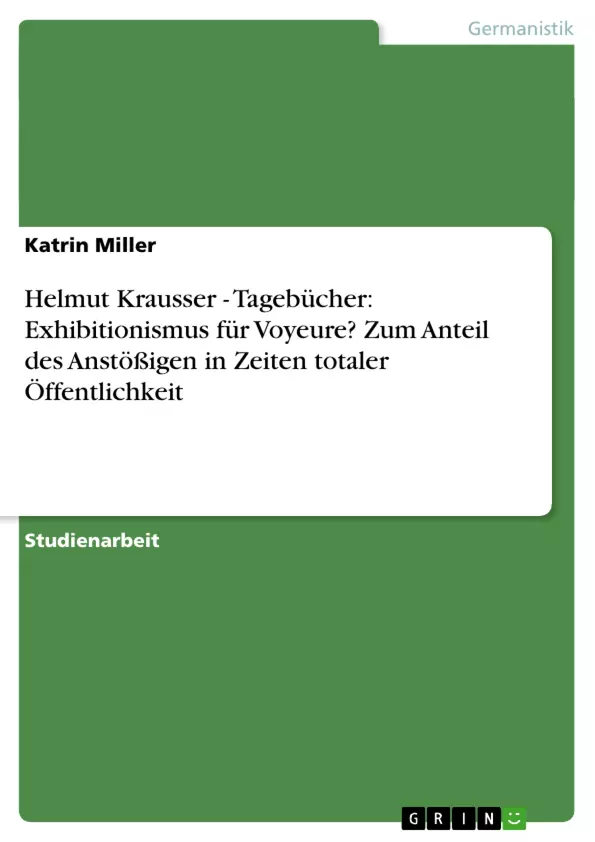m Mai 1992 beginnt Helmut Krausser jeweils einen Monat pro Jahr Tagebuch zu führen. „Anlaß der Niederschrift war, wie man hört, eine momentane Eingebung, die Lust so etwas zu versuchen.“ Dieses „Experiment“ beabsichtigt er bis 2003 weiterzuführen. Jährlich soll ein neuer Tagebuchband erscheinen, der an den Monat des vorhergehenden Bandes unmittelbar angrenzt, bis die Reihe schließlich alle zwölf Monate umfaßt und insgesamt eine zwölfjährige Periode gleichsam zu einem „Kunstjahr“ amalgamiert ist.
Tagebuchschreiben – für viele eine Notwendigkeit, eine Art Ventil ihrer Impulsivität, das Beruhigung herbeiführt, oder ein „grausamer Partner“, den man nicht belügen kann, da man letztendlich nur sich selbst gegenüber untreu werden würde. Tagebücher haben viele Rollen: sie sind zumeist eine Art Selbstgespräch und dienen ihren Schreibern zur Auseinandersetzungen mit sich selbst und mit anderen, zur Gewissenserforschung und zur Reflexion, können also Orte der Bekenntnis, Spiegel der eigenen Seele oder der Welt sein. Nicht selten besitzen Tagebücher die Funktion eines Erlebnisreservoirs oder werden zum Übungsfeld schriftstellerischer Versuche. „Im Ansehen des breiten Publikums, aber auch bei einigen seiner Interpreten, gilt das Tagebuch als eine ausgesprochen intime Form literarischer Gestaltung. Vielfach wird der Wert eines einzelnen Tagebuchs sogar ausdrücklich nach seinem mehr oder weniger ‚privaten‘ Charakter beurteilt.“
Kraussers Tagebücher überschreiten die Grenze vom Privaten zum Öffentlichen, denn sie sind von vornherein auf ihre Veröffentlichung hin konzipiert. Schreiben wird zur beabsichtigten literarischen Produktion und tritt in Kontrast zum eher spontan-beiläufigen, zufälligen und v.a. auch intimen Charakter eines privaten Tagebuchs.
Krausser schreibt somit im Hinblick auf eine implizite, möglicherweise auch bewußt intendierte Leserschaft. Indem er Gefühle, Einstellungen und Privates preisgibt, betreibt er eine Form von Exhibitionismus und setzt sich dadurch freiwillig der Kritik aus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorbemerkung
- 2. Exhibitionismus und der Anteil des Anstößigen in Kraussers Tagebüchern
- 2.1 Privatleben
- 2.1.1 Alltagsexhibitionismus
- 2.1.2 Beziehung zu Beatrice
- 2.2 Erotik und Sexualität
- 2.2.1 Voyeuristisch-distanzierte Beobachtungshaltungen
- 2.2.2 Sexuelle Darstellungen/Aussagen
- 2.3 Freunde
- 2.3.1 Verallgemeinerte Aussagen
- 2.3.2 Aussagen über Einzelpersonen
- 2.3.3 „Spezialfreund“ Dirk
- 2.4 Personen des öffentlichen Lebens
- 2.4.1 Schauspieler, Regisseure, Schriftsteller etc.
- 2.4.2 Feuilleton
- 2.5 Gesellschaftskritische Darstellungen
- 2.5.1 Amerikanisierung und Kulturverfall
- 2.5.2 Antisemitismus und Holocaust
- 3. Zum Anteil des Anstößigen in Zeiten totaler Öffentlichkeit
- 4. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Helmut Kraussers Tagebücher auf den Aspekt des Exhibitionismus und die Frage, inwieweit dieser in Zeiten scheinbar totaler Öffentlichkeit noch als anstößig empfunden werden kann. Es wird analysiert, wie Krausser sein Privatleben, seine Beziehungen und seine gesellschaftlichen Beobachtungen in seinen Tagebüchern darstellt und welche Grenzen er dabei bewusst überschreitet oder auch nicht.
- Exhibitionismus in Kraussers Tagebüchern
- Die Definition von "Anstößigkeit" im Kontext der Tagebücher
- Das Verhältnis von Privatem und Öffentlichem in Kraussers Werk
- Die Rolle der Leserschaft und voyeuristische Aspekte
- Gesellschaftliche Kritik und Provokation in den Tagebüchern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorbemerkung: Diese Einleitung stellt Helmut Kraussers Tagebuchprojekt vor, das aus der Idee entstand, jeden Monat eines Jahres zu dokumentieren, mit dem Ziel, bis 2003 zwölf Bände zu veröffentlichen. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Funktionen von Tagebüchern – von Selbstreflexion bis zu literarischen Experimenten – und hebt den Unterschied zwischen privaten und veröffentlichungsorientierten Tagebüchern hervor. Krausser selbst reflektiert seine bewusste Gestaltung und die damit einhergehende Selbstzensur, um strafrechtliche oder ästhetische Grenzen zu wahren. Der fokus liegt dabei auf der bewussten Auswahl des Inhalts und der Frage, inwieweit Krausser an der Grenze des Provokanten schreibt.
2. Exhibitionismus und der Anteil des Anstößigen in Kraussers Tagebüchern: Dieses Kapitel analysiert den Exhibitionismus in Kraussers Tagebüchern, indem es zwischen Seelenexhibitionismus (Selbstoffenbarung) und der Exhibition anderer Personen unterscheidet. Es behandelt Kraussers provokante Aussagen und die Frage, inwieweit diese als anstößig gewertet werden können. Kraussers eigene Ansicht zur „Anstößigkeit“ wird zitiert, um seine Absicht zu verdeutlichen, nicht auf Harmonie zu achten und kühn und provokativ zu schreiben. Das Kapitel dient als Grundlage für die spätere Analyse der einzelnen Bereiche des Privatlebens, der Beziehungen und der gesellschaftlichen Beobachtungen.
2.1 Privatleben: Dieser Abschnitt befasst sich mit Kraussers Alltagsexhibitionismus. Es wird detailliert gezeigt, wie Krausser minutiös sein tägliches Leben, von alltäglichen Handlungen bis zu persönlichen Gedanken und Träumen, festhält und somit einen umfassenden Einblick in seine Persönlichkeit gewährt. Beispiele wie die Beschreibung seiner Wohnungseinrichtung, seiner Leidenschaft für Musik, seine Urlaubserfahrungen oder seines komplexen Verhältnisses zu seinen Eltern veranschaulichen Kraussers Offenheit und das Ausmaß seines Selbst- und Alltags-Exhibitionismus. Der Fokus liegt auf dem umfangreichen und detaillierten Bild, das Krausser von sich selbst zeichnet.
Schlüsselwörter
Helmut Krausser, Tagebuch, Exhibitionismus, Voyeurismus, Anstößigkeit, Öffentlichkeit, Privatleben, Selbstreflexion, Gesellschaftkritik, Provokation, Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu Helmut Kraussers Tagebüchern
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Tagebücher von Helmut Krausser im Hinblick auf den Aspekt des Exhibitionismus und die Frage, ob und inwieweit dieser in einer Zeit scheinbar totaler Öffentlichkeit noch als anstößig empfunden werden kann. Es wird untersucht, wie Krausser sein Privatleben, seine Beziehungen und seine gesellschaftlichen Beobachtungen darstellt und welche Grenzen er dabei überschreitet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind: Exhibitionismus in Kraussers Tagebüchern, die Definition von "Anstößigkeit" im Kontext der Tagebücher, das Verhältnis von Privatem und Öffentlichem in Kraussers Werk, die Rolle der Leserschaft und voyeuristische Aspekte sowie gesellschaftliche Kritik und Provokation in den Tagebüchern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Vorbemerkung, ein Hauptkapitel zum Exhibitionismus und dem Anstößigen in den Tagebüchern (unterteilt in Unterkapitel zu Privatleben, Erotik und Sexualität, Freunden, Personen des öffentlichen Lebens und gesellschaftskritischen Darstellungen), ein Kapitel zum Anteil des Anstößigen in Zeiten totaler Öffentlichkeit und eine Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Was wird im Kapitel „Exhibitionismus und der Anteil des Anstößigen“ untersucht?
Dieses Kapitel analysiert den Exhibitionismus in Kraussers Tagebüchern, differenziert zwischen Seelenexhibitionismus und der Exhibition anderer Personen und untersucht Kraussers provokante Aussagen und deren mögliche Bewertung als anstößig. Es bezieht Kraussers eigene Sicht auf „Anstößigkeit“ mit ein und dient als Grundlage für die Analyse einzelner Bereiche (Privatleben, Beziehungen, gesellschaftliche Beobachtungen).
Wie wird das Privatleben Kraussers dargestellt?
Der Abschnitt zum Privatleben beschreibt Kraussers Alltagsexhibitionismus, seine detaillierten Aufzeichnungen seines täglichen Lebens, von alltäglichen Handlungen bis zu persönlichen Gedanken und Träumen. Beispiele wie die Beschreibung seiner Wohnung, seiner Leidenschaften und seines Verhältnisses zu seinen Eltern veranschaulichen seine Offenheit und das Ausmaß seines Selbst- und Alltags-Exhibitionismus.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Helmut Krausser, Tagebuch, Exhibitionismus, Voyeurismus, Anstößigkeit, Öffentlichkeit, Privatleben, Selbstreflexion, Gesellschaftskritik, Provokation und Literatur.
Was ist das Ziel der Vorbemerkung?
Die Vorbemerkung stellt Helmut Kraussers Tagebuchprojekt vor, beleuchtet die unterschiedlichen Funktionen von Tagebüchern und hebt den Unterschied zwischen privaten und veröffentlichungsorientierten Tagebüchern hervor. Sie fokussiert auf Kraussers bewusste Gestaltung und Selbstzensur, sowie seine bewusste Auswahl des Inhalts und die Frage, inwieweit er an der Grenze des Provokanten schreibt.
Welche Rolle spielt die "Anstößigkeit" in der Analyse?
Die "Anstößigkeit" ist ein zentrales Thema. Die Arbeit untersucht, wie Krausser die Grenzen des Anstößigen in seinen Tagebüchern auslotet und welche Bedeutung dies im Kontext seiner Zeit und der "totalen Öffentlichkeit" hat. Es wird analysiert, wie die Leserschaft auf die gegebenen Informationen reagiert und inwieweit voyeuristische Aspekte eine Rolle spielen.
- Quote paper
- Katrin Miller (Author), 2000, Helmut Krausser - Tagebücher: Exhibitionismus für Voyeure? Zum Anteil des Anstößigen in Zeiten totaler Öffentlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27300