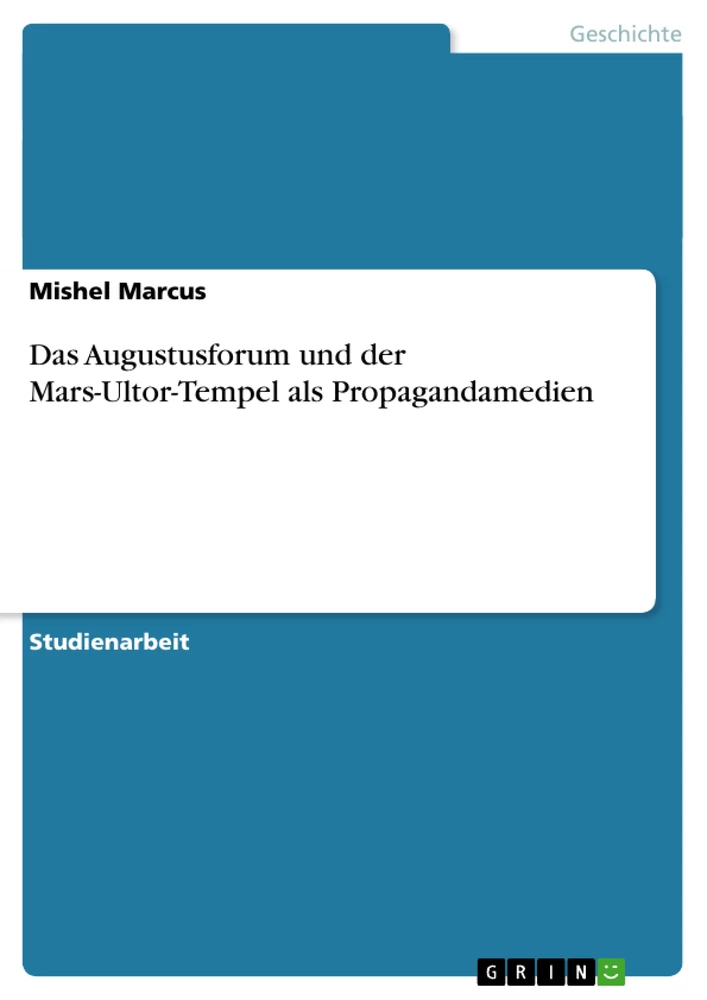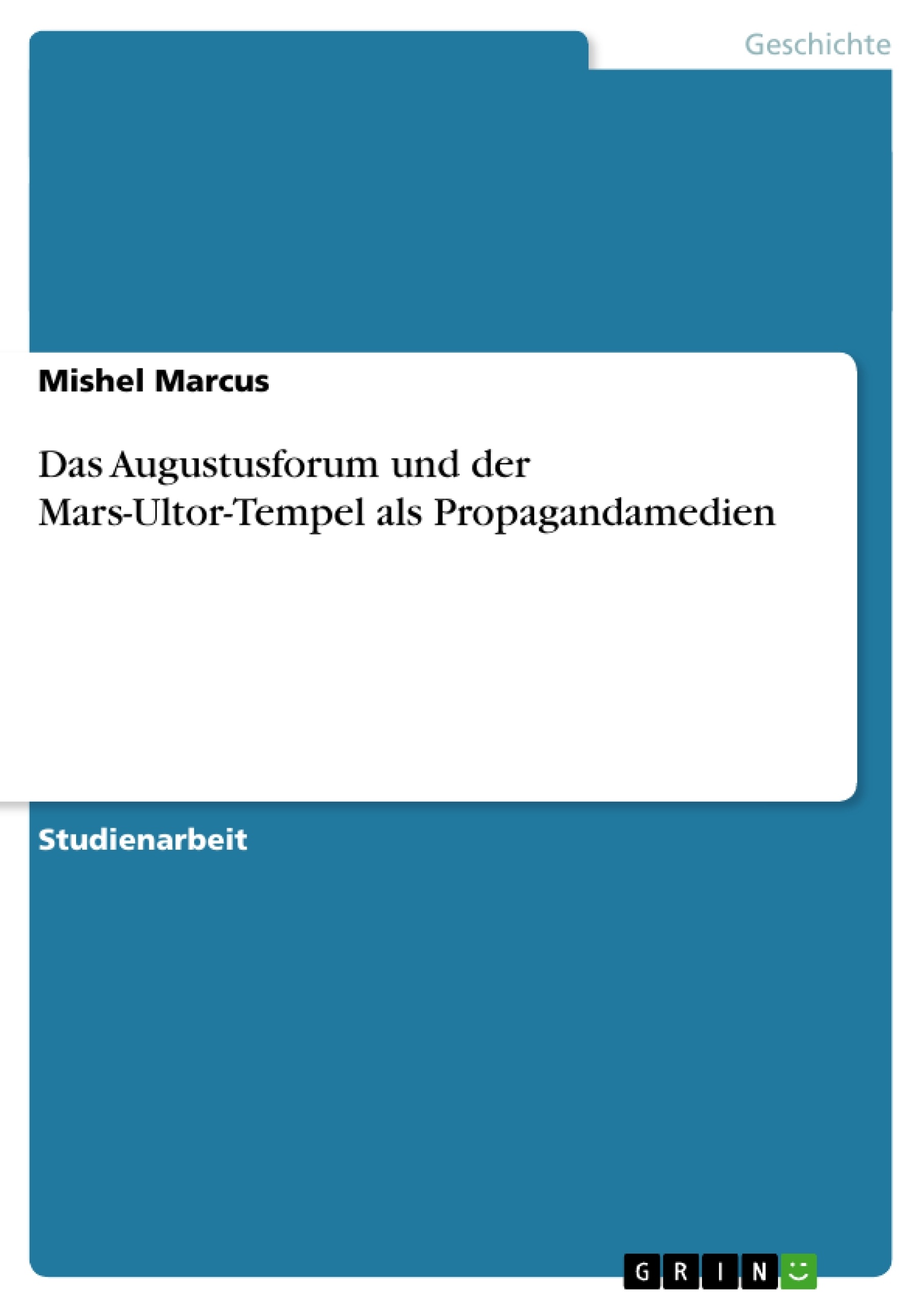Aus den Wirren des römischen Bürgerkriegs und dem Untergang der Römischen Republik sticht eine Person besonders hervor, die Roms Geschichte maßgeblich geprägt hat: Augustus, der als erster römischer Kaiser tituliert wird. Bereits im jugendlichen Alter von 19 Jahren trat er 44. v. Chr. das politische Erbe seines ermordeten Adoptivvaters Cäsar an. Trotz des Fehlens von politischer Erfahrung schaffte er es letztlich eine neue Herrschaftsform zu etablieren, den Prinzipat. Augustus nutzte dabei die rechtlichen Lücken im System, um die höchsten Machtpositionen im Imperium an seine Person zu binden. Auf seinem Weg dorthin, schaltete er jeden Konkurrenten aus und schuf sich eine Machtbasis, die für das Erreichen seiner Ziele unabdingbar war. Doch auch Augustus musste sich, nachdem er seine Ziele erreicht hatte, mit der Frage auseinandersetzen, wie er seine Macht legitimieren konnte, da schon sein Adoptivvater Caesar den Versuch der Errichtung einer Diktatur mit seinem Leben bezahlt hatte. Augustus konnte dieses Schicksal geschickt umgehen, indem er seine Macht insbesondere durch den Kaiserkult und die Religion legitimieren konnte, welche er in seinem Tatenbericht, den Res Gestae darlegte. Augustus erwähnte in seinen Res Gestae viele seiner Bauwerke, von denen einige ihm zu Ehren von dem Senat gestiftet wurden, wie zum Beispiel das Augustusforum. Dieses enthält viele Aspekte der symbolisierten Herrschaftslegitimation und ist gewissermaßen ein repräsentatives Familienbilderbuch des Prinzeps. Es schaffte eine direkte Verbindung mit der römischen Geschichte und den Mythen um seine Familie. Augustus griff dabei intensiv auf bestehendes Wissen der Römer bezüglich der römischen Geschichte zurück.
Diese Seminararbeit wird sich im Kern mit den Medien beschäftigen, die Augustus nutzte, um seine Macht dem einfachen Volk vor Augen zu führen. Augustus benutzte dabei das Augustusforum und den Mars-Ultor-Tempel als die zwei wichtigsten Medien, um seine bereits errichtete Herrschaft zu legitimieren und die einfache Bevölkerung mit diesen beiden anzusprechen. Diese werden dementsprechend analysiert und ihre Bedeutung herausgearbeitet. Im Schlussteil wird das Ergebnis der Hausarbeit in einem Fazit zusammengefasst.
1. Einleitung
Aus den Wirren des römischen Bürgerkriegs und dem Untergang der Römischen Republik sticht eine Person besonders hervor, die Roms Geschichte maßgeblich geprägt hat: Augustus, der als erster römischer Kaiser tituliert wird. Bereits im jugendlichen Alter von 19 Jahren trat er 44. v. Chr. das politische Erbe seines ermordeten Adoptivvaters Cäsar an. Trotz des Fehlens von politischer Erfahrung schaffte er es letztlich eine neue Herrschaftsform zu etablieren, den Prinzipat. Augustus nutzte dabei die rechtlichen Lücken im System, um die höchsten Machtpositionen im Imperium an seine Person zu binden. Auf seinem Weg dorthin, schaltete er jeden Konkurrenten aus und schuf sich eine Machtbasis, die für das Erreichen seiner Ziele unabdingbar war. Doch auch Augustus musste sich, nachdem er seine Ziele erreicht hatte, mit der Frage auseinandersetzen, wie er seine Macht legitimieren konnte, da schon sein Adoptivvater Caesar den Versuch der Errichtung einer Diktatur mit seinem Leben bezahlt hatte. Augustus konnte dieses Schicksal geschickt umgehen, indem er seine Macht insbesondere durch den Kaiserkult und die Religion legitimieren konnte, welche er in seinem Tatenbericht, den Res Gestae darlegte. Augustus erwähnte in seinen Res Gestae viele seiner Bauwerke, von denen einige ihm zu Ehren von dem Senat gestiftet wurden, wie zum Beispiel das Augustusforum. Dieses enthält viele Aspekte der symbolisierten Herrschaftslegitimation und ist gewissermaßen ein repräsentatives Familienbilderbuch des Prinzeps. Es schaffte eine direkte Verbindung mit der römischen Geschichte und den Mythen um seine Familie. Augustus griff dabei intensiv auf bestehendes Wissen der Römer bezüglich der römischen Geschichte zurück.
Diese Seminararbeit wird sich im Kern mit den Medien beschäftigen, die Augustus nutzte, um seine Macht dem einfachen Volk vor Augen zu führen. Augustus benutzte dabei das Augustusforum und den Mars-Ultor-Tempel als die zwei wichtigsten Medien, um seine bereits errichtete Herrschaft zu legitimieren und die einfache Bevölkerung mit diesen beiden anzusprechen. Diese werden dementsprechend analysiert und ihre Bedeutung herausgearbeitet. Im Schlussteil wird das Ergebnis der Hausarbeit in einem Fazit zusammengefasst.
2. Das Medium
2.1 Definition
Was ist ein Medium? Was macht ein Medium aus? Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet Medium „Mittel“ oder „Vermittelndes“.[1] Medien sind demnach Kommunikationsmittel, die eine bestimmte Information von einem Sender zu einem Empfänger übertragen. Der Begriff Medium an sich ist jedoch ziemlich weit gefasst, weshalb eine eindeutige Definition nicht möglich ist. Jedoch können wir mit dem Hintergrundwissen, das wir uns im Seminar „Antike Medien“ angeeignet haben und in Anlehnung an Werner Faulstichs Ausführungen „[…] Medien als komplexe institutionalisierte Systeme um organisierte Kommunikationskanäle von spezifischen Leistungsvermögen und mit gesellschaftlicher Dominanz“ verstehen.[2] In der Definition sind die auf auffälligsten Aspekten die Wörter „institutionalisiert“ und „spezifisches Leistungsvermögen“. Das Adjektiv „institutionalisiert“ bezieht sich hierbei auf die Tatsache, ob ein Medium als solches wahrgenommen wird. „Spezifisches Leistungsvermögen“ hingegen sagt aus, ob ein Medium für einen bestimmten Zweck gebrauchsfähig ist. Medien sind demnach Träger von Botschaften, die durch die Übermittlung der Botschaft verschiedene Zwecke verfolgen.
2.2 Funktion
In der Antike erfüllten die Medien vielseitige Funktionen und wurden für verschiedene Zwecke eingesetzt. Zum einen sollten sie Herrschaft legitimieren, wobei hier auch durch den Einsatz der Medien gezielt Manipulation stattfinden konnte, um so zum Beispiel ein bestimmtes Bild zu vermitteln. Zudem sollten Medien informieren aber auch Befehle vermitteln. Zu guter Letzt waren Medien auch identifikationsstiftend und dadurch auch Abgrenzungsmerkmale. Hinzufügen muss man, dass Medien in der Antike auch Gebäude, Plätze, Statuen, Münzen oder Gesten sein konnten. Für einen heutigen Menschen ist zum Beispiel eine Münze lediglich ein Zahlungsmittel und wird auch nur als solches wahrgenommen. Für einen antiken Bürger jedoch war sofort ersichtlich, dass die Münze eine bestimmte Botschaft transportierte durch die Aspekte, die auf dieser abgebildet waren. So verhielt es sich auch mit berühmten Statuen oder Plätzen im Reich, die allesamt ein bestimmtes Bild transportieren sollten.[3] Tempel oder Heiligtümer als Medium hingegen galten als die wichtigsten Stätten sozialer Kommunikation, die somit eine multifunktionale Funktion einnahmen. So dienten sie in erster Linie nicht nur für die reine Ausübung des Kultes, sondern waren darüber hinaus auch Treffpunkte für die Öffentlichkeit, welche diese Plätze oft frequentierte. Für eine wichtige Persönlichkeit war es deshalb unerlässlich, solch einen wichtigen Ort zu stiften, da durch die Anbringung ihres Namens an den Bauwerken, ihr Ruhm gesichert wurde und sie dadurch stets in der Öffentlichkeit präsent war. Zudem sei noch zu erwähnen, dass die heiligen Stätte auch zur direkten Kommunikation zwischen der Obrigkeit und dem einfachen Volk dienten, so zum Beispiel bei der Bekanntmachung wichtiger Verlautbarungen, beziehungsweise als Form öffentlicher Inschriften. Somit liegt es nahe, dass die führende Schicht in der Antike bedacht war, viele öffentliche Plätze und Heiligtümer zu stiften, um ihre Präsenz in der Öffentlichkeit zu wahren und ihre Macht dadurch zu legitimieren.[4]
[...]
[1] Werner Faulstich: Grundwissen Medien, 5. Auflage, Paderborn 2004, S. 13. (im Folgenden zitiert als: Faulstich: Medien)
[2] Faulstich: Medien, S. 13ff.
[3] Faulstich: Medien, S. 24ff.
[4] Patrick Schollmeyer: Römische Tempel. Kult und Architektur im Imperium Romanum, Darmstadt 2008, S. 20f. (im Folgenden zitiert als: Schollmeyer: Römische Tempel)
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzte Augustus Architektur als Propagandamedium?
Augustus ließ Bauwerke wie das Augustusforum und den Mars-Ultor-Tempel errichten, um seine Herrschaft zu legitimieren, seine göttliche Abstammung zu betonen und seinen Ruhm dauerhaft im Stadtbild zu verankern.
Was war die Funktion des Augustusforums?
Es diente als repräsentativer Ort für öffentliche Angelegenheiten und als 'Familienbilderbuch', das die Verbindung der julischen Familie mit den Gründungsmythen Roms und großen Helden der Geschichte visualisierte.
Warum war der Mars-Ultor-Tempel so bedeutend?
Der Tempel war Mars dem Rächer gewidmet. Er symbolisierte die Rache an den Mördern Caesars und die Wiedererlangung der römischen Feldzeichen von den Parthern, was Augustus' militärische Stärke unterstrich.
Was sind 'Res Gestae' im Kontext des Augustus?
Die Res Gestae Divi Augusti sind sein Tatenbericht, in dem er seine Leistungen und Bauwerke auflistet, um sein Bild für die Nachwelt und die Legitimität des Prinzipats zu sichern.
Wie wird ein Medium in der Antike definiert?
In der Antike waren Medien nicht nur Schriften, sondern auch Gebäude, Statuen, Münzen und Plätze, die als institutionalisierte Kommunikationskanäle Botschaften an die Bevölkerung transportierten.
- Quote paper
- Mishel Marcus (Author), 2014, Das Augustusforum und der Mars-Ultor-Tempel als Propagandamedien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273001