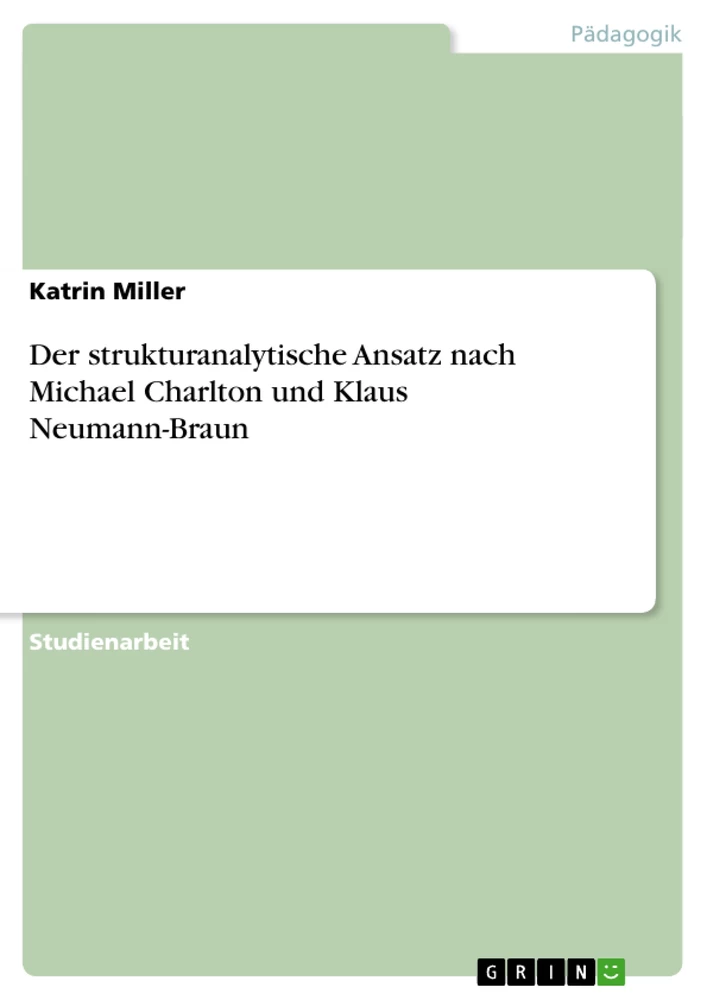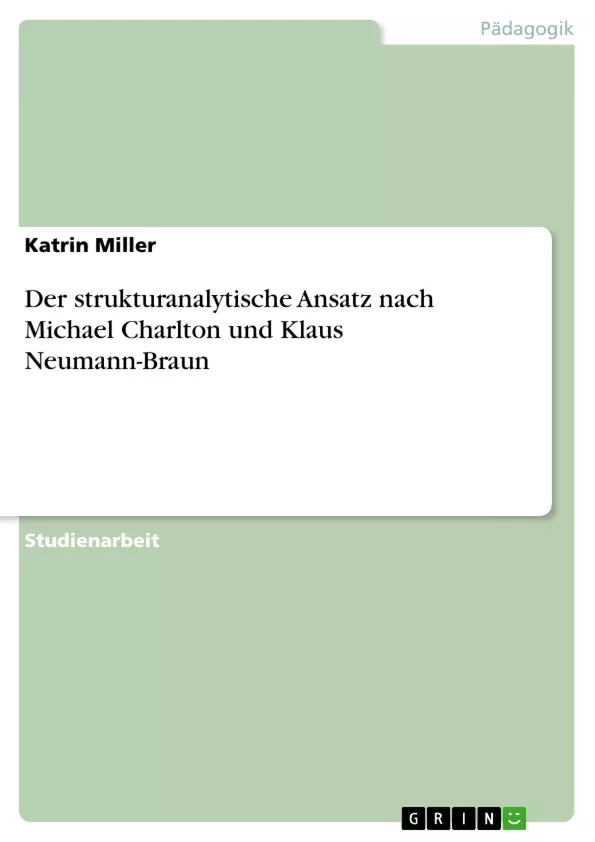Ausgiebig gingen die Meinungen darüber auseinander, wie aktiv bzw. passiv die Rolle des Medienkonsumenten - und somit des Rezipienten - zu sehen ist. Die traditionelle Rezeptionsforschung ging lange Zeit von einem sehr einfachen Stimulus-Response – Denken aus und ließ den Rezipienten damit eine eher passive Rolle zukommen, da sie „[...]als (mehr oder weniger) reizkontrollierte, in ihren Verhaltensweisen umweltdeterminierte und reaktive Menschen betrachtet [...]“ wurden. Nicht zu Unrecht wurde von Kritikern der sehr einseitige und linear vom Sender zum Empfänger verlaufende Massenkommunikationsprozeß und die zu sehr isolierte Rolle des Rezipienten angefochten!
Erst durch eine Wende in der Sozialforschung, die sich von der klassischen Wirkungsforschung abhob, wurde der Rezipient als aktives Handlungssubjekt aufgefaßt, das selbstverantwortlich über sich und sein Leben in der Gesellschaft bestimmt und sein Handeln - und darin eingeschlossen: sein Medienhandeln zielgerichtet bestimmt. Aus dieser Perspektive werden Medieninhalte nicht mehr als Ursache angesehen, die im Konsumenten / Rezipienten Veränderungen nach regelhaften Schemata bewirken. Vielmehr wird der Mediennutzer nun als selbstverantwortliche Person aufgefaßt, die in bestimmtem Rahmen selbst entscheidet, welche Medieninformation sie gebrauchen will.
Inhaltsverzeichnis
- Neuakzentuierung im forschungsmethodologischen Bereich
- Der strukturanalytische Ansatz von Michael Charlton und Klaus Neumann-Braun
- Die 3 Ebenen der Handlungskonstruktion bzw. -koordination
- Situativer und kultureller Kontext
- kulturelles Sinnsystem
- Sozialer Kontext
- Das Subjekt
- Phasen des eigentlichen Rezeptionsprozeß
- Handlungsleitendes Thema
- Medienrezeptionshandlung
- Aufgaben der Lebensbewältigung und Identitätswahrung
- Methodologie und Verfahren
- Einzelfalldarstellungen
- Die Falldarstellung "Moritz"
- Die Falldarstellung "Esther"
- Die Falldarstellung "Paul"
- Die Falldarstellung "Wolfram"
- Kritische Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit fokussiert auf den strukturanalytischen Ansatz der Medienrezeption nach Michael Charlton und Klaus Neumann-Braun. Ziel ist es, diesen Ansatz näher zu beleuchten und seinen Zusammenhang mit kindlicher Identitätsentwicklung im familiären Kontext aufzuzeigen. Dazu wird das „Struktur- und Prozeßmodell“ der Medienrezeption vorgestellt und mithilfe von Fallbeispielen die methodologische Vorgehensweise illustriert.
- Aktive Rolle des Rezipienten in der Medienrezeption
- Struktur- und Prozeßmodell der Medienrezeption nach Charlton und Neumann-Braun
- Einfluss von Medien auf die kindliche Identitätsentwicklung im familiären Kontext
- Methodologische Vorgehensweise des strukturanalytischen Ansatzes
- Zusammenhang von Mediengebrauch und Lebensbewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Neuakzentuierung im forschungsmethodologischen Bereich der Medienrezeption. Es wird die Entwicklung vom passiven zum aktiven Rezipienten und die daraus resultierende Forderung nach einer stärker lebensweltorientierten Medienpädagogik beleuchtet.
Im zweiten Kapitel wird der strukturanalytische Ansatz von Michael Charlton und Klaus Neumann-Braun detailliert vorgestellt. Dabei werden die drei Ebenen der Handlungskonstruktion (situativer und kultureller Kontext, Phasen des eigentlichen Rezeptionsprozesses und Aufgaben der Lebensbewältigung und Identitätswahrung) sowie die methodologische Vorgehensweise des Ansatzes im Detail analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert wichtige Konzepte wie Medienrezeption, Strukturanalyse, Identitätsentwicklung, Kindesentwicklung, Familie, Sozialisation, Medienkonsum, Medienpädagogik, Lebensweltorientierung, Rezeptionsprozesse, Struktur- und Prozeßmodell, Fallbeispiele, Methodologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der strukturanalytische Ansatz in der Medienforschung?
Dieser Ansatz von Charlton und Neumann-Braun betrachtet den Mediennutzer als aktives Subjekt, das Medieninhalte zur Lebensbewältigung und Identitätswahrung nutzt.
Wie unterscheidet sich dieser Ansatz von der klassischen Wirkungsforschung?
Während die klassische Forschung Rezipienten als passive, reizgesteuerte Wesen sah, betont die Strukturanalytik die Selbstverantwortung und Zielgerichtetheit des Medienhandelns.
Welche drei Ebenen der Handlungskonstruktion werden genannt?
Die Ebenen sind: 1. Situativer/kultureller Kontext, 2. Phasen des Rezeptionsprozesses und 3. Aufgaben der Lebensbewältigung/Identitätswahrung.
Was ist ein „handlungsleitendes Thema“?
Es ist ein zentrales Motiv oder Problem des Rezipienten, das bestimmt, welche Medieninhalte er auswählt und wie er diese interpretiert.
Wie wird der Ansatz methodisch umgesetzt?
Die Arbeit illustriert die Vorgehensweise anhand von Einzelfalldarstellungen (z.B. die Fälle „Moritz“, „Esther“, „Paul“ und „Wolfram“).
- Quote paper
- Katrin Miller (Author), 2000, Der strukturanalytische Ansatz nach Michael Charlton und Klaus Neumann-Braun, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27301