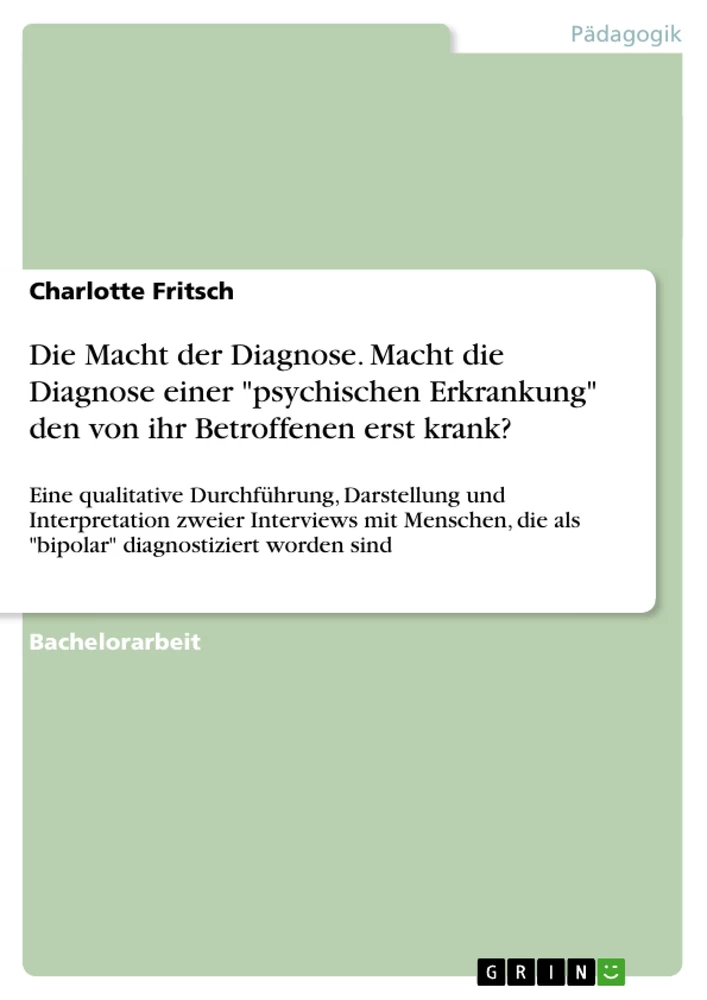"Es sind nicht die Menschen die sich ändern. Es sind die Labels. Nicht die Zahl psychischer Erkrankungen nimmt zu, sondern die Bezeichnungen für sie" - so der US-Psychiater Allen Frances in einem Focus-Interview (2013, Nr. 18).
Jenes Zitat soll den Ausgangspunkt dieser Arbeit bilden, die sich mit der spannenden Frage beschäftigt, welche Auswirkungen die Diagnose einer "psychischen Erkrankung" auf den Diagnostizierten hat. Welche Macht hat eine solche Diagnose - macht sie den Menschen erst "krank", indem sie ihn für "krank" erklärt? Zunächst werden relevante theoretische Ansätze angerissen, um deren Position zu psychiatrischen Diagnosen herauszuarbeiten. Die Diagnose einer "psychischen Erkrankung" wird unter dem Gesichtspunkt des Labeling Approach untersucht - einer soziologischen Sichtweise, die die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen durch die Etikettierung mit einer solchen Diagnose als stark eingeschränkt sieht. Anhand der sozial-konstruktivistischen Sicht wird die Diagnose als etwas, das Wirklichkeit erzeugt, vorgestellt. Daraufhin wird der Aspekt der Stigmatisierung, die zu Selbststigmatisierung führen kann, erläutert. Es folgt eine Auseinandersetzung mit personenbezogenen Sichtweisen - insbesondere der medizinischen - die eine "Störung" im Menschen verankert und somit die Diagnose als gerechtfertigte Kategorisierung für die Auswahl der "richtigen" Behandlung sieht. Kritik wird dabei am defizitorientierten Klassifikationssystem ICD-10 und einer zu starken Fixierung auf "genetisch bedingte" Ursachen einer "psychischen Erkrankung" geübt. Zuletzt wird die systemische Sichtweise auf psychiatrische Diagnosen mit einbezogen - wobei deutlich wird, dass nach diesem Ansatz nicht der Einzelne als "krank" diagnostiziert werden kann, sondern als "krank" erlebtes Verhalten immer nur innerhalb eines bestimmten Kontextes betrachtet und erklärt werden kann.
Aufbauend auf dieser theoretischen Grundlage werden folgende Hypothesen anhand zweier Interviews, mit Menschen, die als "bipolar" diagnostiziert wurden, untersucht: "Die Diagnose einer 'psychischen Erkrankung' schränkt bei dem 'Etikettierten' das Gefühl der Selbstwirksamkeit ein und hat deshalb einen negativen Einfluss auf Selbstwahrnehmung, Selbstwertgefühl und die eigene Entwicklung", "In Familien, in denen die gleiche Diagnose mehrfach auftritt, wird nicht die 'Erkrankung' sondern die Diagnose weitergegeben" und "Die Diagnose 'bipolar' macht aus einem vorübergehenden Zustand eine chronische Erkrankung."
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Die Diagnose einer "psychischen Erkrankung" unter dem Gesichtspunkt des Labeling Approach
- 2.2 Die Diagnose einer "psychischen Erkrankung" aus sozial-konstruktivistischer Sicht
- 2.3 Die Folgen von Stigmatisierung und Selbststigmatisierung aufgrund der Diagnose einer "psychischen Erkrankung"
- 2.4 Die Diagnose einer "psychischen Erkrankung" aus personenbezogener Sicht
- 2.5 Die Diagnose einer "psychischen Erkrankung" aus systemischer Sicht
- 2.6 Zusammenfassung und Ableitung der Hypothesen
- 3 Praxisteil: Welche Auswirkungen hat die Diagnose "bipolar" auf die von ihr Betroffenen?
- 3.1 Methodendarstellung und Interviewpartner
- 3.2 Ergebnisdarstellung
- 3.2.1 Umgang mit der Theorie der "genetischen Vorbelastung"
- 3.2.2 Persönliche Bedeutung der Diagnose und Selbstbild
- 3.2.3 Konsequenzen der Diagnose auf die berufliche Situation
- 3.2.4 Reaktionen anderer
- 3.2.5 Eigene Erklärungen der Probleme und ihrer Lösungsmöglichkeiten
- 3.3 Interpretation der Ergebnisse
- 3.3.1 Hypothese 1
- 3.3.2 Hypothese 2
- 4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
- 5 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen der Diagnose "psychische Erkrankung", insbesondere "bipolar", auf die Betroffenen. Die Arbeit hinterfragt den Einfluss der Diagnose auf die Selbstwahrnehmung, das Selbstwertgefühl und die Lebensgestaltung der diagnostizierten Personen. Es wird analysiert, inwieweit die Diagnose selbst krankmachend wirkt und welche Rolle Stigmatisierung und soziale Konstruktion dabei spielen.
- Der Einfluss des Labeling Approach auf die Wahrnehmung und den Umgang mit psychischen Erkrankungen.
- Die sozial-konstruktivistische Perspektive auf die Entstehung und Bedeutung psychiatrischer Diagnosen.
- Die Auswirkungen von Stigmatisierung und Selbststigmatisierung auf Betroffene.
- Die Analyse der persönlichen Erfahrungen von mit "bipolar" diagnostizierten Personen.
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem defizitorientierten Klassifikationssystem ICD-10.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Fragestellung der Arbeit ein und zitiert Allen Frances, der die Zunahme von Diagnosen für psychische Erkrankungen kritisch hinterfragt. Die Arbeit untersucht, ob die Diagnose selbst krankmachend wirkt. Es wird eine kurze Übersicht über den Aufbau der Arbeit gegeben, wobei die theoretischen Grundlagen und der Praxisteil mit Interviews mit bipolar diagnostizierten Personen vorgestellt werden. Die Hypothesen der Arbeit werden formuliert und der Fokus auf den Einfluss der Diagnose auf Selbstwirksamkeit, Selbstwahrnehmung und Lebensgestaltung gelegt.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze zur Diagnose psychischer Erkrankungen. Der Labeling Approach wird vorgestellt, der die Etikettierung als krankmachenden Faktor beschreibt. Der sozial-konstruktivistische Ansatz betont die sprachliche Konstruktion von Wirklichkeit. Der Aspekt der Stigmatisierung und Selbststigmatisierung wird erläutert. Personenbezogene und systemische Sichtweisen auf die Diagnose werden dargestellt, wobei die Kritik am ICD-10 und an der Fokussierung auf genetische Ursachen hervorgehoben wird.
3 Praxisteil: Welche Auswirkungen hat die Diagnose "bipolar" auf die von ihr Betroffenen?: Dieser Abschnitt beschreibt die Methodik der Arbeit, die auf zwei offenen Interviews mit bipolar diagnostizierten Personen basiert. Die Ergebnisdarstellung ist in Kategorien unterteilt: persönliche Bedeutung der Diagnose, Umgang mit der Theorie der genetischen Vorbelastung, berufliche Konsequenzen, Reaktionen des Umfelds und eigene Lösungsansätze der Betroffenen. Die Ergebnisse werden im Kontext der Hypothesen interpretiert.
Schlüsselwörter
Psychische Erkrankung, Diagnose, Bipolar, Labeling Approach, Sozialer Konstruktivismus, Stigmatisierung, Selbststigmatisierung, ICD-10, Selbstwirksamkeit, Selbstwahrnehmung, qualitative Forschung, Interview.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Auswirkungen der Diagnose "bipolar"
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen der Diagnose "psychische Erkrankung", insbesondere "bipolar", auf die Betroffenen. Im Fokus steht der Einfluss der Diagnose auf die Selbstwahrnehmung, das Selbstwertgefühl und die Lebensgestaltung der diagnostizierten Personen. Analysiert wird, inwieweit die Diagnose selbst krankmachend wirkt und welche Rolle Stigmatisierung und soziale Konstruktion dabei spielen.
Welche theoretischen Ansätze werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den Labeling Approach, der die Etikettierung als krankmachenden Faktor beschreibt, sowie auf den sozial-konstruktivistischen Ansatz, der die sprachliche Konstruktion von Wirklichkeit betont. Zusätzlich werden personenbezogene und systemische Sichtweisen auf die Diagnose berücksichtigt. Die Arbeit kritisiert das defizitorientierte Klassifikationssystem ICD-10 und die Fokussierung auf genetische Ursachen.
Welche Methode wurde zur Datenerhebung eingesetzt?
Die Arbeit basiert auf qualitativer Forschung, genauer gesagt auf zwei offenen Interviews mit Personen, die mit "bipolar" diagnostiziert wurden. Die Ergebnisse werden in Kategorien wie persönliche Bedeutung der Diagnose, Umgang mit der genetischen Vorbelastungstheorie, berufliche Konsequenzen, Reaktionen des Umfelds und eigene Lösungsansätze der Betroffenen unterteilt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss des Labeling Approach auf die Wahrnehmung und den Umgang mit psychischen Erkrankungen, die sozial-konstruktivistische Perspektive auf die Entstehung und Bedeutung psychiatrischer Diagnosen, die Auswirkungen von Stigmatisierung und Selbststigmatisierung auf Betroffene, die Analyse der persönlichen Erfahrungen von mit "bipolar" diagnostizierten Personen und eine kritische Auseinandersetzung mit dem ICD-10.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Teil zu den theoretischen Grundlagen, einen Praxisteil mit der Darstellung der Interviews und deren Ergebnisse, eine Zusammenfassung und Schlussfolgerungen sowie einen Ausblick. Die Einleitung führt in die Fragestellung ein, stellt die Hypothesen vor und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Der Praxisteil interpretiert die Ergebnisse im Kontext der Hypothesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Psychische Erkrankung, Diagnose, Bipolar, Labeling Approach, Sozialer Konstruktivismus, Stigmatisierung, Selbststigmatisierung, ICD-10, Selbstwirksamkeit, Selbstwahrnehmung, qualitative Forschung, Interview.
Welche Hypothesen werden in der Arbeit untersucht?
Die konkreten Hypothesen werden in der Arbeit formuliert, jedoch nicht im vorliegenden Inhaltsverzeichnis explizit genannt. Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt jedoch im Kontext dieser Hypothesen (Kapitel 3.3.1 und 3.3.2).
Gibt es eine Kritik am bestehenden System?
Ja, die Arbeit kritisiert das defizitorientierte Klassifikationssystem ICD-10 und die übermäßige Fokussierung auf genetische Ursachen bei psychischen Erkrankungen.
- Quote paper
- Charlotte Fritsch (Author), 2013, Die Macht der Diagnose. Macht die Diagnose einer "psychischen Erkrankung" den von ihr Betroffenen erst krank?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273037