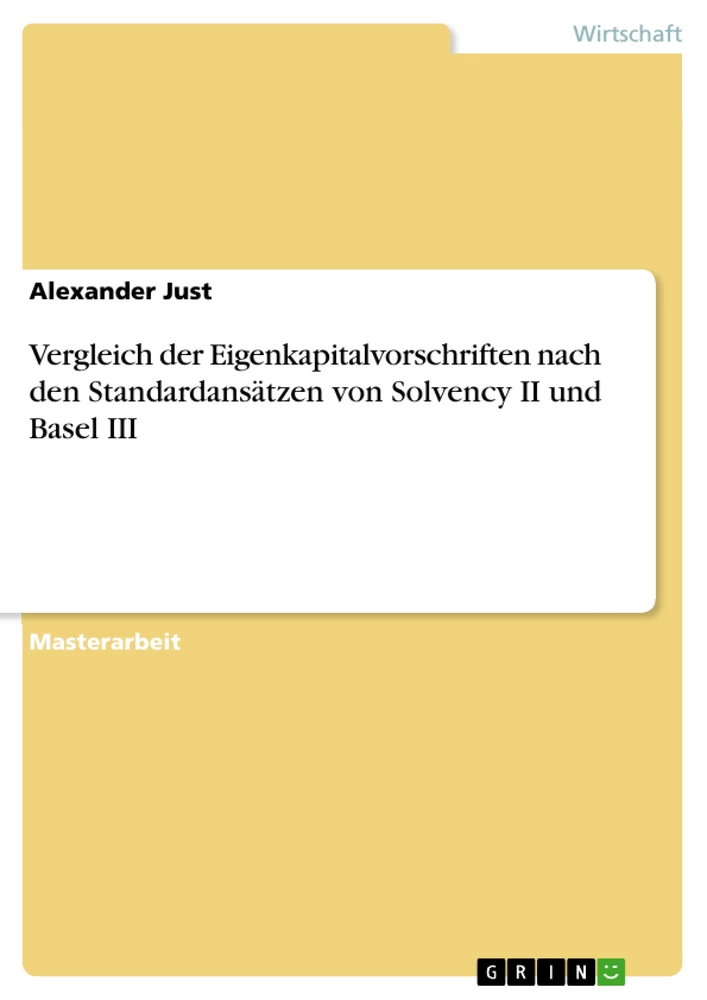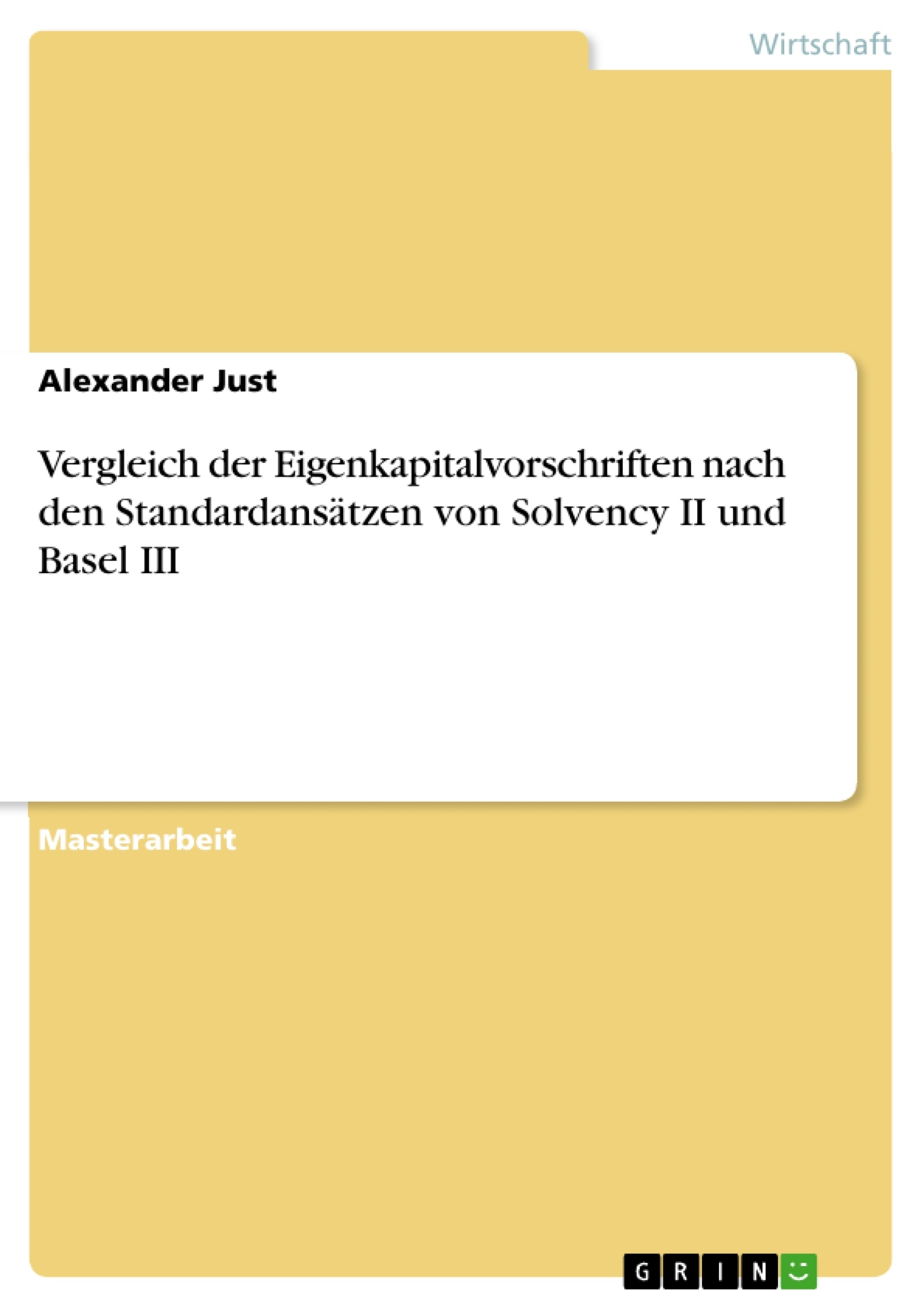Die Finanzmarktkrise 2007 hat viele überrascht - die Auswirkungen sind bis heute zu spüren. Eine global vernetzte Finanzwelt führte zu ungeahnten Kettenreaktionen, unabhängig von Ländergrenzen waren viele am Finanzmarkt handelnde Akteure betroffen. Die Staatshilfen für verschiedene Banken und nicht zuletzt die Insolvenz der Bank Lehmann Brothers, verdeutlichte die Notwendigkeit der Verbesserung des Bankenaufsichtsrechts. Dieses, durch Basel II im Jahr 2006 zwar umfänglich reformierte und noch gar nicht flächendeckend eingeführt, zeigte Schwächen. Der Baseler Ausschuss reagierte mit ersten Maßnahmen, um die aufgedeckten Anomalien zu beheben. Es wurde die Ausarbeitung weiterer Maßnahmen verfolgt und mit der Veröffentlichung von Basel III im Jahr 2010 ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgestellt.
Die 2008 drohende, durch Staatshilfen abgewendete Insolvenz des Versicherers AIG (American International Group) offenbarte Schwächen - auch im Versicherungssektor. Das bereits 1999 vor dem Hintergrund eng vernetzter Finanzmärkte ins Leben gerufene EU-Projekt Solvency II gewann zunehmend an Bedeutung. In erster Linie wurde es zum besseren Schutz der Versicherten, als Reaktion eines geänderten Umfeldes, auch für die Versicherungsbranche, initiiert. Darüber hinaus sollte es die unterschiedlichen EU-Versicherungsaufsichtsrechten vereinheitlichen um grenzübergreifende Versicherungstätigkeiten zu erleichtern.
Nicht nur durch die Erfahrungen der Finanzmarktkrise und die Veränderungen von Basel II durch Basel III, sondern auch die Staatsschuldenkrise und die aktuelle Niedrigzinsphase machten es unerlässlich, vor der Einführung von Solvency II, weitere Adjustierungen vorzunehmen. Diese wurden teilweise durch Auswirkungsstudien getestet. Mit der Veröffentlichung der endgültigen Standards von Solvency II wird 2014 gerechnet, die Einführung soll im Jahr 2016 erfolgen.
Die gleichzeitige Änderung im Banken- wie auch Versicherungsaufsichtsrecht in einem schwierigen Markumfeld wird dabei kritisch beobachtet. Die vorliegende Arbeit soll daher einen Überblick über die geplanten Standards - insbesondere in Bezug auf die Standardansätze der ersten Säule - geben.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die aufsichtsrechtlichen Grundlagen
- Geschäftsmodelle von Versicherungen, Banken und daraus resultierende Risiken
- Funktion und Geschäftsmodell von Versicherungen
- Funktion und Geschäftsmodell von Banken
- Risiken, die sich aus den Geschäftsmodellen von Banken und Versicherungen ergeben
- Zielsetzung, Entwicklung und Aufbau von Solvency II
- Zielsetzung und Anwendungsbereich von Solvency II
- Implementierung von Solvency II durch das Lamfalussy Verfahren
- Der Aufbau von Solvency II als Drei-Säulen-Ansatz
- Systematisierung der Baseler Akkorde mit besonderem Blick auf die Neuerungen durch Basel III
- Die Entstehung der Baseler Akkorde und die Umsetzung innerhalb der Europäischen Union
- Ziel eines stabileren Bankensektors — die Basel III Reform als Lehre aus der Finanzmarktkrise
- Zusätzliche Anforderungen durch Einführung neuer Liquiditätskennzahlen mit Basel III
- Geschäftsmodelle von Versicherungen, Banken und daraus resultierende Risiken
- Beschreibung der Eigenkapitalanforderungen durch Solvency II und Basel III
- Solvency II: Solvenzkapitalanforderungen und Bestandteile der Eigenmittel
- Die Solvenzkapitalanforderungen und daraus resultierende Mindest-Risikokapitalanforderungen
- Darstellung des Markrisikomoduls in der Zusammensetzung seiner Untermodule
- Die Berechnung der Kapitalanforderungen für operationelle Risiken nach den Vorschriften von Solvency II
- Bestandteile der Eigenmittel nach Solvency II
- Basel III: Betrachtung der Mindestkapitalanforderungen und der Eigenkapitalkomponenten
- Mindestkapitalanforderungen nach Basel III
- Berechnung der Kapitalanforderungen der Marktrisiken
- Berechnung der Kapitalanforderungen für das operationelle Risiko
- Komponenten des Eigenkapitals und zu erfüllende Eigenkapitalquoten nach Basel III
- Solvency II: Solvenzkapitalanforderungen und Bestandteile der Eigenmittel
- Vergleich und Auswirkungen der Mindesteigenkapitalanforderungen nach Solvency II und Basel III
- Vergleich der Mindesteigenkapitalanforderungen nach Solvency II und Basel III
- Vergleich der Kapitalanforderungen im Bezug auf Anleihen, Aktien und Immobilien
- Vergleich der Kapitalanforderungen für das operationelle Risiko und das Währungsrisiko
- Vergleich der Anforderungen an die Komponenten der Eigenmittel
- Vergleich der Mindesteigenkapitalanforderungen
- Kritik an den Standardansätzen von Solvency II und Basel III und mögliche Auswirkungen
- Solvency II: Kritik und mögliche Auswirkungen
- Basel III: Kritik und mögliche Auswirkungen
- Mögliche Auswirkungen auf die Geschäftspraxis von Banken und Versicherungen
- Grenzen der Regulierung und Lösungsansätze
- Vergleich der Mindesteigenkapitalanforderungen nach Solvency II und Basel III
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit einem Vergleich der Eigenkapitalvorschriften nach den Standardansätzen von Solvency II und Basel III. Sie analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Regulierungsansätze im Hinblick auf die Berechnung von Kapitalanforderungen für verschiedene Risiken, die Zusammensetzung des Eigenkapitals sowie die Auswirkungen auf die Geschäftspraktiken von Banken und Versicherungen.
- Die Entwicklung und Ziele der beiden Regulierungsansätze Solvency II und Basel III
- Die Standardansätze zur Berechnung von Kapitalanforderungen für verschiedene Risiken, insbesondere Marktrisiken, operationelle Risiken und Währungsrisiken
- Die Anforderungen an die Komponenten des Eigenkapitals, insbesondere die Unterscheidung in verschiedene Klassen (Tiers) und die Qualität des Eigenkapitals
- Die Auswirkungen der neuen Regulierungsstandards auf die Geschäftspraktiken von Banken und Versicherungen, insbesondere in Bezug auf die Anlagepolitik, die Finanzierungsmöglichkeiten und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Sektoren
- Kritik an den Standardansätzen und mögliche Lösungsansätze für die Herausforderungen der Regulierung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 bietet einen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Grundlagen von Solvency II und Basel III. Es werden die Geschäftsmodelle von Versicherungen und Banken sowie die daraus resultierenden Risiken erläutert. Die Kapitel beleuchtet die Zielsetzung, Entwicklung und den Aufbau der beiden Regulierungsansätze.
Kapitel 3 beschreibt die Standardansätze zur Berechnung von Kapitalanforderungen nach Solvency II und Basel III. Es werden die Solvenzkapitalanforderungen (SCR) und die Mindestkapitalanforderungen (MCR) nach Solvency II sowie die Eigenkapitalanforderungen und Eigenkapitalkomponenten nach Basel III detailliert dargestellt.
Kapitel 4 vergleicht die Mindesteigenkapitalanforderungen nach Solvency II und Basel III. Es werden die Kapitalanforderungen für Anleihen, Aktien und Immobilien sowie für das operationelle Risiko und das Währungsrisiko gegenübergestellt. Außerdem werden die Anforderungen an die Komponenten des Eigenkapitals und die Auswirkungen der neuen Regulierungsstandards auf die Geschäftspraktiken von Banken und Versicherungen analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Solvency II, Basel III, Eigenkapitalanforderungen, Kapitalanforderungen, Marktrisiken, operationelle Risiken, Währungsrisiken, Eigenkapitalkomponenten, Geschäftspraktiken, Banken, Versicherungen, Finanzmarktkrise, Finanzstabilität, Regulierung, Kritik, Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptziele von Solvency II?
Solvency II zielt auf den Schutz der Versicherten, die Vereinheitlichung des EU-Aufsichtsrechts und die Anpassung an ein geändertes Marktumfeld ab.
Was unterscheidet Basel III von seinen Vorgängern?
Basel III führt als Reaktion auf die Finanzkrise 2007 strengere Eigenkapitalanforderungen und neue Liquiditätskennzahlen für Banken ein.
Was bedeutet SCR im Kontext von Solvency II?
SCR steht für "Solvency Capital Requirement" (Solvenzkapitalanforderung) und beschreibt das Kapital, das ein Versicherer halten muss, um Risiken abzudecken.
Wie werden operationelle Risiken in den Regelwerken behandelt?
Sowohl Solvency II als auch Basel III enthalten spezifische Standardansätze zur Berechnung der Kapitalanforderungen für operationelle Risiken.
Welche Auswirkungen haben diese Regeln auf die Anlagepolitik?
Die Regeln beeinflussen, wie Banken und Versicherungen in Aktien, Anleihen oder Immobilien investieren, da diese Anlagen unterschiedlich mit Eigenkapital unterlegt werden müssen.
- Quote paper
- Alexander Just (Author), 2013, Vergleich der Eigenkapitalvorschriften nach den Standardansätzen von Solvency II und Basel III, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273169