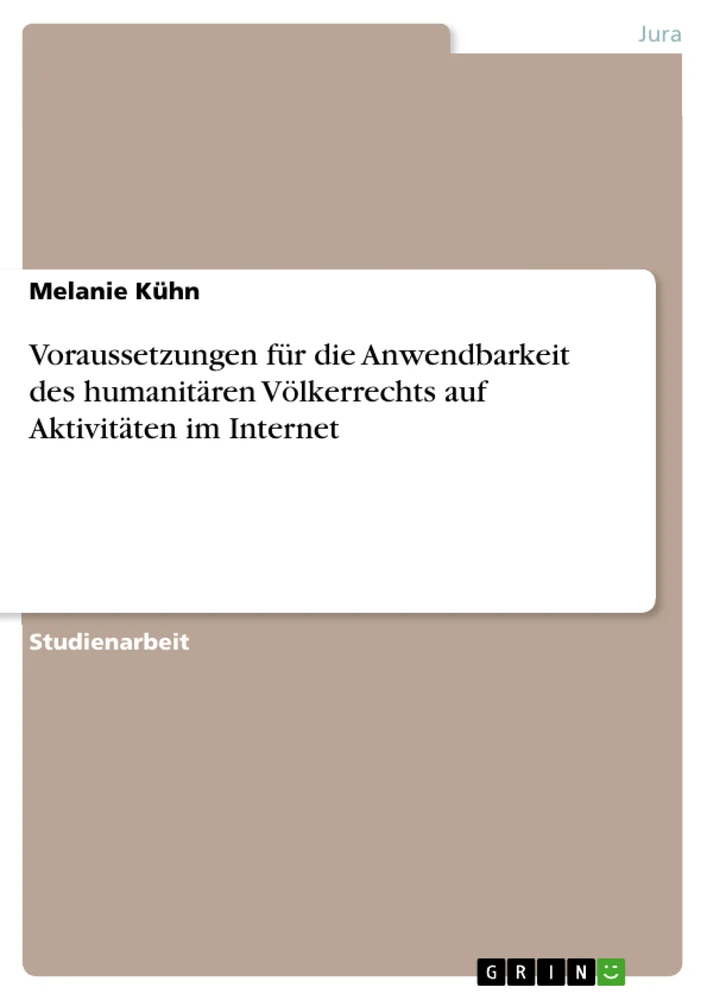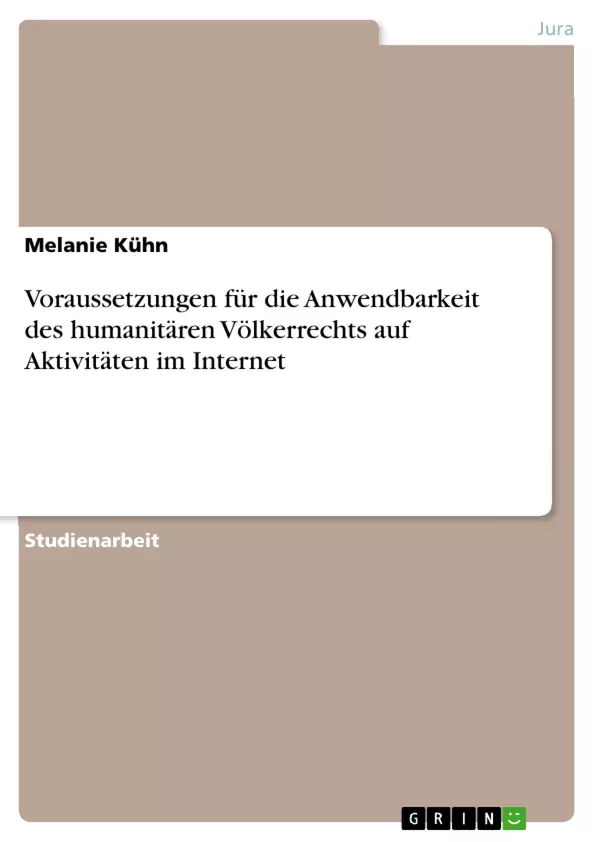„Stell’ Dir vor es ist Krieg und keiner geht hin.“
Dieses Zitat des amerikanischen Schriftstellers Carl Sandburg wurde in Deutschland Anfang der achtziger Jahre durch die Friedensbewegung gegen die Nachrüstung und den Nato-Doppelbeschluss populär. Doch wenn man an die Entwicklung des Internets und die Technisierung des Kriegsgeschehens denkt, erlangt dieser eigentlich pazifistische Satz eine ganz andere Bedeutung. Das Informationszeitalter ist geprägt von neuen Technologien, die dem Menschen das Leben vereinfachen. Wenn man Geschäfte bequem im Internet abschließen kann und sich ein erheblicher Teil des sozialen Lebens online abspielt, so ist es nicht fernliegend, dass Staaten zukünftig im virtuellen Raum auch ein „digitales Schlachtfeld“ eröffnen können, quasi „Krieg per Mausklick“ führen. Eine dahingehende Tendenz ist bereits in der Entwicklung der Drohnen-Technologie zu sehen. Ein insoweit nur konsequenter nächster Schritt ist die Verlagerung des gesamten Schlachtfelds ins Internet.
Eigene Abteilungen des Militärs und der Geheimdienste für Cyber-Operationen und die Verteidigung gegen solche sind längst keine Neuheit mehr. Zudem ereigneten sich schon eine Reihe von „Cyber-Angriffen“ auf staatliche Einrichtungen, wie z.B. in Estland 2007, in Georgien 2008 oder im Iran 2010. Bei diesen Vorfällen wurde aber nie von einem internationalen „bewaffneten Konflikt“ gesprochen.
„Cyber Warfare“ ist im humanitären Völkerrecht (HVR) bisher nicht geregelt. Die vorliegende Arbeit befasst sich damit, ob HVR deshalb generell auf Aktivitäten im Internet Anwendung finden kann und wann eine Cyber-Operation die Schwelle eines „Angriffs“ iSd HVR überschreitet. Anhand der wichtigsten Prinzipien und Normen des HVR werden dann die Eigenheiten und Probleme des Cyberwars beleuchtet. Schließlich wird ermittelt, ob das HVR im aktuellen Zustand für die Bewältigung des Cyberwars ausreicht oder ob ein neues Abkommen geschaffen werden muss, um spezifische Probleme zu überbrücken.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts auf Aktivitäten im Internet
- I. Das humanitäre Völkerrecht – Abgrenzung und Rechtsquellen
- II. Die Möglichkeiten eines „Cyber-Angriffs“
- 1. Distributed Denial of Service Attacks
- 2. Einschleusen fehlerhafter Informationen…...
- 3. Probleme der Zurechenbarkeit.......
- III. Generelle Anwendbarkeit des HVR auf Cyber-Angriffe.
- 1. Das Internet als ungeregelter Raum im HVR…..\n
- 2.
- a. Vorliegen eines „bewaffneten Konflikts\".
- Objektive Elemente
- b. Subjektive Elemente.
- a. Vorliegen eines „bewaffneten Konflikts\".
- IV. Cyber-Operationen als „Angriffe“ iSd HVR
- 1.
- a. Der Angriffsbegriff des Art. 49 I ZP I.
- Cyber-Angriffe ohne physische Auswirkungen.
- b. ,,Angriffe“ als Abgrenzung zu „Kriegshandlungen“.
- 2. Inbesitznahme und Neutralisierung als Angriff
- Ergebnis...........
- 1.
- V. Die konkrete Anwendung des HVR auf Cyber-Angriffe ....
- 1.
- a. Schutz der Zivilbevölkerung
- b. Prinzip der Unterscheidung..\n
- Unterschiedslose Angriffe..\n
- C. Computernetze als Dual-Use Targets.
- d. Knock-on Effekte
- e. Vorsichtsmaßnahmen
- i. Vorsichtsmaßnahmen des Angreifers..\n
- ii. Vorsichtsmaßnahmen des Angegriffenen.........
- 2. Perfidieverbot
- 3. Zivile Mitwirkung und Kombattantenstatus.
- 1.
- VI. Neues Abkommen als Alternative
- C. Fazit
- Abgrenzung und Rechtsquellen des humanitären Völkerrechts
- Möglichkeiten eines „Cyber-Angriffs“ und deren Auswirkungen
- Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts auf Cyber-Angriffe im Kontext eines bewaffneten Konflikts
- Konkrete Anwendung des humanitären Völkerrechts auf Cyber-Angriffe, insbesondere im Hinblick auf die Schutzpflichten gegenüber der Zivilbevölkerung
- Alternative Lösungsansätze für die Herausforderungen im Cyberspace
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts auf Aktivitäten im Internet ein und stellt die Relevanz der Thematik dar.
- Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts: Dieses Kapitel erläutert zunächst die grundlegenden Prinzipien und Rechtsquellen des humanitären Völkerrechts. Anschließend werden verschiedene Formen von „Cyber-Angriffen“ vorgestellt und die Problematik der Zurechenbarkeit von Handlungen im Internet beleuchtet.
- Generelle Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts auf Cyber-Angriffe: Dieses Kapitel analysiert die Frage, ob das humanitäre Völkerrecht überhaupt auf Cyber-Angriffe anwendbar ist. Es wird auf die Besonderheiten des Internets als „ungeregelter Raum“ im Kontext des humanitären Völkerrechts eingegangen und die Kriterien für das Vorliegen eines „bewaffneten Konflikts“ im Cyberspace diskutiert.
- Cyber-Operationen als „Angriffe“ im Sinne des humanitären Völkerrechts: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Angriff“ im humanitären Völkerrecht und untersucht, ob Cyber-Angriffe als „Angriffe“ im Sinne des humanitären Völkerrechts qualifiziert werden können.
- Die konkrete Anwendung des humanitären Völkerrechts auf Cyber-Angriffe: Dieses Kapitel untersucht die konkrete Anwendung des humanitären Völkerrechts auf Cyber-Angriffe. Es werden verschiedene Aspekte wie der Schutz der Zivilbevölkerung, das Prinzip der Unterscheidung, das Perfidieverbot und der Kombattantenstatus im Zusammenhang mit Cyber-Angriffen diskutiert.
- Neues Abkommen als Alternative: Dieses Kapitel geht auf die Frage ein, ob ein neues Abkommen zur Regulierung von Cyber-Angriffen notwendig ist.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit von Melanie Kühn befasst sich mit der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen das humanitäre Völkerrecht auf Aktivitäten im Internet anwendbar ist. Dabei stehen die besonderen Herausforderungen im Fokus, die die digitale Welt für die klassischen Regeln des humanitären Völkerrechts darstellt.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des humanitären Völkerrechts im Kontext von Cyber-Angriffen. Dabei stehen Konzepte wie „bewaffneter Konflikt“, „Angriff“, „Schutz der Zivilbevölkerung“, „Prinzip der Unterscheidung“, „Perfidieverbot“ und „Kombattantenstatus“ im Fokus.
Häufig gestellte Fragen
Gilt das humanitäre Völkerrecht (HVR) auch im Internet?
Ja, die Arbeit untersucht, dass die Prinzipien des HVR grundsätzlich auch auf Cyber-Operationen anwendbar sind, sofern diese die Schwelle eines bewaffneten Konflikts erreichen.
Wann gilt eine Cyber-Operation als „Angriff“ im Sinne des Völkerrechts?
Ein Cyber-Angriff wird oft dann als „Angriff“ gewertet, wenn er physische Zerstörungen oder Personenschäden verursacht, ähnlich wie konventionelle Waffen.
Was ist das Problem der Zurechenbarkeit bei Cyber-Attacken?
Es ist im Internet technisch schwierig, einen Angriff zweifelsfrei einem staatlichen Akteur zuzuordnen, was die Anwendung völkerrechtlicher Sanktionen erschwert.
Wie schützt das HVR die Zivilbevölkerung vor Cyberwar?
Durch das Prinzip der Unterscheidung: Angriffe dürfen sich nur gegen militärische Ziele richten. Dual-Use-Systeme (z.B. Stromnetze für Zivilisten und Militär) stellen hierbei eine besondere Herausforderung dar.
Ist ein neues internationales Abkommen für den Cyberwar notwendig?
Die Arbeit diskutiert, ob die bestehenden Genfer Konventionen ausreichen oder ob spezifische neue Verträge nötig sind, um die rechtlichen Grauzonen im digitalen Raum zu schließen.
- Arbeit zitieren
- Melanie Kühn (Autor:in), 2014, Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts auf Aktivitäten im Internet, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273233