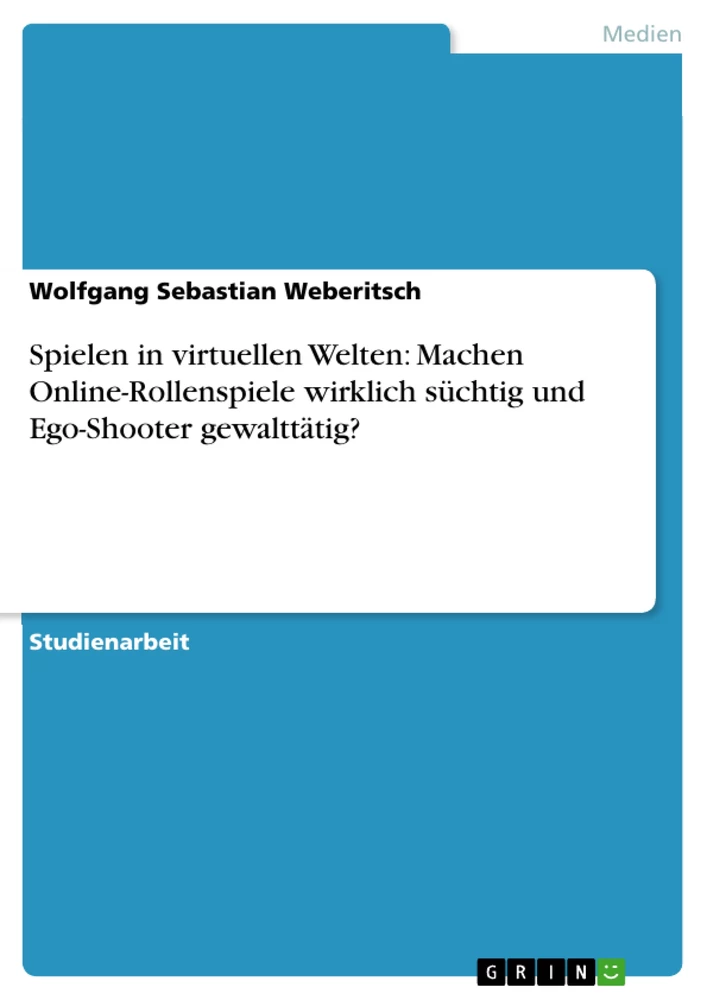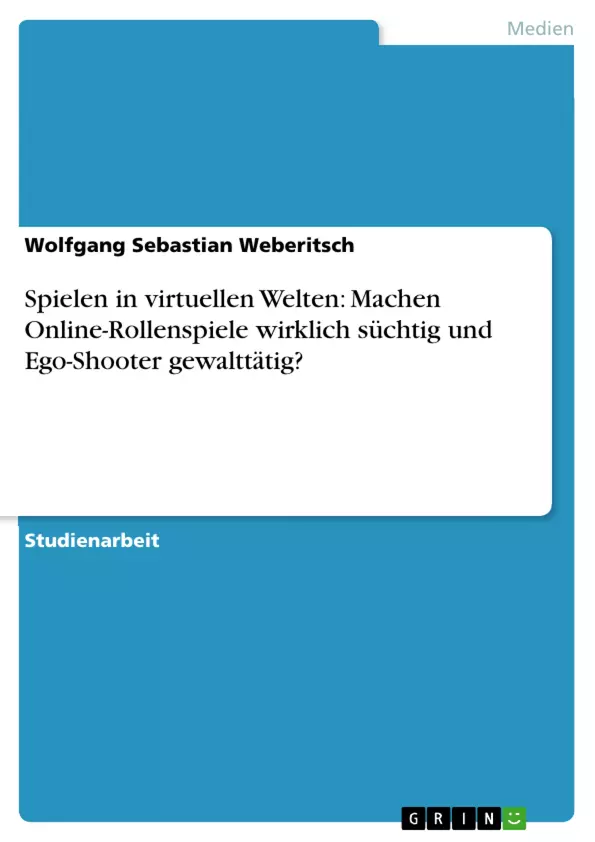Es vergeht kaum Zeit, wo in den Medien Berichte auftauchen, die über Gewalt in Schulen berichten. Von Demütigungen anderer Mitschüler angefangen bis hin zu massiv gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Schülern und Lehrpersonal. In der öffentlichen Diskussion hört man oft, dass Medien und Gewalt in einem direkten Bezug zueinander stehen. Wenn man sich den Fall in Littleton, Colorado ansieht, wo am 20.04.1999 zwei Teenager zwölf Mitschüler und einen Lehrer umgebracht haben, wurden violente Filme und Computerspiele als Auslöser dieses Massakers in Betracht gezogen. Das gleiche gilt auch für den Amoklauf im Gutenberggymnasium in Erfurt, wo am 26. April 2002 der zuvor von der Schule verwiesene Robert Steinhäuser 16 Menschen tötete. “ (vgl: KUNCZIK / ZIPFEL, In: DITTLER / HOYER (Hrgb). Dafür verantwortlich wurden wieder die Medien gemacht, besonders die Computerspielindustrie. Es gibt viele Meinungen ob Computerspiele die Initialfaktoren sind, die Gewalt entstehen lassen, doch eines kann man mit Bestimmtheit sagen, „ dass Medien Auswirkungen auf die Rezipienten haben“(DITTLER / HOYER, S. 8). Wenn man davon ausgeht, dass Computerspiele ein Medium sind welches „Vermittler von Informationen, Nachrichten, Werten, Normen und Weltanschauungen“ (DITTLER / HOYER, S. 8) sind, liegt die Vermutung nahe, dass solche Spiele einen wesentlichen Einfluss auf die Rezipienten ausüben. Auch Manfred Spitzer von der Universitätsklinik für Psychiatrie in Ulm hat durch seine Studien gezeigt, „dass Computerspiele gewaltbereit und aggressiv machen“(vgl. Frontal 21, ZDF 26.04.2008). Im ersten Teil dieser Arbeit möchte ich allgemein auf Online Rollenspiele eingehen, wie sie aufgebaut sind, wer die Konsumenten sind und wie Online Rollenspiele sich auf das Suchtverhalten und die Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen auswirken. Im zweiten Teil möchte ich auf die möglichen Ursachen von Gewalt eingehen und dabei das vieldiskutierte Thema der Computerspiele oder besser gesagt der Gewaltspiele genauer untersuchen. In meiner Untersuchung habe ich mich auf Medienberichte des ZDF, einem Vortragsmanuskripts von Dr. Thilo Hartmann, das Sammelwerk von Ullrich Dittler und Michael Hoyer, wo Beiträge von Thomas Feibel „warum brutale Computerspiele Kinder in ihren Bann ziehen“ sowie von Michael Kunczik und Astrid Zipfel „Medien und Gewalt: Die Wirkungstheorien“ beschrieben sind.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I
- Einleitung „Spielen in virtuellen Welten
- Wer spielt was?
- Die Sucht und die virtuelle Welt
- Teil II
- Sucht und Gewalt
- Gewalt in unserem Umfeld
- Sind Computerspiele die wahren Schuldigen?
- Kinder und Software
- Theoretische Ansätze
- Die Katharsisthese
- Die Inhibitionsthese und die Umkehrthese
- Die Habitualisierungsthese
- Die Suggestionsthese
- Die Skripttheorie
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Spielens in virtuellen Welten, insbesondere mit Online-Rollenspielen. Sie analysiert die Auswirkungen dieser Spiele auf das Suchtverhalten und die Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen. Dabei werden verschiedene Theorien und empirische Forschungsbefunde betrachtet, um die komplexen Zusammenhänge zwischen Medienkonsum, Gewalt und Aggression zu beleuchten. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen des Spielens in virtuellen Welten zu schaffen.
- Die Auswirkungen von Online-Rollenspielen auf das Suchtverhalten
- Der Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Mediengewalt
- Die Rolle der Medienkompetenz bei der Nutzung von Computerspielen
- Die Bedeutung von Jugendschutzmaßnahmen im Bereich der Computerspiele
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Teil der Arbeit wird eine Einführung in das Thema „Spielen in virtuellen Welten" gegeben. Es wird erläutert, welche Arten von Online-Rollenspielen es gibt, wer die Konsumenten sind und wie diese Spiele sich auf das Suchtverhalten und die Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen auswirken.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem Thema „Sucht und Gewalt". Es werden verschiedene Theorien und empirische Forschungsbefunde betrachtet, die den Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt untersuchen. Dabei werden auch die möglichen Ursachen für Gewalt in unserem Umfeld beleuchtet.
Im dritten Teil der Arbeit werden verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung von Mediengewalt vorgestellt. Es werden die Katharsisthese, die Inhibitionsthese, die Habitualisierungsthese, die Suggestionsthese und die Skripttheorie betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Online-Rollenspiele, Computerspiele, Sucht, Gewalt, Mediengewalt, Medienkompetenz, Jugendschutz, Katharsisthese, Inhibitionsthese, Habitualisierungsthese, Suggestionsthese, Skripttheorie, Medienwirkung, Aggression, Kinder und Jugendliche.
Häufig gestellte Fragen
Machen Online-Rollenspiele wirklich süchtig?
Die Arbeit untersucht das Suchtpotential von virtuellen Welten und zeigt auf, wie der Aufbau dieser Spiele und das Konsumverhalten von Jugendlichen zu Abhängigkeiten führen können.
Führen Ego-Shooter zu gewalttätigem Verhalten?
In der öffentlichen Diskussion werden Medien oft direkt mit Gewalt verknüpft. Die Arbeit analysiert verschiedene Theorien, um zu klären, ob Spiele Initialfaktoren für reale Gewalt sind.
Was besagt die Katharsisthese im Kontext von Computerspielen?
Die Katharsisthese geht davon aus, dass das Ausleben von Aggressionen in der virtuellen Welt eine reinigende Wirkung hat und reale Gewaltbereitschaft eher senkt.
Was ist die Habitualisierungsthese?
Diese These besagt, dass der häufige Konsum von medialer Gewalt zu einer Abstumpfung (Gewöhnung) führt, wodurch die Hemmschwelle für eigenes aggressives Handeln sinken kann.
Welche Rolle spielt der Jugendschutz bei Software?
Jugendschutzmaßnahmen sind entscheidend, um den Zugriff auf entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte zu regulieren und die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern.
- Quote paper
- Mag. Wolfgang Sebastian Weberitsch (Author), 2009, Spielen in virtuellen Welten: Machen Online-Rollenspiele wirklich süchtig und Ego-Shooter gewalttätig?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273426