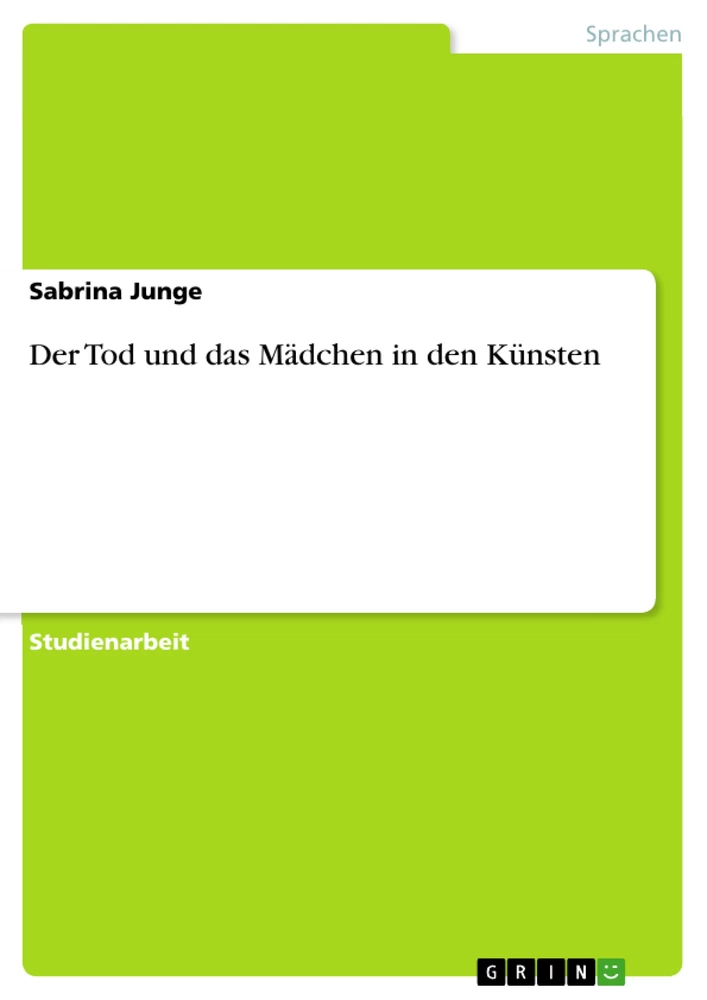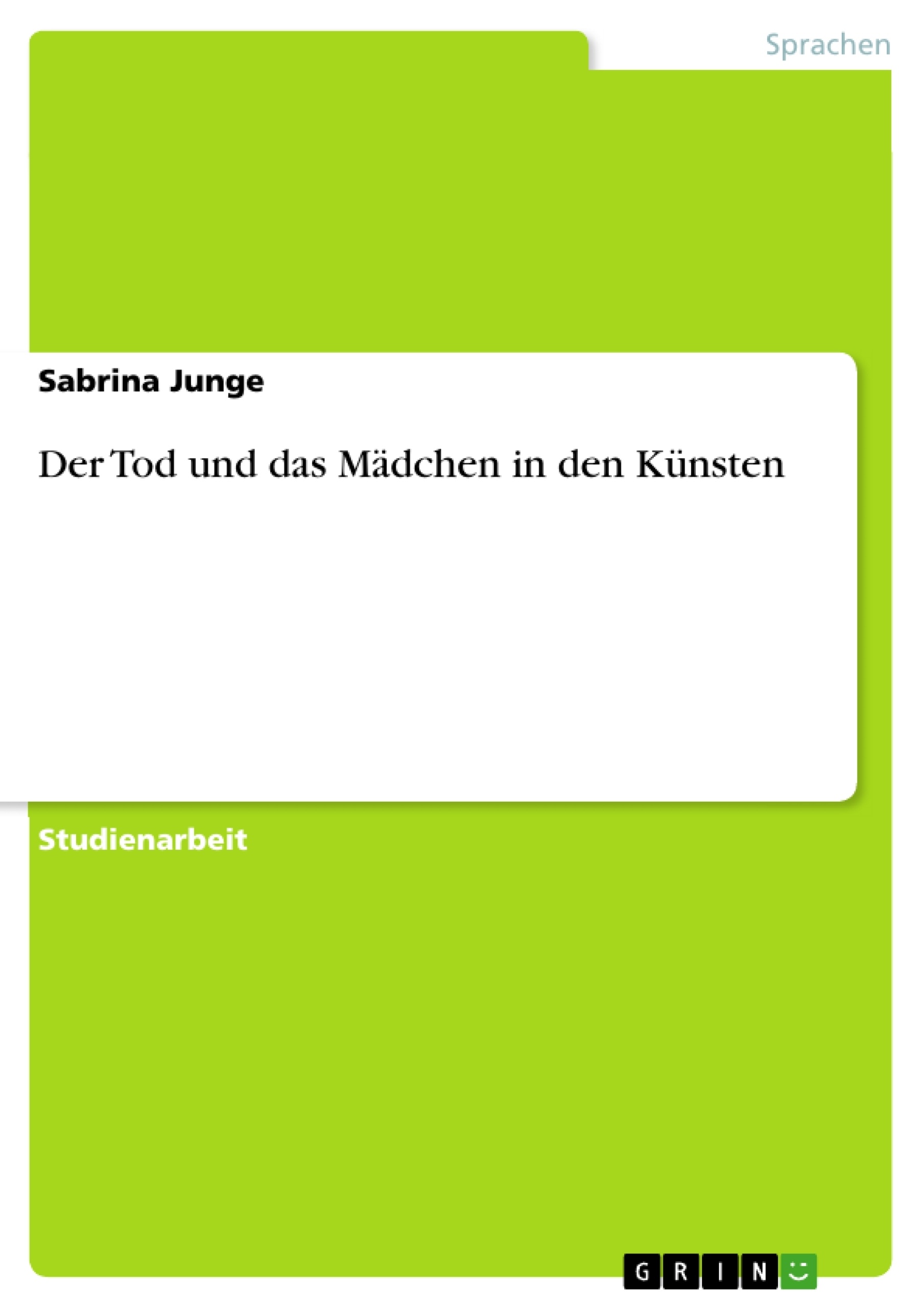“Vor jedem Menschen steht der Tod wie ein großer dunkler Torbogen: drohend und furchterregend dem einen, mahnend anderen oder auch lockend oder als willkommener Ausweg aus Trübsal, Angst und Leid.” Der Tod beschäftigte schon damals wie heute die Menschheit. Jeder muss sich ihm eines Tages stellen und doch pflegen Alle eine andere Einstellung zu ihm. Viele fürchten ihn, andere sehnen ihn herbei. Fakt ist, Gevater Tod hat Konjunktur! In einigen Phasen fast totgeschwiegen, begleitet er uns heute in alltäglichen Diskussionen über Sterbehilfe und den humanen Tod. Auch in der Literatur findet er großen Anklang. So ist der Knochenmann, alleine oder in Verbindung mit anderen Themen, eine der am häufigsten dargestellten Thematiken in Kunst und Literatur. Dabei geht der Tod eine besondere Verbindung mit dem Tanz ein. Eine der berühmtesten Darstellungsformen sind die sogenannten Totentänze, in denen der Sensenmann uns seine verschiedenen Gesichter präsentiert. Entstehungsort und- zeitraum sind umstritten, jedoch sieht die Mehrheit der Experten den Totentanz in Frankreich entstanden. Wichtigster Ausgangspunkt sind dabei die “Danse macabre” aus dem Jahre 1424. “Durch solche Allgegenwart des Motivs […] wird der Tod im 16. Jahrhundert „zu einer Gestalt des täglichen Lebens“[...]. Der Tod wird zum Nachbarn im Guten wie im Bösen“. Doch lange Zeit außer Acht gelassen, wurde das erotische Motiv Der Tod und das Mädchen. Zwar bereits in vorherigen Totentänzen präsent, wird in Niklaus Manuels Berner Totentanz dieses Sujet deutlich verstärkt. Nie zuvor war der Zusammenprall von Leben und Tod deutlicher verbildlicht worden.
Dieses Leitmotiv soll auch im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen. Doch wie hat sich der Leitgedanke Der Tod und das Mädchen seit dem späten Mittelalter bis in die Gegenwart verändert? Und wie wird es in den verschiedenen Werken interpretiert? Um Entstehung und Entwicklung dieses Leitmotivs in den Künsten erklären zu können, werde ich zunächst auf die Totentänze eingehen um danach zu Matthias Claudius’ Werk „Der Tod und das Mädchen“ und zu der Vertonung dieses Gedichtes durch Franz Schubert zu kommen...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Tod und das Mädchen als Leitmotiv
- Matthias Claudius' der „Tod und das Mädchen“
- Claudius' Einstellung zum Tod und Freund Hain
- Leitmotiv in „Der Tod und das Mädchen“ (1775)
- Musikalische Vertonung durch Schubert
- Einstellung und Umstände
- Leitmotiv in Schuberts musikalischer Vertonung des Gedichts
- Intermedialität und Leitmotiv in „La doncella y la muerte“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Leitmotivs „Der Tod und das Mädchen“ von seinen Anfängen im späten Mittelalter bis in die Gegenwart. Sie analysiert verschiedene künstlerische Interpretationen, insbesondere die von Matthias Claudius und Franz Schubert, sowie deren intermediale Beziehungen zu späteren Werken. Der Fokus liegt auf der Veränderung der Darstellung des Todes und des Verhältnisses zwischen Leben und Tod im Laufe der Zeit.
- Entwicklung des Motivs „Der Tod und das Mädchen“ in Kunst und Literatur
- Analyse der Interpretationen in verschiedenen Epochen
- Vergleich der Darstellungen des Todes (z.B. als Schrecken, als Freund, als Liebhaber)
- Die Rolle der Intermedialität in der Weiterentwicklung des Motivs
- Der Einfluss der Aufklärung und Romantik auf die Darstellung des Todes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „Der Tod und das Mädchen“ ein und beschreibt die historische Entwicklung des Motivs in der Kunst, insbesondere in den Totentänzen. Sie erläutert die Bedeutung des Motivs als Ausdruck der Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit und dessen unterschiedliche Interpretationen im Laufe der Geschichte, von Schrecken bis hin zur Akzeptanz und sogar zur Erotisierung. Die Arbeit kündigt die Analyse von Claudius' Gedicht, Schuberts Vertonung und Dorfmans Stück an, um die Wandlung des Motivs nachzuvollziehen. Der Tod wird als allgegenwärtiges Thema dargestellt, welches in verschiedenen Kulturepochen unterschiedlich interpretiert wurde.
Der Tod und das Mädchen als Leitmotiv: Dieses Kapitel untersucht den Totentanz als Ursprung des Motivs. Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte und die verschiedenen Darstellungsformen des Todes, vom schrecklichen Sensenmann bis hin zum freundlichen Begleiter oder gar Liebhaber. Der Wandel der Interpretationen vom „Memento mori“ zum erotischen Motiv wird detailliert analysiert, wobei die Bedeutung der Pestwellen und der kulturellen Veränderungen hervorgehoben werden. Es wird argumentiert, dass die Darstellung des Todes von einer ursprünglichen Furcht vor dem Tod zu einer ambivalenten und oft erotisch aufgeladenen Beziehung zwischen Tod und Leben entwickelt hat.
Schlüsselwörter
Der Tod und das Mädchen, Totentanz, Matthias Claudius, Franz Schubert, Ariel Dorfman, Intermedialität, Todeserotik, Memento Mori, Aufklärung, Romantik, Thanatos, Eros.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Tod und das Mädchen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Leitmotivs "Der Tod und das Mädchen" von seinen Anfängen im späten Mittelalter bis in die Gegenwart. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener künstlerischer Interpretationen, insbesondere von Matthias Claudius und Franz Schubert, sowie deren intermedialen Beziehungen zu späteren Werken. Die Arbeit analysiert die Veränderung der Darstellung des Todes und des Verhältnisses zwischen Leben und Tod im Laufe der Zeit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Motivs "Der Tod und das Mädchen" in Kunst und Literatur, die Analyse der Interpretationen in verschiedenen Epochen, den Vergleich der Darstellungen des Todes (z.B. als Schrecken, als Freund, als Liebhaber), die Rolle der Intermedialität in der Weiterentwicklung des Motivs und den Einfluss der Aufklärung und Romantik auf die Darstellung des Todes.
Welche Quellen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert das Gedicht "Der Tod und das Mädchen" von Matthias Claudius, die musikalische Vertonung von Franz Schubert und (implizit) spätere Werke, die das Motiv aufgreifen. Der Totentanz als Ursprungsmotiv wird ebenfalls untersucht. Ein spezifisches Stück von Ariel Dorfman wird erwähnt, jedoch nicht im Detail behandelt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die das Thema einführt und die historische Entwicklung des Motivs beschreibt. Es folgt eine detaillierte Analyse des Motivs "Der Tod und das Mädchen" als Leitmotiv, einschließlich einer Untersuchung des Totentanzes und des Wandels der Interpretationen im Laufe der Zeit. Die Arbeit untersucht Claudius' Gedicht und Schuberts Vertonung und diskutiert die Intermedialität. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Der Tod und das Mädchen, Totentanz, Matthias Claudius, Franz Schubert, Ariel Dorfman, Intermedialität, Todeserotik, Memento Mori, Aufklärung, Romantik, Thanatos, Eros.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen für die Einleitung, in der das Thema und seine historische Entwicklung vorgestellt werden. Eine Zusammenfassung des Kapitels zum Leitmotiv "Der Tod und das Mädchen" beschreibt die Entwicklung vom "Memento Mori" hin zu einer ambivalenten und oft erotisch aufgeladenen Beziehung zwischen Tod und Leben.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die Entwicklung des Leitmotivs "Der Tod und das Mädchen" nachzuvollziehen und die verschiedenen künstlerischen Interpretationen sowie deren intermediale Beziehungen zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Veränderung der Darstellung des Todes und des Verhältnisses zwischen Leben und Tod im Laufe der Geschichte.
- Quote paper
- Sabrina Junge (Author), 2014, Der Tod und das Mädchen in den Künsten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273430