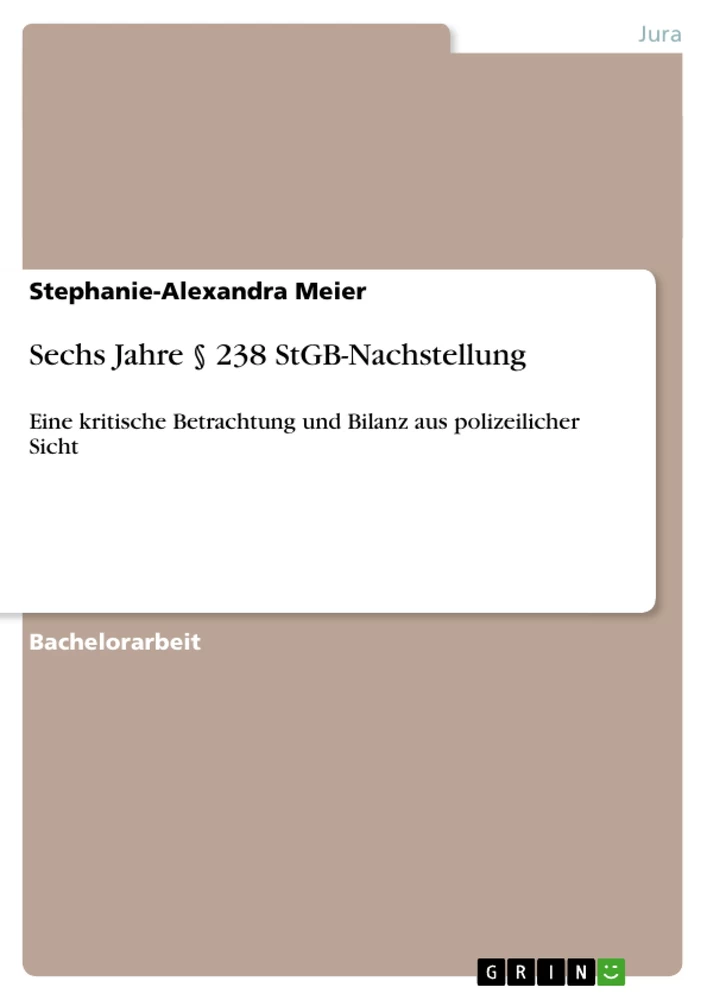Mein Interesse zur vorbenannten Thematik besteht bis zum heutigen Zeitpunkt, da mein Mann und ich vor Einführung des § 238 StGB selbst einmal Belästigungen eines uns zunächst fremden Mannes ausgesetzt waren. Dieser Mann suchte die Nähe unseres Hauses auf, hinterließ Zettel im Briefkasten und nahm weitere störende Handlungen vor. Die Vorstellung, dass in der Nacht eine Person um unser Haus schleicht, die möglicherweise gewalttätig werden könnte, löste bei mir Unbehagen aus. Zu diesem Zeitpunkt war der § 238 StGB noch nicht in das Strafgesetzbuch aufgenommen worden. Die Polizei hatte zum damaligen Zeitpunkt keine Interventionsmöglichkeiten bei Nachstellungen, die keinen Straftatbestand des StGB oder Ordnungswidrigkeit nach dem OWIG erfüllten sowie keine Annahmen von Gefahren für u.a. Leib oder Leben einer Person begründeten. Das am 01.01.2002 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung des zivilrechtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellung (GewSchG) gibt Opfern die Möglichkeit auf zivilrechtlichem Wege einstweilige Verfügungen durch das Gericht zu erwirken. Von dieser Möglichkeit haben wir zum damaligen Zeitpunkt keinen Gebrauch gemacht. Hätten wir beispielsweise ein gerichtliches Annäherungsverbot gegen den Stalker erwirkt, so wäre jeder Verstoß dagegen eine Straftat nach § 4 GewSchG, den wir hätten anzeigen können. Im GewSchG waren zum damaligen Zeitpunkt bereits die unzumutbaren Belästigungen durch Nachstellung aufgenommen worden. Unser Problem löste sich dann aufgrund eines anstehenden Umzuges von allein.
Weiterhin habe ich als Polizeibeamtin den Leidensdruck einiger Opfer wahrgenommen, welcher vor Einführung des GewschG und des § 238 StGB vorhanden war, weil hier in vielen Fällen keine Hilfe erfolgen konnte. Die Problematik der bestehenden Gesetzeslücke wurde hier besonders deutlich. Aktuell wurde mein Interesse, insbesondere aufgrund des folgenden und bisher deutschlandweit einmaligen Beschlusses, erneut hervorgerufen. Der folgende Fall wurde aufgrund des GewSchG entschieden.
Am 14.3.2013 erschien ein Zeitungsartikel “Stalker kommt hinter Gitter“. Erstmalig in der Rechtsgeschichte verhängte der Familienrichter des Amtsgerichts Bielefeld, Herr Bünemann, ggü. einem Stalker 720 Tage Ordnungshaft. Vorausgegangen war, dass sich eine Frau nach einem Jahr Beziehung im Januar 2012 von ihrem Partner getrennt hatte und im Mai unmissverständlich darauf hinwies sowie den Kontakt gänzlich einstellte. ....
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Phänomenologie
- 2.1 Allgemeine Angaben
- 2.1.1 Begriffserklärung Stalking
- 2.1.2 Begriffserklärung „Täter“ / „Opfer“
- 2.1.3 Begriffserklärung „Opferschutz“ / „wirksamer Schutz“
- 2.1.4 Kriminalpolitische Bedeutung von Stalking
- 2.1.5 Überblick zur Rechtslage des §§ 1 ‐ 4 Gewaltschutzgesetzes
- 2.1.6 Rechtslage / Hintergründe / Kritikpunkte zu § 238 StGB
- 2.1.7 Polizeiliche Kriminalstatistik
- 2.1.7.1 Polizeiliches Hellfeld / Dunkelfeld
- 2.1.7.2 Häufigkeit in der Polizeilichen Kriminalstatistik
- 2.1.8 Strafverfolgungsstatistik / Abgeurteilte / Verurteilte
- 2.2 Tatopfer
- 2.2.1 Risikogruppen von Opfern
- 2.3 Täter
- 2.3.1 Tätertypologien
- 2.3.2 Täter‐Opfer‐Beziehungen
- 2.1 Allgemeine Angaben
- 3. Modus Operandi
- 3.1. Stalkinghandlungen
- 4. Folgen für die Opfer
- 5. Studien
- 5.1 Mannheimer Studie / Darmstädter Studie
- 5.2 Vergleiche der nationalen und internationalen Studien und der PKS
- 6. Polizeiliche Intervention
- 6.1 Polizeiliche Interventionsmöglichkeiten vor und nach der Einführung des § 238 StGB
- 6.2 Polizeiliche Prävention
- 6.2.1 Verhinderung von Gewalteskalation bei Beziehungsgewalt und Stalking
- 6.2.2 Handlungsempfehlungen des AK II
- 7. Wirksamkeit von Anti‐Stalking‐Gesetzen
- 8. Auswahl der Forschungsmethode / Experteninterview
- 8.1 Vorüberlegung / Expertenauswahl
- 8.2 Beschreibung der Forschungsmethode
- 8.2.1 Auswahl der Fragetypen / Fragestellungen
- 8.3 Durchführung der Experteninterviews
- 8.4 Darstellung der Fragen / Auswertung der Interviews
- 8.5 Opferbefragung
- 8.6 Zusammenfassende Erkenntnis
- 8.6.1 Positive Aspekte
- 8.6.2 Negative Aspekte
- 8.6.3 Forderungen
- 8.6.4 Wirksamer Schutz für die Opfer
- 8.6.5 Zusammenarbeit mit der Polizei / Bedeutung der Einstellungszahlen für die Polizei
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht kritisch die Auswirkungen der Einführung des § 238 StGB ("Nachstellung") auf den Opferschutz vor Stalking in Deutschland. Die Arbeit analysiert die Wirksamkeit des Gesetzes sechs Jahre nach seiner Inkraftsetzung und beleuchtet die Herausforderungen bei der Strafverfolgung.
- Wirksamkeit des § 238 StGB im Opferschutz
- Herausforderungen bei der Strafverfolgung von Stalkingdelikten
- Polizeiliche Interventions- und Präventionsmaßnahmen
- Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz und Opferhilfeorganisationen
- Möglichkeiten zur Verbesserung des Opferschutzes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit beginnt mit einer persönlichen Erfahrung der Autorin mit Stalking vor der Einführung des § 238 StGB, die ihr Interesse an der Thematik weckte. Sie beschreibt die Gesetzeslücke, die zu diesem Zeitpunkt bestand, und die damit verbundenen Schwierigkeiten für Opfer. Der Fall eines Stalkers, der zu einer beispiellosen Ordnungshaft verurteilt wurde, wird als Ausgangspunkt der Arbeit vorgestellt und dient als Fallstudie. Die zentralen Forschungsfragen der Arbeit werden formuliert: Wurde durch die neue Rechtslage ein wirksamer Schutz für Opfer von Stalking erreicht? Was führt zu der hohen Einstellungsquote des § 238 StGB, und in welchem Kontext steht dies zur polizeilichen Arbeit?
2. Phänomenologie: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Phänomen Stalking. Es werden verschiedene Definitionen von Stalking aus klinischer und juristischer Sicht vorgestellt, die Herausforderungen bei der Definition des Delikts werden diskutiert und die Bedeutung des Opferwillens hervorgehoben. Die kriminalpolitische Entwicklung und der Wandel des Strafrechts hin zu einem stärker opferorientierten Ansatz werden erläutert. Die Rechtslage des Gewaltschutzgesetzes (GewSchG) und des § 238 StGB wird detailliert beschrieben, einschließlich der Kritikpunkte und der Schwierigkeiten bei der Anwendung. Statistiken der Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) und Strafverfolgungsstatistik werden analysiert. Schließlich werden Opfer- und Täterprofile vorgestellt, inklusive verschiedener Tätertypologien und der Bedeutung der Täter-Opfer-Beziehung.
3. Modus Operandi: Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Arten von Stalkinghandlungen, von milden bis hin zu schweren, gewalttätigen Formen. Es werden Beispiele für Stalkinghandlungen aufgeführt und die unterschiedlichen Kategorien von Stalking nach verschiedenen Autoren differenziert.
4. Folgen für die Opfer: Dieses Kapitel beleuchtet die schwerwiegenden physischen, psychischen und sozialen Folgen von Stalking für die Opfer. Es werden die Auswirkungen auf die Lebensqualität, die psychische Gesundheit und den sozialen Alltag der Betroffenen detailliert beschrieben und mit wissenschaftlichen Studien belegt.
5. Studien: Hier werden die Mannheimer und Darmstädter Studien, die größten wissenschaftlichen Untersuchungen zu Stalking im deutschsprachigen Raum, vorgestellt und ihre Ergebnisse im Detail verglichen. Die Übereinstimmungen und Unterschiede der Studien werden analysiert, sowie deren Bedeutung für das Verständnis des Phänomens Stalking.
6. Polizeiliche Intervention: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der Polizei bei der Intervention in Stalkingfällen. Es wird die Unterscheidung zwischen Gefahrenabwehr und Opferschutz erläutert, sowie die Interventionsmöglichkeiten vor und nach der Einführung des § 238 StGB beschrieben. Die Bedeutung von präventiven Maßnahmen und Gefährdungsanalysen wird hervorgehoben, und die Handlungsempfehlungen des AK II werden erläutert.
7. Wirksamkeit von Anti-Stalking-Gesetzen: Das Kapitel untersucht die Wirksamkeit von Anti-Stalking-Gesetzen in den USA und im deutschsprachigen Raum auf Basis von Opferbefragungen. Die Ergebnisse dieser Studien werden analysiert und verglichen.
8. Auswahl der Forschungsmethode / Experteninterview: Die Autorin beschreibt die gewählte Forschungsmethode – Experteninterviews – und die Auswahl der Interviewpartner (Weißer Ring, Staatsanwältin, Richter, Polizeibeamter, Opferschutzbeauftragte, Opfer). Der Ablauf und die Methodik der Interviews werden detailliert erläutert. Die Auswertung der Interviews erfolgt tabellarisch und wird zusammenfassend dargestellt. Die positiven und negativen Aspekte, Forderungen und Erkenntnisse werden systematisch dargestellt.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Auswirkungen des § 238 StGB auf den Opferschutz vor Stalking
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch die Auswirkungen der Einführung des § 238 StGB ("Nachstellung") auf den Opferschutz vor Stalking in Deutschland sechs Jahre nach seiner Inkraftsetzung. Sie analysiert die Wirksamkeit des Gesetzes und beleuchtet die Herausforderungen bei der Strafverfolgung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Wirksamkeit des § 238 StGB im Opferschutz, Herausforderungen bei der Strafverfolgung von Stalkingdelikten, Polizeiliche Interventions- und Präventionsmaßnahmen, Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz und Opferhilfeorganisationen, Möglichkeiten zur Verbesserung des Opferschutzes, Phänomenologie des Stalkings (Definitionen, Opfer- und Täterprofile, Statistiken), Modus Operandi von Stalkinghandlungen, Folgen von Stalking für Opfer, Ergebnisse relevanter Studien (Mannheimer und Darmstädter Studie), und die Auswertung von Experteninterviews.
Welche Forschungsmethode wurde angewendet?
Die Hauptforschungsmethode besteht aus Experteninterviews mit Vertretern des Weißen Rings, Staatsanwälten, Richtern, Polizeibeamten, Opferschutzbeauftragten und Opfern. Die Interviews wurden strukturiert durchgeführt und die Ergebnisse tabellarisch und zusammenfassend dargestellt.
Welche Fragen wurden in den Experteninterviews behandelt?
Die Fragestellungen der Interviews zielten auf die Wirksamkeit des § 238 StGB, die Herausforderungen bei der Strafverfolgung, die polizeilichen Interventions- und Präventionsmaßnahmen, die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen und Möglichkeiten zur Verbesserung des Opferschutzes ab. Die genauen Fragetypen und -stellungen sind im Detail in Kapitel 8.2.1 beschrieben.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert eine umfassende Analyse der Wirksamkeit des § 238 StGB im Opferschutz und identifiziert Herausforderungen bei der Strafverfolgung. Die Auswertung der Experteninterviews zeigt positive und negative Aspekte der aktuellen Rechtslage auf und formuliert Forderungen zur Verbesserung des Opferschutzes. Die Ergebnisse werden systematisch nach positiven und negativen Aspekten, Forderungen und der Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Polizei dargestellt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Phänomenologie des Stalkings, Modus Operandi, Folgen für die Opfer, Studien zum Stalking, Polizeiliche Intervention, Wirksamkeit von Anti-Stalking-Gesetzen und die Beschreibung der Forschungsmethode (Experteninterviews).
Wie wird die Phänomenologie des Stalkings dargestellt?
Das Kapitel "Phänomenologie" liefert einen umfassenden Überblick über Stalking, inklusive Definitionen, Opfer- und Täterprofilen, kriminalpolitischer Entwicklung, Rechtslage (GewSchG und § 238 StGB), sowie statistischen Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und Strafverfolgungsstatistik. Es werden auch die Schwierigkeiten bei der Definition des Delikts und die Bedeutung des Opferwillens diskutiert.
Wie werden die Folgen für die Opfer von Stalking dargestellt?
Die Arbeit beschreibt detailliert die schwerwiegenden physischen, psychischen und sozialen Folgen von Stalking für die Opfer. Die Auswirkungen auf die Lebensqualität, die psychische Gesundheit und den sozialen Alltag werden anhand wissenschaftlicher Studien belegt.
Welche Rolle spielt die Polizei in der Arbeit?
Die Rolle der Polizei bei der Intervention und Prävention von Stalking wird ausführlich behandelt. Die Arbeit beschreibt die Interventionsmöglichkeiten vor und nach der Einführung des § 238 StGB, die Bedeutung von präventiven Maßnahmen und Gefährdungsanalysen sowie die Handlungsempfehlungen des AK II.
Wie wird die Wirksamkeit von Anti-Stalking-Gesetzen untersucht?
Die Wirksamkeit von Anti-Stalking-Gesetzen wird anhand von Studien im deutschsprachigen Raum und den USA untersucht und die Ergebnisse verglichen. Die Arbeit betrachtet insbesondere die Auswirkungen des § 238 StGB auf die Strafverfolgung und den Opferschutz.
- Citar trabajo
- Stephanie-Alexandra Meier (Autor), 2013, Sechs Jahre § 238 StGB-Nachstellung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273477