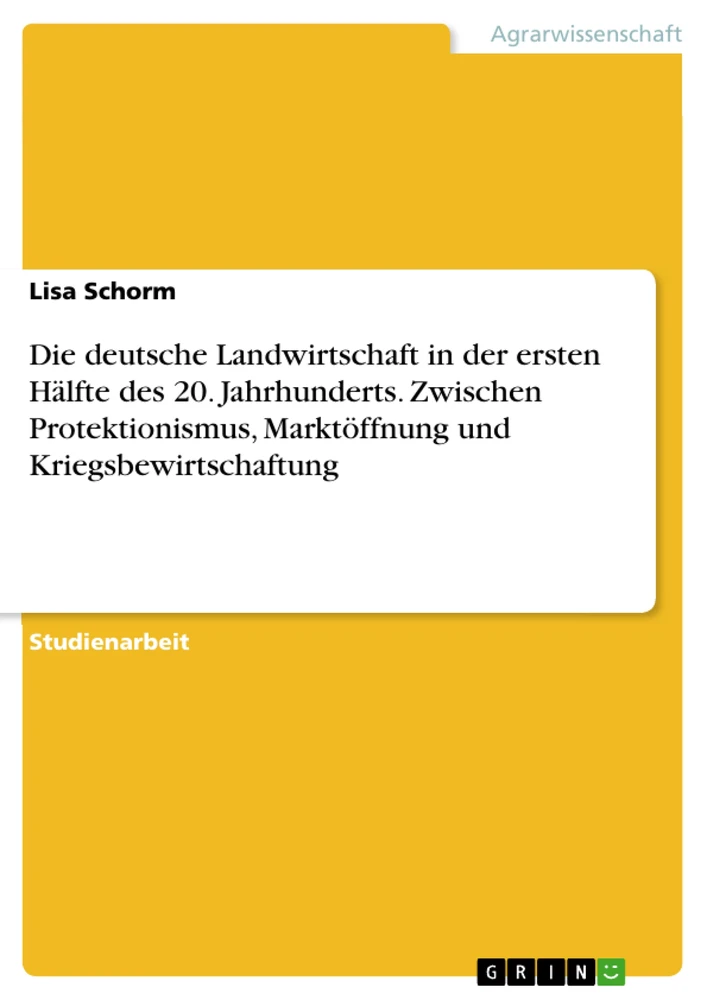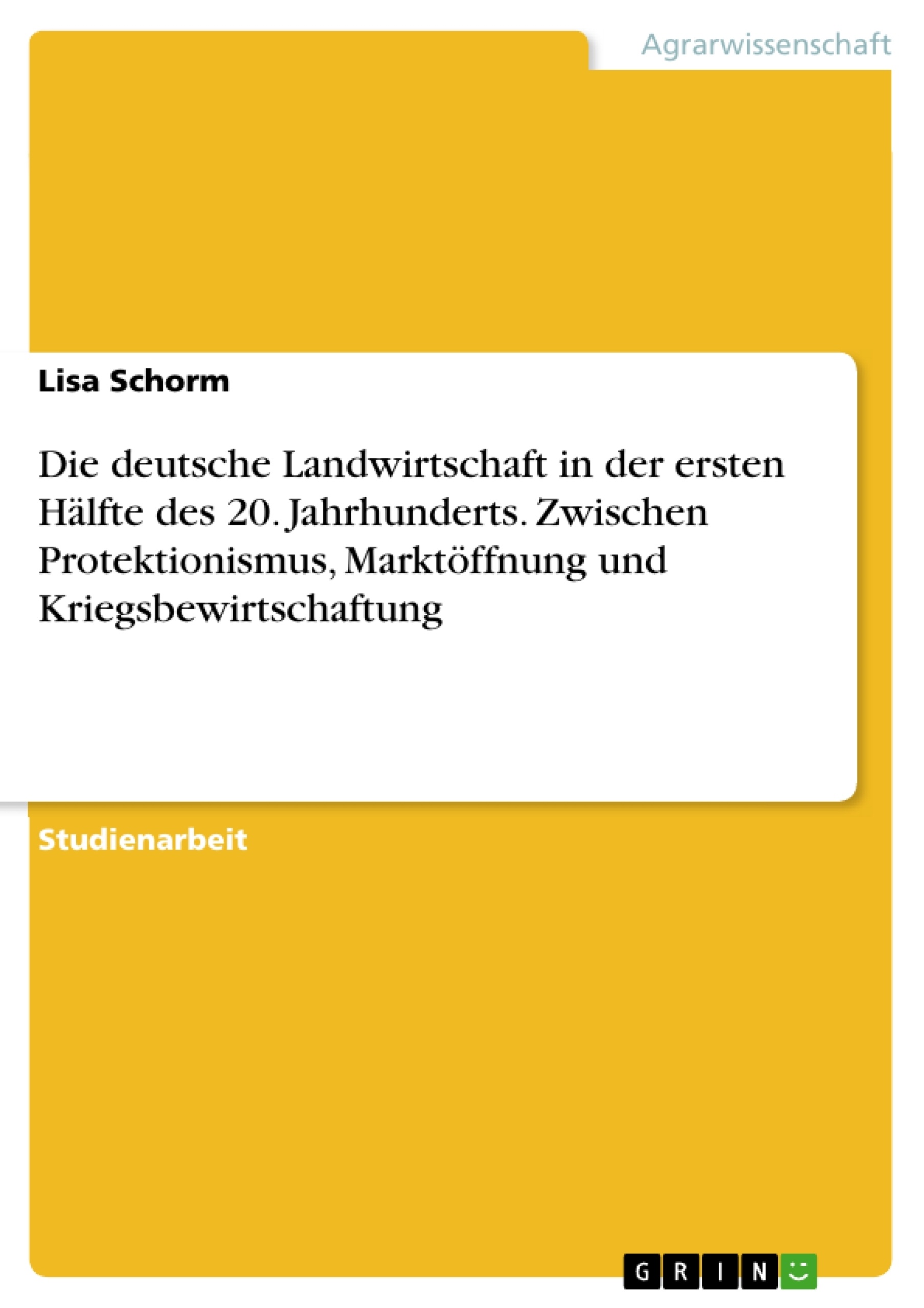Die deutsche Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war geprägt durch viele Veränderungen, die nach und nach zum Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion führten. Angefangen mit dem großen Strukturwandel von Agrarstaat zum Industriestaat und dem damit verbundenen Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft.1 Außerdem den, seit den 1865er / 1875er Jahren einsetzenden, vermehrten Importen von Agrarprodukten – geschuldet dem allgemeinen Anstieg des Im- und Exportwesens, welche, letztens Endes, auch zu einem Sinken der inländischen Agrarproduktion führte.2 Des Weiteren wurde sie geprägt von zwei Weltkriegen, welche die landwirtschaftliche Arbeit behinderten und vor allem bei der Deckung der Nachfrage von Arbeitskräften zu menschenunwürdigen Behandlungen derselben führte.
Die vorliegende Arbeit soll einen Einblick in die deutsche Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geben. Hauptschwerpunkt der Hausarbeit werden die Veränderungen der Betriebsgrößen und Besitzverhältnisse sowie die Arbeitssituation, insbesondere in der Vorkriegszeit bis hin zur Weimarer Republik, sein. Dieser Zeitabschnitt bietet aus meiner Sicht die beste Möglichkeit die Entwicklung der Landwirtschaft, der Betriebe und der Arbeitskräfte zu veranschaulichen.
In meiner Hausarbeit werde ich auf den Wandel von überwiegend großen landwirtschaftlichen Gütern hin zu vielen kleinen Betrieben eingehen. Außerdem werde ich den zunehmenden Arbeitskräftemangel, insbesondere zu Kriegszeiten, in der deutschen Landwirtschaft aufzeigen. Die beiden Schwerpunktthemen habe ich gewählt, weil diese, meiner Ansicht nach, maßgeblich die Veränderungen der deutschen Landwirtschaft zu diesem Zeitpunkt der Geschichtsschreibung markieren, und explizit bezugnehmend auf die Kriegszeiten, einen besonderen Einschnitt im Verlauf der Entwicklung darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorkriegszeit (1870-1919)
- Erster Weltkrieg (1914 – 1918)
- Weimarer Republik (1918 - 1933)
- Ausblick und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der deutschen Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und untersucht insbesondere die Veränderungen der Betriebsgrößen und Besitzverhältnisse sowie die Arbeitssituation. Die Arbeit fokussiert auf den Zeitraum von der Vorkriegszeit bis zur Weimarer Republik, da dieser die Entwicklung der Landwirtschaft, der Betriebe und der Arbeitskräfte am deutlichsten widerspiegelt.
- Der Wandel von überwiegend großen landwirtschaftlichen Gütern hin zu vielen kleinen Betrieben
- Der zunehmende Arbeitskräftemangel, insbesondere zu Kriegszeiten
- Die Rolle der Agrarpolitik im Kontext des Strukturwandels von Agrarstaat zum Industriestaat
- Die Auswirkungen von Importen auf die inländische Agrarproduktion
- Die Bedeutung der Betriebsgrößenstrukturen für die Entwicklung der Landwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung und den Fokus der Arbeit dar. Sie beleuchtet den Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und identifiziert die wichtigsten Einflussfaktoren, wie den Strukturwandel von Agrarstaat zum Industriestaat, den Import von Agrarprodukten und die Auswirkungen der beiden Weltkriege.
- Vorkriegszeit (1870-1919): Dieses Kapitel untersucht die Veränderungen der deutschen Landwirtschaft im Kontext der Industrialisierung und des Wandels vom Agrarstaat zum Industriestaat. Es beleuchtet die Entwicklung der Betriebsgrößenstrukturen, den zunehmenden Arbeitskräftemangel und die Rolle der Agrarpolitik, insbesondere im Hinblick auf die „Innere Kolonisation“.
- Erster Weltkrieg (1914 – 1918): Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf die deutsche Landwirtschaft. Es befasst sich mit der Mobilisierung von Arbeitskräften, den Kriegseinwirkungen auf die Agrarproduktion und den besonderen Herausforderungen der Kriegsbewirtschaftung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der deutschen Landwirtschaft im Wandel, Betriebsgrößenstrukturen, Arbeitskräftemangel, Agrarpolitik, Industrialisierung, Import, Kriegseinwirkungen und Kriegsbewirtschaftung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wandelte sich die deutsche Landwirtschaft Anfang des 20. Jahrhunderts?
Es fand ein massiver Strukturwandel vom Agrarstaat zum Industriestaat statt. Dabei veränderten sich die Betriebsgrößen von überwiegend großen Gütern hin zu vielen kleineren Betrieben.
Was waren die Hauptursachen für den Arbeitskräftemangel?
Der Mangel entstand durch die Abwanderung in die Industrie und verschärfte sich massiv während der beiden Weltkriege durch die Einberufung der männlichen Bevölkerung zum Militärdienst.
Welchen Einfluss hatten Agrarimporte auf die Produktion?
Zunehmende Importe ab den 1860er/1870er Jahren führten zu einem Sinken der inländischen Agrarpreise und drückten letztlich die heimische Produktion.
Was versteht man unter „Innere Kolonisation“?
Dies war ein agrarpolitisches Konzept der Vorkriegszeit, das darauf abzielte, durch die Ansiedlung von Bauern in weniger dicht besiedelten Gebieten die landwirtschaftliche Struktur zu stärken.
Wie wirkte sich der Erste Weltkrieg auf die Landwirtschaft aus?
Der Krieg führte zu einer staatlichen Kriegsbewirtschaftung, extremem Arbeitskräftemangel und behinderte die reguläre Bewirtschaftung der Flächen massiv.
- Quote paper
- Lisa Schorm (Author), 2013, Die deutsche Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zwischen Protektionismus, Marktöffnung und Kriegsbewirtschaftung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273569