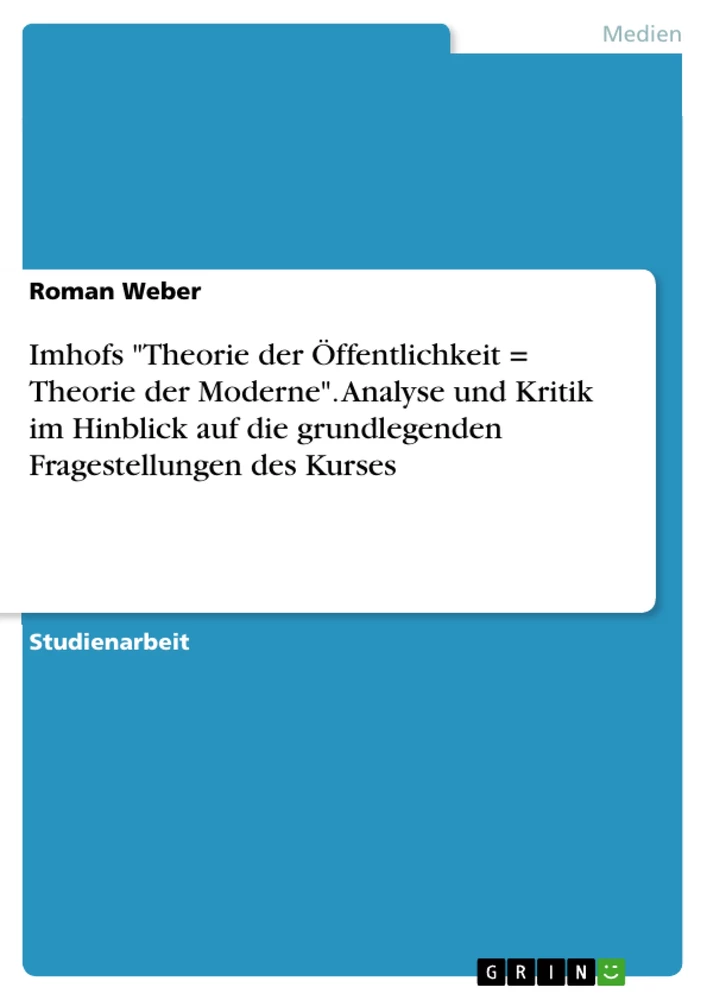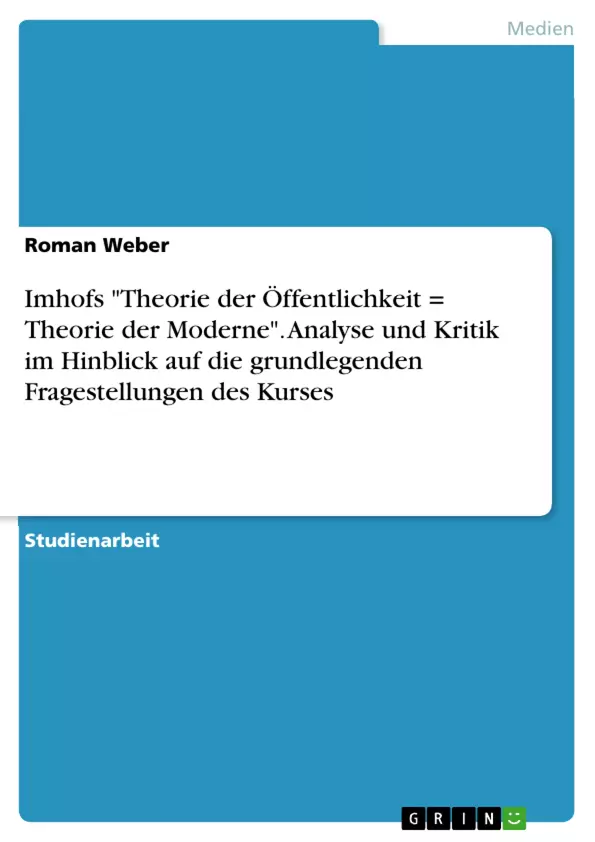Bei der Analyse und der Reflexion des Textes von Imhof und den übrigen einbezogenen Texten aus den Präsentationen des Kurses sind spezifische Fragen jeweils mitzudenken, um diese Fragen im Schlussteil meiner Arbeit aufzugreifen und zu klären. Die zentralen, übergreifenden Fragestellungen des Kurses stehen bei Argumentation und Stringenz im Vordergrund. Hierbei sind folgende Fragen jeweils mit zu betrachten:
Wie verändert sich die öffentliche politische Kommunikation?
Was sind die Ursachen dieses Wandels?
Welche Effekte zeitigt er auf politische Akteure und auf den politischen Entscheidungsfindungsprozess?
Entscheidend für die Arbeit ist nun herauszufinden, ob und in welchem Ausmass der Text für diese grundlegenden themenübergreifenden Fragestellungen Antworten liefert und wie diese Antworten zu bewerten sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- 2.1 Funktionen der Öffentlichkeit
- 2.2 Arenen: Kommunikationsflüsse und Akteure
- 2.3 Neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und Medialisierung
- Schlussteil
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Kernthesen, Standpunkte und Zusammenhänge im Text „Theorie der Öffentlichkeit = Theorie der Moderne" von Imhof (2006). Die Arbeit setzt die Stand- und Streitpunkte des Textes in Korrelation mit anderen Texten des Kurses und beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Argumentation der Autorinnen und Autoren. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Auslegungen von Begriffen und analysiert die Relevanz des Textes für die grundlegenden Fragestellungen des Kurses.
- Funktionen der Öffentlichkeit in der Moderne
- Strukturwandel der Öffentlichkeit
- Medialisierung der politischen Kommunikation
- Der Einfluss der Medien auf den politischen Entscheidungsprozess
- Die Rolle der Öffentlichkeit in der demokratischen Entscheidungsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Abschnitt des Textes betont Imhof die Relevanz der aufklärerischen Prozesse, die sich aufgrund der Französischen Revolution Bahn brachen. Er argumentiert, dass sich Bürgerinnen und Bürger im Sinne Kants als Autoren der Gesetze und Institutionen betrachten können, denen sie sich selbst unterwerfen. Die Öffentlichkeit, so Imhof, ist der Ort, an dem das, was wir im politischen Sinne Gesellschaft nennen, beobacht- und gestaltbar ist (Imhof 2006: 1). Diese Verschränkung von politischer Öffentlichkeit, politisch-rechtlichem Geltungsbereich und des nach Weber (1922) für eine Nation identitätsstiftenden „Gemeinsamkeitsglaubens" sei in den deliberativen, den politisch-rechtlichen und den sozialintegrativen Normen und dem aufgeklärten Öffentlichkeitsverständnis geschuldet (vgl. Imhof 2006: 1).
Imhof erläutert die drei Dimensionen der Öffentlichkeit: die deliberative, die politisch-rechtliche und die sozialintegrative Dimension. Er betont, dass die Integration und gleichberechtigte Teilhabe aller Mitglieder der Gesellschaft in allen drei Dimensionen immer gewährleistet sein müsse (vgl. Habermas 2006: 413), ansonsten „eine Öffentlichkeit, von der abgrenzbare Gruppen eo ipso ausgeschlossen wären, nicht etwa nur unvollständig ist, sie ist vielmehr gar keine Öffentlichkeit" (Habermas 1990 [1962]: 156, zit. nach Imhof 2006: 3).
Imhof geht auf die Funktionen der Öffentlichkeit ein und gliedert sie in die drei Dimensionen: die Entdeckungs- und Validierungsfunktion der öffentlichen Kommunikation innerhalb des deliberativen Verfahrens (vgl. Imhof 2006: 6-7), die Legitimationsfunktion politischer Macht durch Wahlen (vgl. Imhof 2006: 7) und die Funktion der Öffentlichkeit als Zugangsportal für alle Mitglieder der Gesellschaft, die Problemlösungsansätze generiert (vgl. Imhof 2006: 7). Die Öffentlichkeit spielt also eine zentrale Rolle in der demokratischen Entscheidungsfindung und ist an die moralische und kognitive Dimension der Kommunikation im deliberativen Verfahren gekoppelt (vgl. Imhof 2006: 5).
Imhof analysiert die Arenen, Kommunikationsflüsse und Akteure der Öffentlichkeit. Er betont die Bedeutung der Medien als spezialisierte Organisationen innerhalb eines eigenlogischen Teilsystems, die Kommunikation auf Dauer stellen (vgl. Imhof 2006: 13). Die Kommunikation ist nach Imhof (2008: 9) als „Verständigungspraxis über Problematisches in dieser Welt" und somit auch als Wissensprozess anzusehen. Er beleuchtet die antifeudalistische Entkoppelung der Ökonomie von der Politik an der Schwelle zur Moderne und die einhergehende Ausdifferenzierung des Mediensystems vom politischen System (vgl. Imhof 2006: 13).
Imhof beschreibt den neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit, der insbesondere die zunehmende ökonomische Ausrichtung von Medienorganisationen aufzeigt (vgl. Imhof 2006: 20). Er analysiert die funktionale, stratifikatorische und segmentäre Differenzierung, die durch den neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit entsteht. Die Medialisierungseffekte in der Dimension der funktionalen Differenzierung zeigen sich in einer ausgeprägten Exekutivorientierung und einer Zunahme der Skandalisierungsbewirtschaftung (vgl. Imhof 2006: 22). In der Dimension der stratifikatorischen Differenzierung beobachtet Imhof (2006: 23) „an den Rändern der Zentrumsgesellschaften [...] neue, eigenständige und abgeschottete Kommunikationsarenen und sekundäre Desintegrationsprozesse, die zu einer nachhaltigen Reduktion der Chancengleichheit führen".
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Theorie der Öffentlichkeit, die Theorie der Moderne, den Strukturwandel der Öffentlichkeit, die Medialisierung, die Funktionen der Öffentlichkeit, die deliberative Demokratie, die politisch-rechtliche Dimension, die sozialintegrative Dimension, die Medien, die Kommunikation, die politische Kommunikation, der politische Entscheidungsprozess, die Legitimität und die Demokratie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Imhofs "Theorie der Öffentlichkeit"?
Imhof postuliert, dass die Theorie der Öffentlichkeit untrennbar mit der Theorie der Moderne verbunden ist, wobei die Öffentlichkeit als Ort der demokratischen Gestaltung und Beobachtung der Gesellschaft dient.
Welche drei Dimensionen der Öffentlichkeit nennt Imhof?
Er unterscheidet die deliberative (Verständigung), die politisch-rechtliche (Legitimation) und die sozialintegrative Dimension (Zugang für alle).
Was bedeutet "Medialisierung" im Kontext der politischen Kommunikation?
Medialisierung beschreibt den Prozess, bei dem sich politische Akteure und Prozesse zunehmend an der Logik und den Bedürfnissen der Massenmedien orientieren, was zu Effekten wie Skandalisierung führt.
Wie verändert der neue Strukturwandel die Öffentlichkeit?
Der Wandel ist durch eine zunehmende Ökonomisierung der Medien und eine Fragmentierung der Kommunikationsarenen geprägt, was die Chancengleichheit und soziale Integration gefährden kann.
Welche Rolle spielen Medien für die Demokratie laut Imhof?
Medien fungieren als spezialisierte Organisationen, die Kommunikation verstetigen und als "Entdeckungsagenturen" für gesellschaftliche Probleme dienen, um politische Legitimität zu ermöglichen.
- Quote paper
- Master of Arts UZH Roman Weber (Author), 2010, Imhofs "Theorie der Öffentlichkeit = Theorie der Moderne". Analyse und Kritik im Hinblick auf die grundlegenden Fragestellungen des Kurses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273584