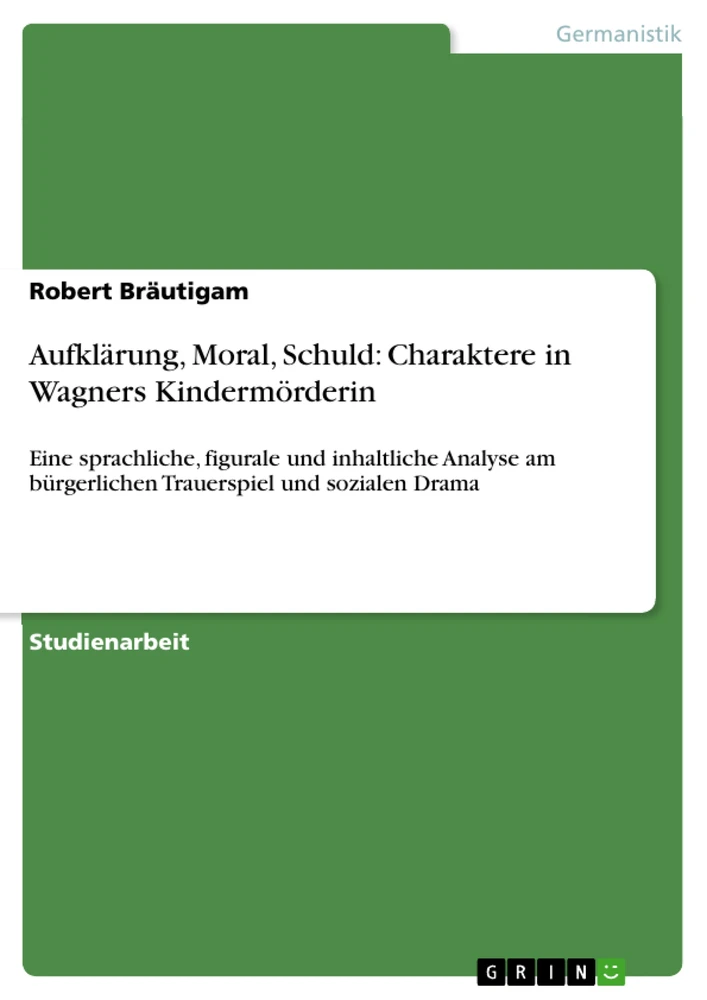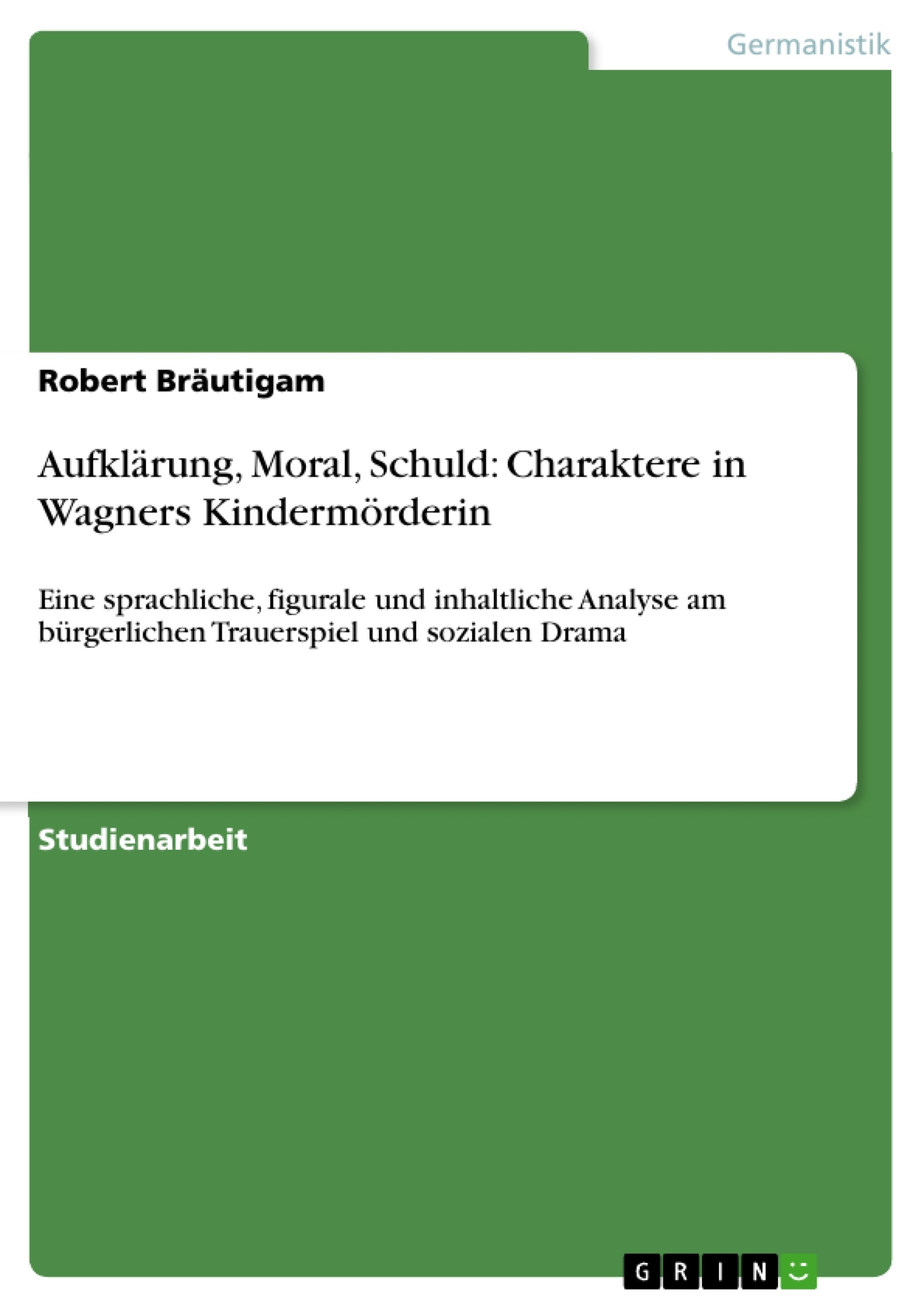Die „Geniezeit“ gilt als einer der dynamischsten Epochen in der deutschen Literaturgeschichte. Sie lässt sich in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts ansiedeln und steht neben den politischen und wirtschaftlichen Formen des Absolutismus und Merkantilismus sowie den geistesgeschichtlichen Strömungen der Aufklärung und Empfindsamkeit als eigenständige literarische Epoche: Es handelt sich
um die Zeit des Sturm und Drang.
Getragen vom aufklärerischen Gedankengut der Perfektibilität des Menschen übten Literaten während der Sattelzeit vehement Kritik an feudalen und gesellschaftlichen Missständen. Diese richtete sich vorsätzlich an die Fürsten und deren Machtmissbrauch und wurde auch durch die Frage nach der Legitimierung adliger Sonderrechte durch die Geburt konkretisiert. Das or allem vom jungen Bürgertum als erstarrt empfundene Ständesystem und dessen Grenzen galten als überholt. Die Dynamik der Epoche zeigte sich in der Herausbildung neuer Moden, Verhaltensweisen und Stile sowie in neuen naturwissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnissen. Auch im literarischen Bereich ließ sich eine Neuerung feststellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachvariationen und treibende Faktoren für Evchens Katastrophe
- Sprache und Charaktere
- Offiziere (Adel)
- Gröningseck
- Hasenpoth
- Familie Humbrecht (Bürgertum)
- Evchen
- Martin Humbrecht
- Frau Humbrecht
- Magister
- Sonstige Personen
- Offiziere (Adel)
- Treibende Faktoren für Evchens Katastrophe
- Humbrecht als moralisierende Instanz
- Frau Humbrecht – gesellschaftlicher Aufstieg vor Fürsorge?
- Gröningseck: Mitschuld an der Katastrophe?
- Gesellschaftliche Strafpraxis im 18. Jahrhundert und der Umgang mit Kindermörderinnen
- Die Melancholie Evchens - Liebe-Leid-Thematik
- Sprache und Charaktere
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Wagners „Kindermörderin“ aus dem Jahr 1776, ein Werk, das die soziale Not der unteren Schichten und das ethisch verwerfliche Thema des Kindsmords beleuchtet. Ziel der Analyse ist es, sprachliche Besonderheiten im zweiten, dritten und vierten Akt des Dramas zu untersuchen und diese für eine Einschätzung der Charaktere zu nutzen. Die Analyse soll zudem klären, welche Faktoren zu Evchens Katastrophe geführt haben, ob sie Opfer von Intrigen wurde und inwiefern ihr Handlungsspielraum durch ihr Umfeld eingeschränkt war.
- Sprachliche Analyse der Charaktere in Wagners „Kindermörderin“
- Die Rolle der sozialen und gesellschaftlichen Faktoren in Evchens Schicksal
- Die Darstellung von Moral und Schuld im bürgerlichen Trauerspiel
- Die Bedeutung der Sprache als Ausdruck von Macht und sozialer Stellung
- Die Frage der Schuld und Verantwortlichkeit in der Tragödie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des bürgerlichen Trauerspiels im Kontext der „Geniezeit“ und der Aufklärung vor. Die „Kindermörderin“ wird als ein Werk seiner Zeit vorgestellt, das die soziale Not der Unterschicht und die Thematik des Kindsmords behandelt. Die Arbeit fokussiert auf die sprachliche Analyse der Charaktere sowie die Faktoren, die zu Evchens Katastrophe führten.
Das Kapitel „Sprachvariationen und treibende Faktoren für Evchens Katastrophe“ untersucht die sprachliche Differenzierung der Charaktere und analysiert deren Sprache im Hinblick auf ihre soziale Stellung und ihre moralischen Werte. Die Analyse fokussiert auf die Sprache der Offiziere, der Familie Humbrecht und anderer Personen im Stück. Es werden treibende Faktoren für Evchens Katastrophe beleuchtet, wie Humbrechts moralisierende Rolle, Frau Humbrechts gesellschaftlicher Aufstieg und Gröningsecks mögliche Mitschuld.
Schlüsselwörter
Bürgerliches Trauerspiel, Kindermörderin, Sprache, Charakteranalyse, Soziale Not, Aufklärung, Moral, Schuld, Gesellschaftliche Faktoren, Strafpraxis, Intrigen, Handlungsspielraum, Katastrophe.
- Citar trabajo
- Robert Bräutigam (Autor), 2011, Aufklärung, Moral, Schuld: Charaktere in Wagners Kindermörderin, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273599