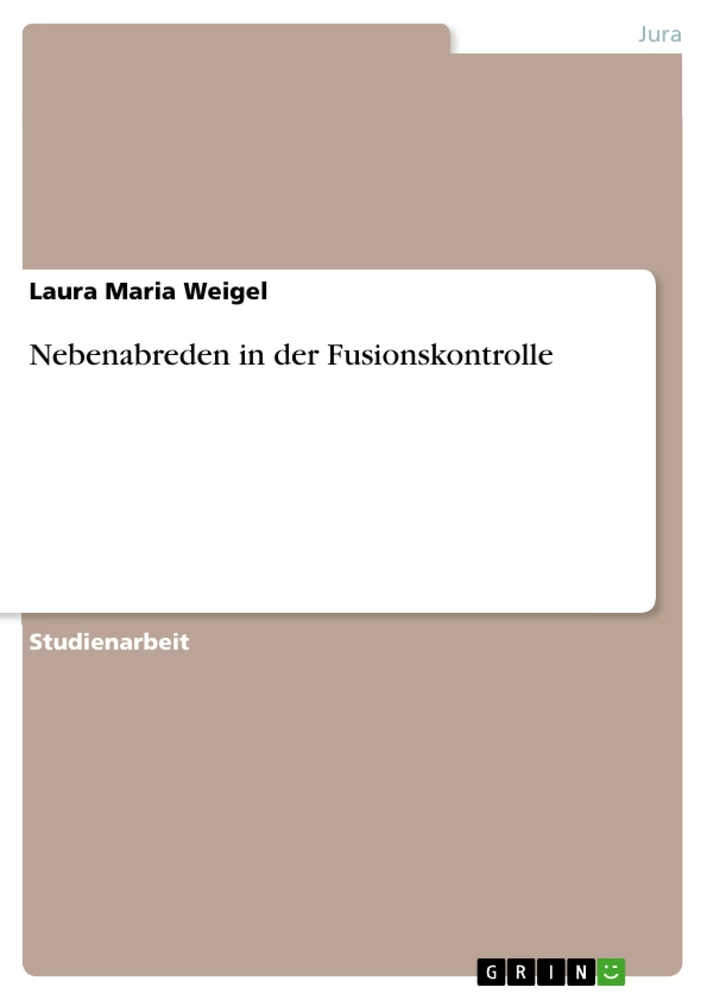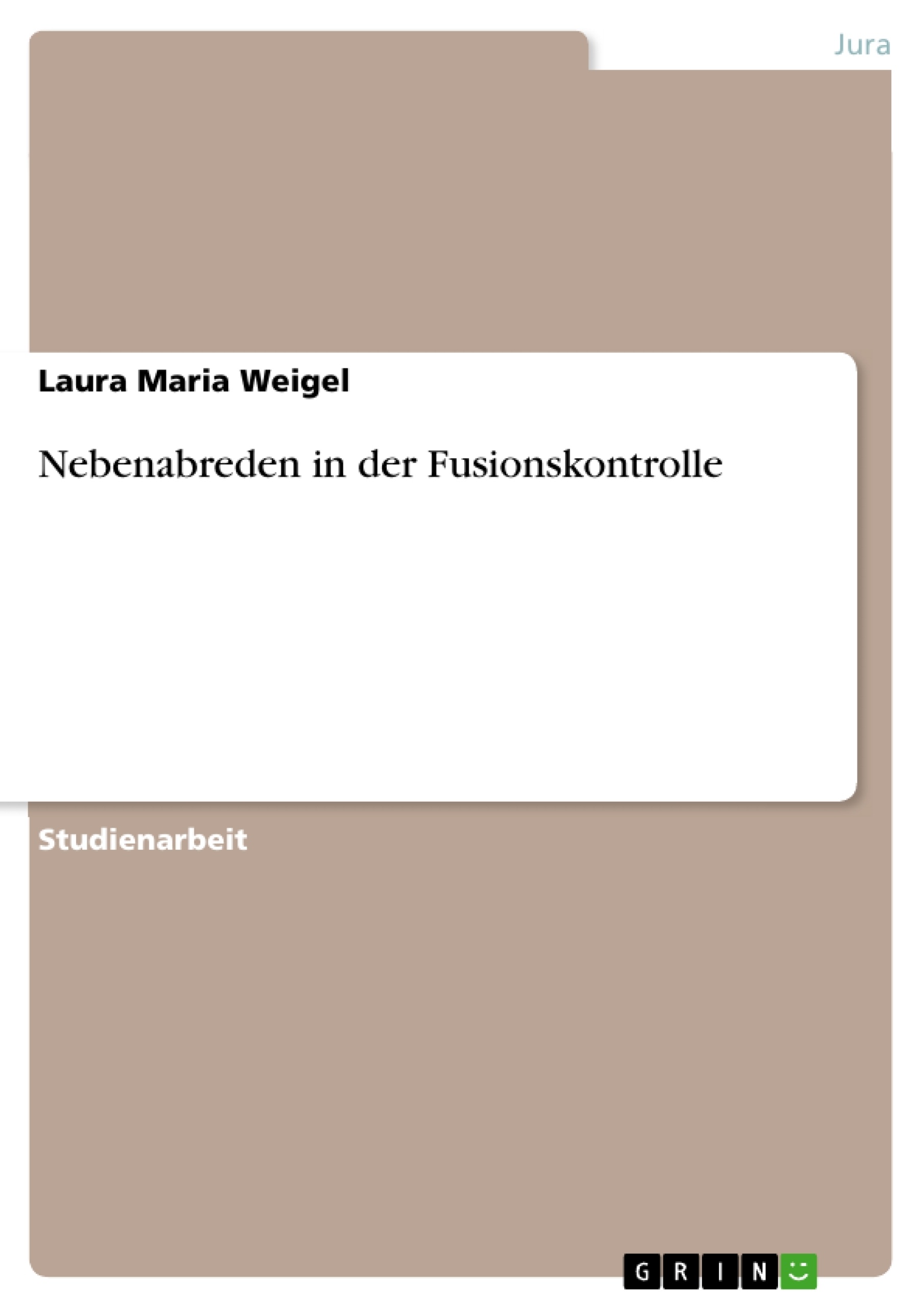Im Zusammenhang mit Unternehmensübertragungen sowie der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen werden von den beteiligten Parteien oftmals zusätzliche Vereinbarungen getroffen, die zumindest einem der Vertragspartner Beschränkungen auferlegen. Diese sollen vor allem sicherstellen, dass der Wert des übertragenen Unternehmens nicht gemindert wird. Beispielsweise kann dies dadurch geschehen, dass ein Veräußerer nach dem Vertragsschluss auf demselben Markt eine neue konkurrierende Tätigkeit aufnimmt, sodass im Zuge der Übertragung eines Unternehmens dahingehende Beschränkungen in Form zusätzlicher Vereinbarungen essentiell erscheinen.
Solche Vereinbarungen sind jedoch insofern nicht unproblematisch, als sie oftmals dazu führen, dass wettbewerbliche Handlungsfreiheiten zumindest einer Partei erheblich eingeschränkt werden. Die vorliegende Arbeit hat sich daher zum Ziel gesetzt, das Spannungsverhältnis zwischen der Ermöglichung von effektiven Unternehmenszusammenschlüssen einerseits und der weitestgehenden Schonung des Wettbewerbs andererseits zu untersuchen.
Hierzu wird in einem ersten Teil der Frage nachgegangen, inwiefern die genannten Nebenabreden im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle kartellrechtlich zulässig sind. Im zweiten Teil werden dann die zivilrechtlichen Rechtsfolgen bei Unzulässigkeit einer solchen Nebenabrede näher beleuchtet. Der dritte Teil der Arbeit befasst sich schließlich mit der Frage, wie Nebenabreden im kartellrechtlichen Verfahren zu behandeln sind.
Die Untersuchung der aufgeworfenen Fragestellungen erfolgt dabei stets sowohl im Hinblick auf das europäische als auch auf das deutsche Recht.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Zulässigkeit von Nebenabreden
- I. Zulässigkeit nach europäischem Recht
- 1. Behandlung von Nebenabreden nach der Fusionskontrollverordnung
- a) Begriff der Nebenabrede
- b) Tatbestandsvoraussetzungen
- aa) Einschränkung
- bb) Unmittelbare Verbundenheit
- cc) Notwendigkeit
- c) Fallgruppen
- aa) Wettbewerbsverbote
- (1.) Unternehmensveräußerung
- (2.) Gründung von Gemeinschaftsunternehmen
- bb) Lizenzvereinbarungen
- cc) Bezugs- und Lieferpflichten
- 2. Beurteilung von Nebenabreden gem. Art. 101 AEUV
- a) Anwendungsbereich des Art. 101 AEUV
- b) Tatbestandsreduktion
- II. Zulässigkeit nach deutschem Recht
- 1. Anwendungsbereich der §§ 35 ff. und 1 GWB
- 2. Beurteilung von Nebenabreden gem. § 1 GWB
- a) Tatbestandsreduktion
- b) Berücksichtigung der Bekanntmachung über Nebenabreden
- 3. Beurteilung von Nebenabreden gem. § 138 BGB
- C. Rechtsfolgen bei kartell- und zivilrechtlicher Unwirksamkeit
- I. Reichweite der Nichtigkeitsfolge
- II. Gesamt- oder Teilnichtigkeit gem. § 139 BGB
- III. Rückführung der Nebenabrede auf das zulässige Maß
- 1. Rechtliche Methoden
- 2. Zulässigkeit der geltungserhaltenden Reduktion
- IV. Salvatorische Klausel
- V. Störung der Geschäftsgrundlage
- 1. Aufnahme einer Nebenabrede mit zulässigem Umfang
- 2. Anpassung der Gegenleistung
- D. Verfahrensrechtliche Behandlung von Nebenabreden
- I. Verfahren nach europäischen Recht
- II. Verfahren nach deutschem Recht
- E. Schlussbetrachtung in Thesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen der Ermöglichung effektiver Unternehmenszusammenschlüsse und dem Schutz des Wettbewerbs im Kontext von Nebenabreden. Sie analysiert die kartellrechtliche Zulässigkeit solcher Abreden im europäischen und deutschen Recht und beleuchtet die zivilrechtlichen Folgen im Falle von Unzulässigkeit. Die verfahrensrechtliche Behandlung von Nebenabreden wird ebenfalls behandelt.
- Kartellrechtliche Zulässigkeit von Nebenabreden im europäischen und deutschen Recht
- Zivilrechtliche Rechtsfolgen bei unzulässigen Nebenabreden
- Verfahrensrechtliche Aspekte der Behandlung von Nebenabreden
- Begriff und Abgrenzung von Nebenabreden im Fusionskontrollrecht
- Auswirkungen von Nebenabreden auf den Wettbewerb
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Nebenabreden im Kontext von Unternehmenszusammenschlüssen ein. Sie beschreibt das Problem der wettbewerblichen Beschränkungen durch solche Abreden und benennt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung des Spannungsverhältnisses zwischen der Ermöglichung effektiver Fusionen und dem Schutz des Wettbewerbs. Es wird der Aufbau der Arbeit skizziert, der sich in die Analyse der kartellrechtlichen Zulässigkeit, der zivilrechtlichen Rechtsfolgen und der verfahrensrechtlichen Behandlung gliedert.
B. Zulässigkeit von Nebenabreden: Dieses Kapitel untersucht die Zulässigkeit von Nebenabreden sowohl nach europäischem als auch nach deutschem Recht. Es analysiert die Voraussetzungen, unter denen Nebenabreden im Rahmen der Fusionskontrolle als zulässig angesehen werden. Im europäischen Kontext wird die Fusionskontrollverordnung (FKVO) im Detail betrachtet, insbesondere die Definition von Nebenabreden und die relevanten Tatbestandsmerkmale (Einschränkung, Unmittelbare Verbundenheit, Notwendigkeit). Die Kommission's Bekanntmachung über Nebenabreden wird als wichtiger Auslegungshilfe diskutiert. Die Kapitel analysieren weiterhin die Anwendung von Art. 101 AEUV und die entsprechenden deutschen Bestimmungen (§§ 35 ff. und 1 GWB, sowie § 138 BGB).
C. Rechtsfolgen bei kartell- und zivilrechtlicher Unwirksamkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit den Konsequenzen, wenn Nebenabreden als kartell- oder zivilrechtlich unzulässig eingestuft werden. Es untersucht die Reichweite der Nichtigkeitsfolge, die Möglichkeiten der Gesamt- oder Teilnichtigkeit gemäß § 139 BGB und die Methoden der Rückführung einer unzulässigen Nebenabrede auf ein zulässiges Maß (z.B. Gesetzeskonforme Auslegung, Geltungserhaltende Reduktion, Umdeutung). Die Bedeutung von salvatorischen Klauseln und die Störung der Geschäftsgrundlage im Zusammenhang mit unwirksamen Nebenabreden werden ebenfalls analysiert.
D. Verfahrensrechtliche Behandlung von Nebenabreden: Das Kapitel behandelt die verfahrensrechtlichen Aspekte im Umgang mit Nebenabreden, sowohl im europäischen als auch im deutschen Recht. Es beschreibt die relevanten Verfahren und die Rolle der beteiligten Behörden und Gerichte. Es beleuchtet die praktischen Herausforderungen bei der Prüfung und Behandlung von Nebenabreden im Rahmen der Fusionskontrolle.
Schlüsselwörter
Nebenabreden, Fusionskontrolle, Kartellrecht, Zivilrecht, Wettbewerbsrecht, Fusionskontrollverordnung (FKVO), Art. 101 AEUV, § 1 GWB, § 138 BGB, Unternehmenszusammenschlüsse, Wettbewerbsbeschränkungen, Nichtigkeit, Geltungserhaltende Reduktion, Verfahrensrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Zulässigkeit von Nebenabreden bei Unternehmenszusammenschlüssen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Zulässigkeit von Nebenabreden im Kontext von Unternehmenszusammenschlüssen unter kartell- und zivilrechtlichen Aspekten. Sie untersucht das Spannungsfeld zwischen der Ermöglichung effektiver Fusionen und dem Schutz des Wettbewerbs.
Welche Rechtsgebiete werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das europäische und deutsche Kartellrecht (Fusionskontrollverordnung, Art. 101 AEUV, § 1 GWB), sowie das deutsche Zivilrecht (§ 138 BGB, § 139 BGB). Verfahrensrechtliche Aspekte werden ebenfalls betrachtet.
Was sind Nebenabreden im Fusionskontrollrecht?
Nebenabreden sind Vereinbarungen, die im Zusammenhang mit einer Fusion getroffen werden, aber nicht direkt Teil des Fusionsvertrags sind. Sie können den Wettbewerb beeinflussen und daher kartellrechtlich relevant sein.
Wie wird die Zulässigkeit von Nebenabreden im europäischen Recht geprüft?
Die Zulässigkeit von Nebenabreden wird im europäischen Recht anhand der Fusionskontrollverordnung (FKVO) geprüft. Wichtige Kriterien sind die Einschränkung des Wettbewerbs, die unmittelbare Verbundenheit mit der Fusion und die Notwendigkeit der Abrede.
Wie wird die Zulässigkeit von Nebenabreden im deutschen Recht geprüft?
Im deutschen Recht werden Nebenabreden unter anderem nach § 1 GWB und § 138 BGB geprüft. Die Bekanntmachung der Kommission über Nebenabreden dient als wichtige Auslegungshilfe.
Welche Rechtsfolgen ergeben sich bei unzulässigen Nebenabreden?
Unzulässige Nebenabreden können nichtig sein (§ 138 BGB). Die Arbeit untersucht die Reichweite der Nichtigkeit, die Möglichkeiten der Teilnichtigkeit (§ 139 BGB) und Methoden der Rückführung auf ein zulässiges Maß (z.B. geltungserhaltende Reduktion).
Welche Rolle spielen salvatorische Klauseln und die Störung der Geschäftsgrundlage?
Salvatorische Klauseln können die Wirksamkeit des verbleibenden Teils eines Vertrags nach der Nichtigkeit einzelner Klauseln sichern. Eine Störung der Geschäftsgrundlage kann zu einer Anpassung oder Auflösung des Vertrags führen.
Welche verfahrensrechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die verfahrensrechtlichen Aspekte der Prüfung und Behandlung von Nebenabreden im europäischen und deutschen Recht, einschließlich der beteiligten Behörden und Gerichte.
Welche Themenschwerpunkte werden besonders behandelt?
Besondere Schwerpunkte liegen auf der kartellrechtlichen Zulässigkeit von Nebenabreden im europäischen und deutschen Recht, den zivilrechtlichen Rechtsfolgen unzulässiger Abreden, verfahrensrechtlichen Aspekten und der Abgrenzung von Nebenabreden im Fusionskontrollrecht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nebenabreden, Fusionskontrolle, Kartellrecht, Zivilrecht, Wettbewerbsrecht, Fusionskontrollverordnung (FKVO), Art. 101 AEUV, § 1 GWB, § 138 BGB, Unternehmenszusammenschlüsse, Wettbewerbsbeschränkungen, Nichtigkeit, Geltungserhaltende Reduktion, Verfahrensrecht.
- Quote paper
- Laura Maria Weigel (Author), 2012, Nebenabreden in der Fusionskontrolle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273650