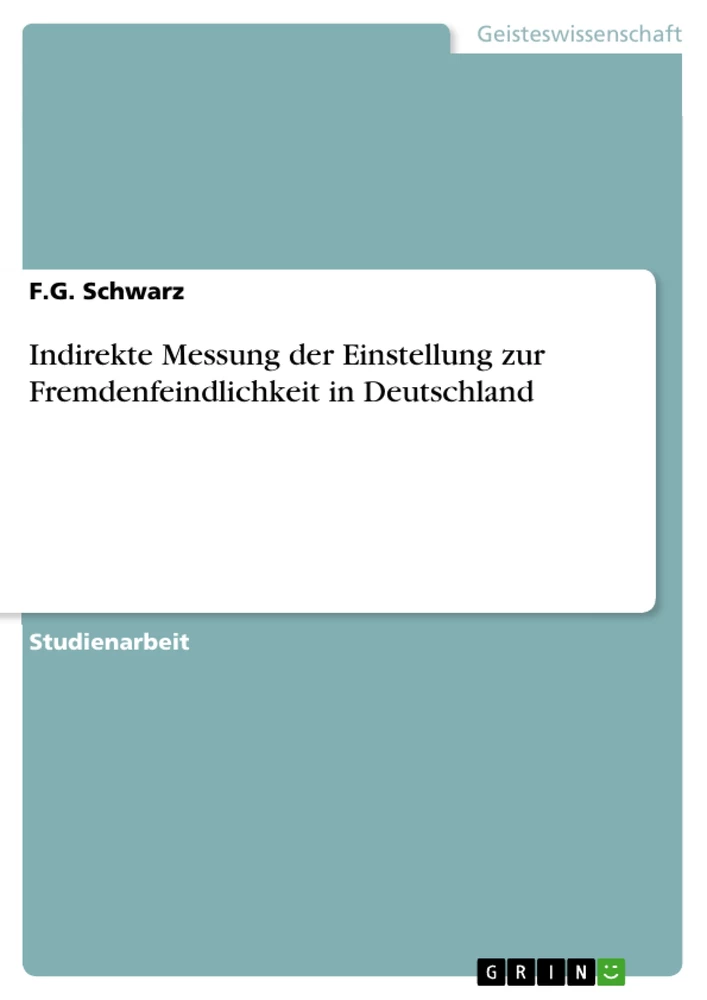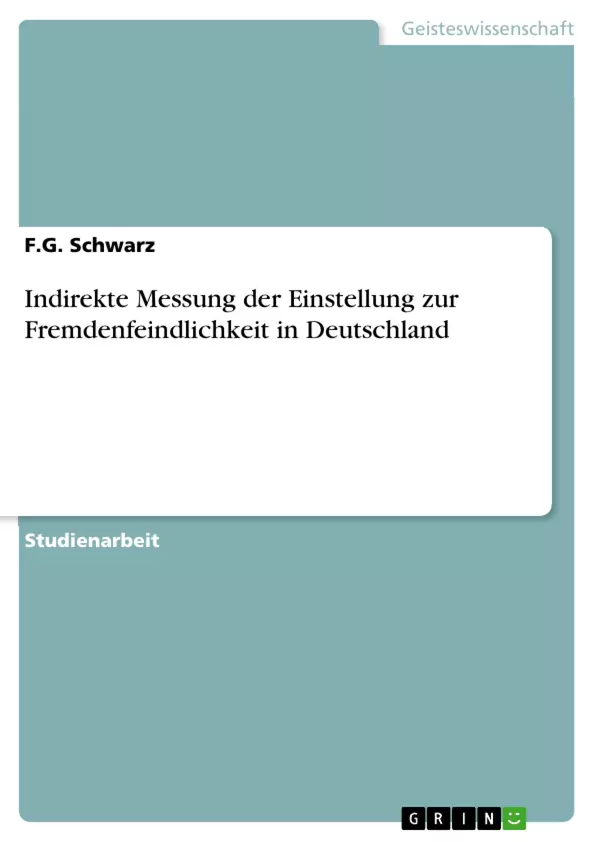Das Thema „Fremdenfeindlichkeit in Deutschland“ stellt vor allem in Zeiten der Globalisierung und Internationalisierung ein erhebliches gesellschaftliches Problem dar.
Das Erbe des Nationalsozialismus ist auch fast 70 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges und der Verbrechen unter Adolf Hitler eine schwere Last auf den Schultern der Deutschen.
Im Jahr 2012 wurde im Vergleich zum Vorjahr, laut Ex-Bundesinnenminister Friedrich (CDU), ein Anstieg rechtsmotivierter Strafdelikte von ca. 4% auf rund 17.600 Straftaten festgestellt („Der Tagesspiegel“ vom 23.03.13, Jansen & Tretbar). Einen der vermutlich schrecklichsten Fälle von rechtsextremer Gewalt in der Nachkriegsgeschichte stellen die sogenannten NSU-Morde dar, die aktuell die Gerichte beschäftigten.
Die Deutschen haben aufgrund Ihrer Geschichte scheinbar eine „Kollektivschuld“ zu tragen, die allerdings in den letzten Jahren deutlich abgelegt wurde („Der Tagesspiegel“ vom 08.05.09, Schlicht).
Um einen Hinweis darauf zu bekommen, wie „fremdenfeindlich“ Deutschlands Bevölkerung wirklich ist, um entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, ist es sinnvoll die Einstellung zu diesem Merkmal zu erfassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung/Problemstellung
- 2. Zentrale Erkenntnisse über die indirekte Messung von Einstellungen
- 3. Eingrenzung und Vorstellung des Themas „Indirekte Messung von Einstellung zur Fremdenfeindlichkeit in Deutschland
- 4. Vorschlag einer Messmethodik
- 4.1 Test: Fragebogen
- 4.2 Kreativer Part
- 4.3 IAT
- 4.4 Befragung nach „Bogus-Pipeline“-Modell
- 4.5 Ermittlung der Ergebnisse
- 5. Einschätzung der Machbarkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit der indirekten Messung von Einstellungen zur Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Ziel ist es, eine geeignete Messmethodik zu entwickeln, die verfälschte Daten durch soziale Erwünschtheit vermeidet. Die Arbeit analysiert bestehende Erkenntnisse zur indirekten Messmethode und schlägt verschiedene Verfahren vor.
- Indirekte Messung von Einstellungen
- Fremdenfeindlichkeit in Deutschland
- Soziale Erwünschtheit und Messfehler
- Entwicklung einer geeigneten Messmethodik
- Bewertung der Machbarkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung/Problemstellung: Die Einleitung stellt das gesellschaftliche Problem der Fremdenfeindlichkeit in Deutschland dar, insbesondere im Kontext von Globalisierung und dem historischen Erbe des Nationalsozialismus. Der Anstieg rechtsmotivierter Straftaten wird als Beleg angeführt. Die Schwierigkeit, Einstellungen zur Fremdenfeindlichkeit direkt zu messen, aufgrund der sozialen Erwünschtheit, wird hervorgehoben. Die Arbeit argumentiert für die Notwendigkeit indirekter Messverfahren, die implizite Einstellungen erfassen, ohne dass die Befragten die wahre Intention der Messung erkennen.
2. Zentrale Erkenntnisse über die indirekte/implizierte Messung von Einstellungen: Dieses Kapitel klärt den Unterschied zwischen „indirekt“ und „implizit“ in Bezug auf die Messung von Einstellungen. Es betont die Wichtigkeit der indirekten Messung zur Erfassung unbewusster Einstellungen. Die Definition der indirekten Messung wird erläutert, und die Bedingungen für die Verhaltenswirksamkeit implizierter Assoziationen und Einstellungen werden diskutiert, indem das reflektive und impulsive System der Informationsverarbeitung beschrieben wird. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der vorgeschlagenen Messmethoden.
3. Eingrenzung und Vorstellung des Themas „Indirekte Messung von Einstellung zur Fremdenfeindlichkeit in Deutschland“: Dieses Kapitel grenzt das Thema weiter ein und stellt die Herausforderungen bei der Messung von Einstellungen zur Fremdenfeindlichkeit in Deutschland dar. Es wird erläutert, warum klassische direkte Methoden ungeeignet sind und wie indirekte Methoden hier Abhilfe schaffen können. Es bildet die Brücke zwischen der theoretischen Grundlage (Kapitel 2) und dem praktischen Teil (Kapitel 4).
4. Vorschlag einer Messmethodik: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Methoden zur indirekten Messung von Einstellungen zur Fremdenfeindlichkeit. Es werden mehrere Ansätze vorgestellt: Fragebögen, kreative Methoden, der Implizite Assoziationstest (IAT), und die Befragung nach dem „Bogus-Pipeline“-Modell. Jeder Ansatz wird kurz erläutert, und die Methoden zur Ermittlung der Ergebnisse werden skizziert. Dieses Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar, indem es konkrete Lösungsansätze zur Erfassung der Einstellungen präsentiert.
5. Einschätzung der Machbarkeit: In diesem Kapitel wird die praktische Umsetzbarkeit der in Kapitel 4 vorgeschlagenen Messmethoden bewertet. Die Herausforderungen und potenziellen Schwierigkeiten bei der Durchführung der Studie werden diskutiert, einschließlich ethischer Aspekte und der Interpretation der Ergebnisse. Dieser Abschnitt dient der kritischen Reflexion der vorgeschlagenen Methoden und ihrer Anwendbarkeit in der Praxis.
Schlüsselwörter
Indirekte Messung, implizite Einstellungen, Fremdenfeindlichkeit, Deutschland, soziale Erwünschtheit, Messmethodik, Fragebogen, IAT, Bogus-Pipeline, Forschungsdesign, Datenanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Indirekte Messung von Einstellungen zur Fremdenfeindlichkeit in Deutschland
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeit der indirekten Messung von Einstellungen zur Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Das Hauptziel ist die Entwicklung einer geeigneten Messmethodik, die verfälschte Daten durch soziale Erwünschtheit vermeidet.
Welche Methoden der indirekten Messung werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt verschiedene Methoden vor, darunter Fragebögen, kreative Methoden, den Impliziten Assoziationstest (IAT) und die Befragung nach dem „Bogus-Pipeline“-Modell. Jeder Ansatz wird im Detail erläutert.
Warum ist die indirekte Messung von Einstellungen in diesem Kontext notwendig?
Direkte Messmethoden sind aufgrund der sozialen Erwünschtheit ungeeignet, da Befragte ihre wahren Einstellungen zur Fremdenfeindlichkeit aus Angst vor sozialer Ablehnung verbergen könnten. Indirekte Methoden sollen implizite, unbewusste Einstellungen erfassen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung/Problemstellung, Zentrale Erkenntnisse über die indirekte Messung von Einstellungen, Eingrenzung und Vorstellung des Themas, Vorschlag einer Messmethodik und Einschätzung der Machbarkeit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung detailliert beschrieben.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Kapitel?
Kapitel 1 stellt das Problem der Fremdenfeindlichkeit und die Schwierigkeiten der direkten Messung dar. Kapitel 2 erläutert die Theorie der indirekten Messung. Kapitel 3 grenzt das Thema ein und beschreibt die Herausforderungen. Kapitel 4 vorschlägt konkrete Messmethoden. Kapitel 5 bewertet die Machbarkeit der vorgeschlagenen Methoden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Indirekte Messung, implizite Einstellungen, Fremdenfeindlichkeit, Deutschland, soziale Erwünschtheit, Messmethodik, Fragebogen, IAT, Bogus-Pipeline, Forschungsdesign, Datenanalyse.
Wie wird die soziale Erwünschtheit in der Studie berücksichtigt?
Die Arbeit konzentriert sich explizit auf die Vermeidung von Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit. Indirekte Messmethoden werden eingesetzt, um unbewusste Einstellungen zu erfassen, die weniger von sozialer Erwünschtheit beeinflusst sind.
Welche Herausforderungen werden bei der Umsetzung der Studie diskutiert?
Das letzte Kapitel bewertet die praktische Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Methoden und diskutiert Herausforderungen wie ethische Aspekte und die Interpretation der Ergebnisse.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit, der Messung von Einstellungen und der Entwicklung von Forschungsmethoden befassen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die detaillierte Ausarbeitung der einzelnen Kapitel und Methoden findet sich im vollständigen Text der Arbeit.
- Quote paper
- F.G. Schwarz (Author), 2013, Indirekte Messung der Einstellung zur Fremdenfeindlichkeit in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273670