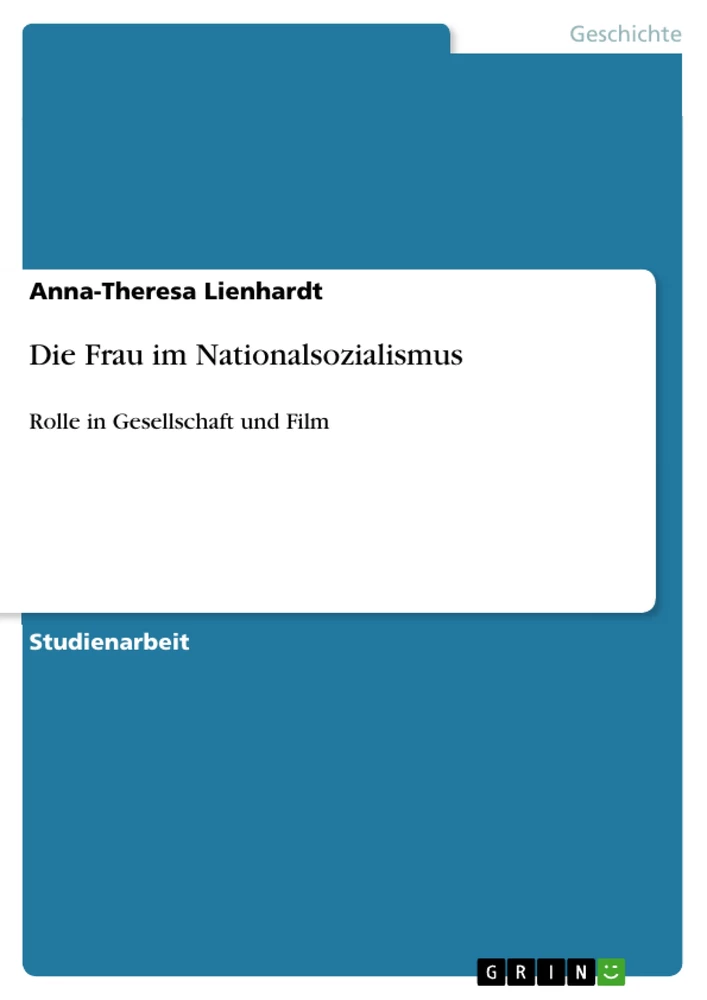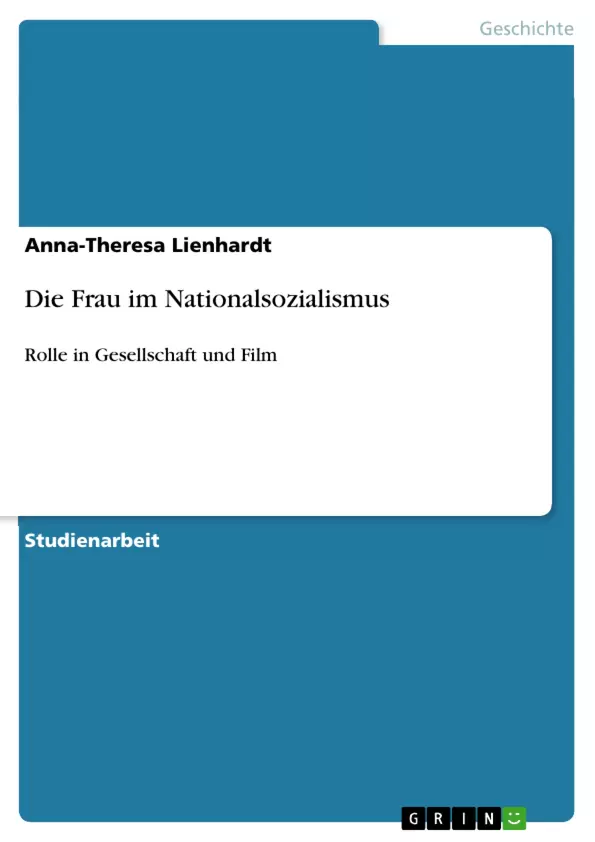Die Hausarbeit beschäftigt sich zunächst damit, welche Rolle Frauen im NS-Staat zukam, welcher Ideologie diese Rolle entspricht und wie sich das in der Realität auswirkte, wobei der Zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945 dafür von besonderer Bedeutung sein wird. Im Speziellen geht es danach um die Rolle der Frau im nationalsozialistischen Film, da dieser ein wichtiges Instrument darstellte, die Massen im Reich geschickt zu indoktrinieren und zu manipulieren. Dazu erfolgt eine kurze Einführung zum Thema, indem die Bedeutung der deutschen Bürgerin als Rezipientin nationalsozialistischer Filme verdeutlicht wird. Danach untersucht die Arbeit, wie die Beziehung Adolf Hitlers und Joseph Goebbels' zu den weiblichen Ufa-Stars waren, wie diese Frauen in der Realität in Szene gesetzt wurden, wer sie waren und vor allem, welche Charaktere sie in ihren Filmen verkörperten. Wichtig sind konkrete Beispiele, anhand derer gezeigt wird, wie die Nationalsozialisten ihre Botschaften in den Filmen verpackten, damit diese gleichzeitig erfolgreich, unterhaltsam und beeinflussend sein konnten.
Zuletzt geht es um die einzige Frau, die im ‚Dritten Reich‘ hinter der Kamera große Erfolge erzielen konnte: die Regisseurin Leni Riefenstahl. Die Arbeit verfolgt dabei ausschließlich, welche Rolle sie im NS-Staat und für den NS-Film spielte und wie sie als Frau im Reich so erfolgreich werden konnte. Durch ein abschließendes Fazit werden die Untersuchungen über die Rolle der Frau in NS-Staat und NS-Film beendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rolle der Frau im NS-Staat
- Frauen und der NS-Film
- Die Rolle der Frau als Kinogängerin
- Die Rolle der Frau im NS-Fi1m
- Die Sonderrolle der Regisseurin Leni Riefenstahl
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Filmographie
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Rolle der Frau im Nationalsozialismus, sowohl im NS-Staat als auch im NS-Film. Sie analysiert die Ideologie, die diese Rolle definierte, und untersucht, wie sich diese in der Realität auswirkte. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle der Frau im nationalsozialistischen Film, der als wichtiges Instrument zur Indoktrination der Massen diente.
- Die NS-Frauenideologie und ihre Umsetzung in der Praxis
- Die Bedeutung der Frau als Kinogängerin im NS-Staat
- Die Darstellung von Frauen in NS-Filmen und ihre Rolle in der Propaganda
- Die Sonderstellung der Regisseurin Leni Riefenstahl im NS-Film
- Die Widersprüchlichkeiten im Umgang mit Frauen im Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Rolle der Frau im NS-Staat. Es analysiert die NS-Frauenideologie, die die Frau als Mutter und Hausfrau definierte, und zeigt auf, wie diese Ideologie durch staatliche Maßnahmen, wie z.B. die Einführung des Muttertags und die Förderung von Mehrkindfamilien, gestützt wurde. Zudem wird die Rolle der Frau im Arbeitsleben und die Auswirkungen der NS-Rassenpolitik auf Frauen beleuchtet.
Das zweite Kapitel widmet sich der Rolle der Frau im NS-Film. Es untersucht die Bedeutung der Frau als Kinogängerin und beleuchtet die Rolle von Frauen in Filmen des Dritten Reichs. Die Arbeit analysiert die Darstellung von Frauen in NS-Filmen, die oft den Idealen der NS-Frauenideologie entsprechen, und zeigt auf, wie diese Filme zur Propaganda eingesetzt wurden. Die Arbeit beschäftigt sich auch mit der Frage, wie sich die Darstellung von Frauen in Filmen im Laufe des Krieges verändert hat und wie mit Sexualität im NS-Film umgegangen wurde.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Sonderstellung der Regisseurin Leni Riefenstahl im NS-Film. Es beleuchtet ihre Karriere und ihren Aufstieg zur erfolgreichsten Regisseurin des Dritten Reichs. Die Arbeit analysiert ihre Beziehung zu Adolf Hitler und untersucht, wie sie ihre herausragende Position im NS-Staat nutzen konnte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Rolle der Frau im NS-Staat, die NS-Frauenideologie, der NS-Film, die Propaganda im NS-Film, die Darstellung von Frauen in NS-Filmen, Leni Riefenstahl, die Beziehung zwischen Leni Riefenstahl und Adolf Hitler, die Widersprüchlichkeiten im Umgang mit Frauen im Nationalsozialismus.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle hatten Frauen im Nationalsozialismus?
Die NS-Ideologie definierte die Frau primär als Mutter und Hausfrau, deren Hauptaufgabe die Erhaltung der "Volksgemeinschaft" durch Kinderreichtum war. Dies wurde durch staatliche Maßnahmen wie den Muttertag gefördert.
Wie wurden Frauen im NS-Film dargestellt?
Frauen im Film dienten als Instrumente der Indoktrination. Sie verkörperten oft die idealisierte deutsche Frau, wurden aber auch in unterhaltsamen Rollen eingesetzt, um die Massen subtil zu beeinflussen.
Wer war Leni Riefenstahl und welche Rolle spielte sie?
Leni Riefenstahl war die erfolgreichste Regisseurin im Dritten Reich. Trotz der Frauenideologie genoss sie eine Sonderstellung und produzierte monumentale Propagandafilme wie "Triumph des Willens".
Gab es Widersprüche in der NS-Frauenrolle während des Krieges?
Ja, während des Zweiten Weltkriegs mussten Frauen trotz der Hausfrauen-Ideologie verstärkt in der Rüstungsindustrie und im Arbeitsleben die Plätze der kämpfenden Männer einnehmen.
Wie nutzte Joseph Goebbels weibliche Filmstars?
Goebbels setzte Ufa-Stars gezielt ein, um Glamour zu erzeugen und die NS-Botschaften in unterhaltsame Formate zu verpacken, was die Identifikation der Zuschauerinnen mit dem Regime stärken sollte.
- Quote paper
- Anna-Theresa Lienhardt (Author), 2012, Die Frau im Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273788