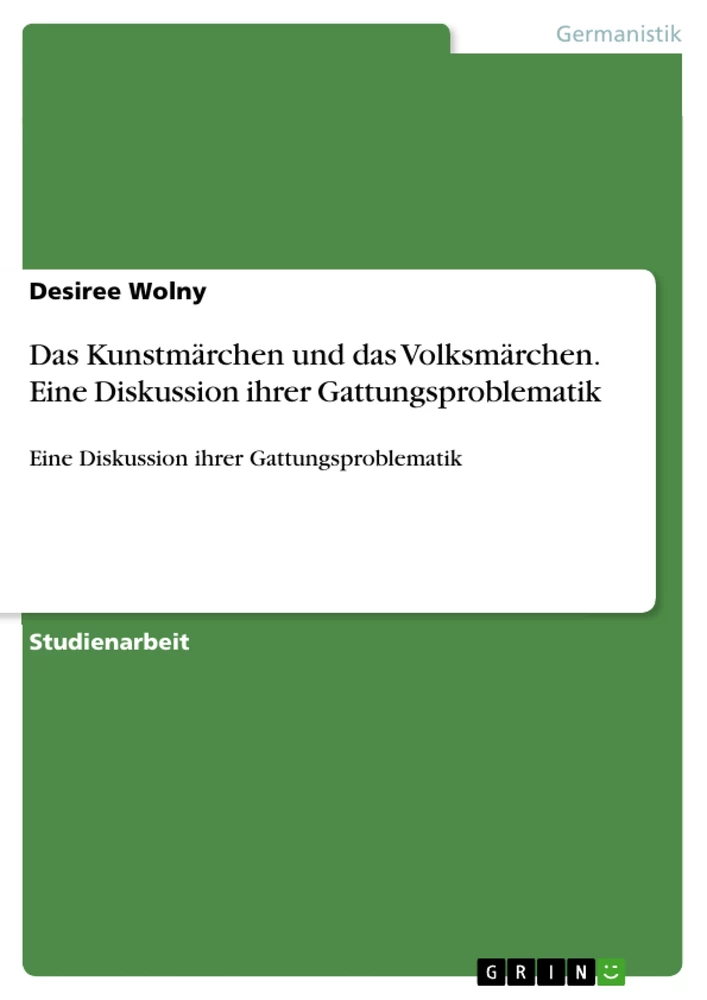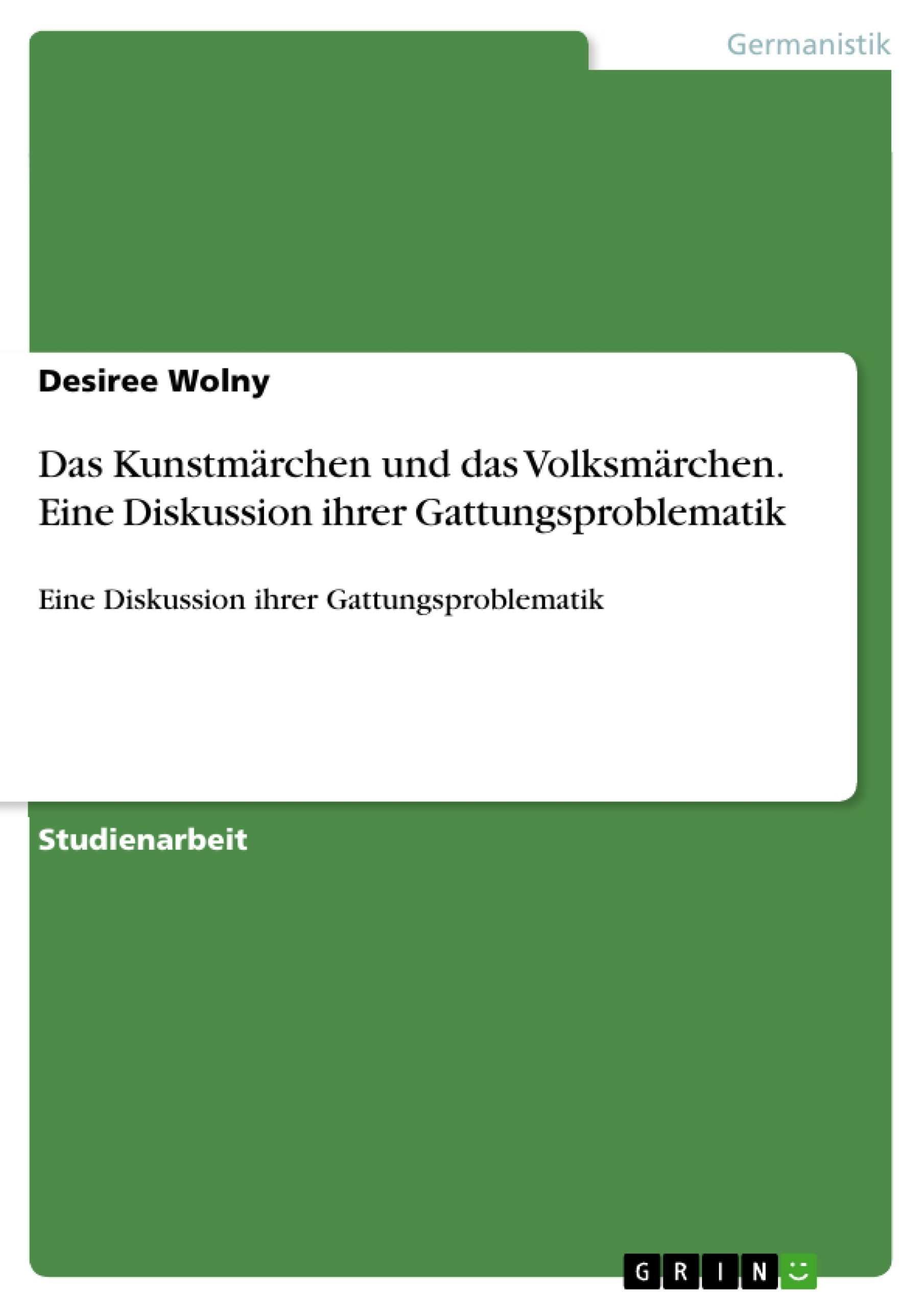Die Autorlosigkeit eines literarischen Textes und dessen Überlieferungsart dienen als Identifikatoren für das Volks- und das Kunstmärchen. Aber ist es überhaupt möglich, eine so klare Definitionsgrenze zu ziehen? Welche weiteren Abgrenzungen lassen sich zwischen dem Volksmärchen und dem Kunstmärchen vornehmen oder sind die beiden Begriffe doch nur Bezeichnungen für die zwei Seiten derselben Medaille? Und wie definiert die heutige Forschung die Begriffe Volks- und Kunstmärchen?
Das erste Kapitel dieser Arbeit wird die grundlegenden Begriffe des Märchens, des Volks-märchens und des Kunstmärchens beschreiben und darstellen, da eine genaue Kenntnis ihrer Charakteristika für den Verlauf der Ausarbeitung unerlässlich ist. Die Problematik dieser drei Begriffe besteht wie erwähnt darin, dass es keine wirkliche Trennschärfe der einzelnen Kategorien und somit eine Vielzahl an Definitionsbildungen gibt. Es wird versucht werden, die übereinstimmenden Merkmale wiederzugeben, ohne sich dabei in mehreren Deutungsvarianten zu verlieren. Der Einteilung des Volksmärchens liegt die weitreichende Definition der Monographie Max Lüthis Märchen zugrunde. Weiter wird sich zeigen, dass sich der Bereich der Volks- und Kunstmärchenforschung kaum auf den deutschsprachigen Raum eingrenzen läßt, jedoch wird im Hinblick auf die Dimension dieser Arbeit davon abgesehen, in größerem Umfang auf die Entwicklung der Thematik in anderen Sprachen einzugehen. Ebenso wird aus diesem Grund darauf verzichtet, praxisbezogene Analysen von Präzedenzfällen der beiden Gattungen zu liefern.
Das darauffolgende Kapitel wird sich mit der vermeintlichen Verschiedenartigkeit des Volksmärchens und des Kunstmärchens beschäftigen und versuchen, die bestehenden Kontroversen bei einer eindeutigen Definitionsfindung aufzuzeigen. Der bereits erwähnte Briefwechsel zwischen den Gebrüdern Grimm und dem Schriftsteller Achim von Arnim soll dabei näher untersucht werden. Ebenso soll über die inhaltlichen Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen dem Volks- und dem Kunstmärchen berichtet werden. Anschließend erfolgt eine sehr ausführliche Darstellung und Beschreibung der Diskussion der Gattungsproblematik des Volks- und des Kunstmärchens in der Forschung. Zugleich werden auch die gegenwärtige Bedeutung der Unterscheidung zwischen dem Volksmärchen und dem Kunstmärchen und der aktuelle Forschungsstand zu der Thematik beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitorische Abgrenzung der Begriffe Märchen, Volksmärchen, Kunstmärchen
- Das Märchen
- Das Volksmärchen
- Das Kunstmärchen
- Von der Verschiedenartigkeit des Volksmärchens und des Kunstmärchens
- Die Kontroverse zwischen Achim von Arnim und den Gebrüdern Grimm
- Über die Unterscheidung von Volksmärchen und Kunstmärchen
- Die Gattungsdiskussion in der Forschung
- Über die Definition von Volksmärchen und Kunstmärchen anhand der aktuellen Forschung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Forschungsdebatte zum Volks- und Kunstmärchen zu beleuchten und einen Überblick über die Entwicklung der beiden Gattungen zu geben. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Definitionen der Begriffe "Märchen", "Volksmärchen" und "Kunstmärchen" und analysiert die Kontroversen, die sich im Laufe der Geschichte um diese Begriffe entwickelt haben.
- Die historische Entwicklung der Begriffe Volks- und Kunstmärchen
- Die Kontroverse zwischen Achim von Arnim und den Gebrüdern Grimm
- Die Bedeutung der mündlichen Tradierung für das Volksmärchen
- Die Merkmale des Kunstmärchens als literarische Gattung
- Die aktuelle Forschung zum Volks- und Kunstmärchen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit widmet sich der definitorischen Abgrenzung der Begriffe "Märchen", "Volksmärchen" und "Kunstmärchen". Es wird die Etymologie der Begriffe beleuchtet und die unterschiedlichen Definitionsansätze der Forschung dargestellt. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der mündlichen Tradierung für das Volksmärchen und die Merkmale des Kunstmärchens als literarische Gattung.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der vermeintlichen Verschiedenartigkeit des Volks- und Kunstmärchens. Es werden die Kontroversen zwischen Achim von Arnim und den Gebrüdern Grimm analysiert, die sich im frühen 19. Jahrhundert um die Begriffe "Naturpoesie" und "Kunstpoesie" entzündeten. Das Kapitel stellt die wichtigsten Unterscheidungskriterien zwischen Volks- und Kunstmärchen dar und beleuchtet die Diskussion um die Gattungsproblematik in der Forschung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Begriff des Märchens, die Unterscheidung zwischen Volks- und Kunstmärchen, die Gattungsdiskussion in der Forschung, die Bedeutung der mündlichen Tradierung, die Kontroverse zwischen Achim von Arnim und den Gebrüdern Grimm sowie die aktuelle Forschung zum Volks- und Kunstmärchen.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet ein Volksmärchen von einem Kunstmärchen?
Volksmärchen sind meist autorlos und mündlich überliefert, während Kunstmärchen literarische Schöpfungen bekannter Autoren mit festem Textgefüge sind.
Was war die Kontroverse zwischen Achim von Arnim und den Gebrüdern Grimm?
Die Kontroverse drehte sich um die Begriffe „Naturpoesie“ (Grimm) und „Kunstpoesie“ (Arnim) sowie die Frage, wie stark Märchen bei der schriftlichen Fixierung bearbeitet werden dürfen.
Welche Rolle spielt Max Lüthi in der Märchenforschung?
Max Lüthi lieferte mit seiner Monographie maßgebliche Definitionen für die Charakteristika des Volksmärchens, die als Basis für die wissenschaftliche Einordnung dienen.
Gibt es eine klare Trennschärfe zwischen den Gattungen?
Nein, die Forschung zeigt, dass die Grenzen oft fließend sind und es eine Vielzahl an Definitionsbildungen gibt, was die Gattungsproblematik ausmacht.
Was sind typische Merkmale eines Kunstmärchens?
Kunstmärchen zeichnen sich durch einen individuellen Stil, psychologische Tiefe und oft eine komplexere, bewusste literarische Struktur aus, die über das einfache Schema des Volksmärchens hinausgeht.
Warum ist die mündliche Tradierung für das Volksmärchen so wichtig?
Die mündliche Weitergabe über Generationen hinweg prägt die typischen Formeln und die kollektive Natur des Volksmärchens, bevor es von Sammlern wie den Grimms fixiert wurde.
- Quote paper
- Desiree Wolny (Author), 2014, Das Kunstmärchen und das Volksmärchen. Eine Diskussion ihrer Gattungsproblematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273858