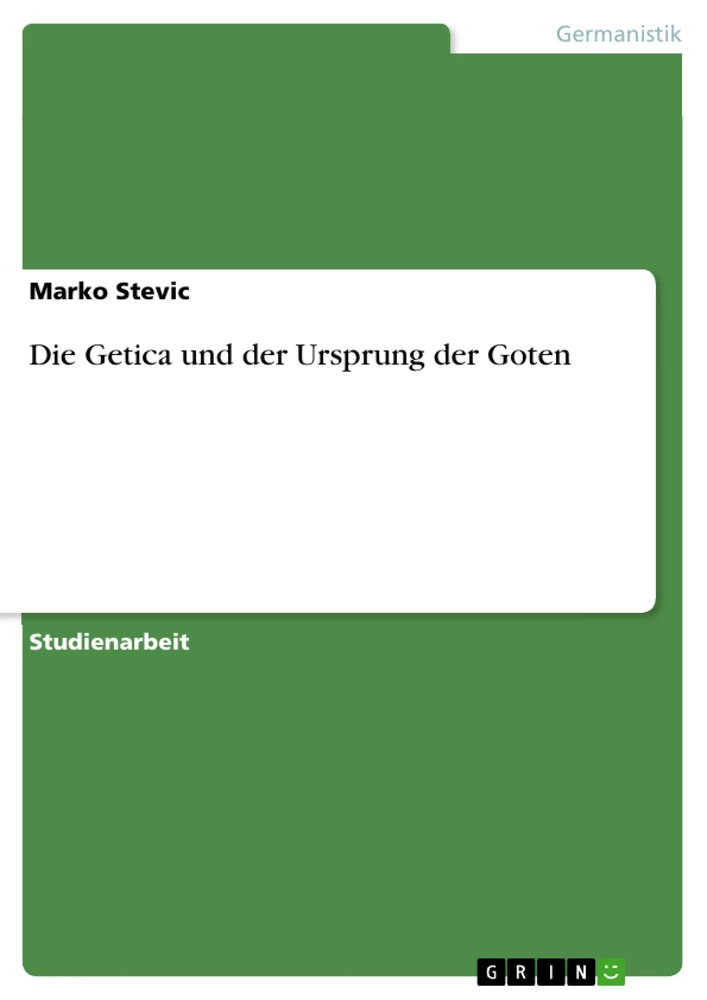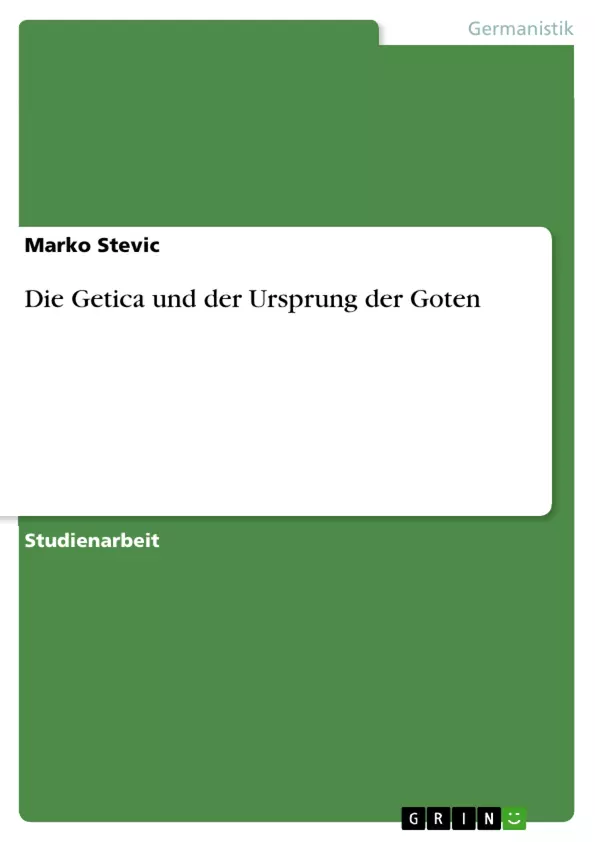Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, inwieweit die Gotengeschichte des Jordanes Aussagekraft bezüglich der Historizität hat, und ob die Ursprungslegenden über die Goten mündlichen gotischen Überlieferungen entstammten, oder ob sie nicht vielleicht Erfindungen der Verfasser sind. Falls sie aus gotischen Quellen geschöpft wurden, stellt sich die Frage, ob sie vielleicht nicht nur Mythen sind, sondern auch von der geschichtlichen Wirklichkeit des
Gotenvolks zeugen. Dabei soll dieser Aufsatz das thematische Paradigma der Gotenherkunft aus sprachwissenschaftlicher bzw. sprachgeschichtlicher Sicht beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Werk und Autor
- Die Urheimat der Goten
- Die „Pferdegeschichte"
- Scandza als Urheimat
- Gauthigoth, Vagoth, Ostrogothae und Greotingi
- Gauthigoth
- Vagoth
- Ostrogothae
- Greotingi
- Gaut
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die „Getica" des Jordanes Aussagekraft bezüglich der Historizität der Gotengeschichte hat. Sie analysiert die Ursprungslegenden der Goten und untersucht, ob diese auf mündlichen gotischen Überlieferungen beruhen oder Erfindungen der Verfasser sind. Die Arbeit betrachtet das Thema der Gotenherkunft aus sprachwissenschaftlicher und sprachgeschichtlicher Perspektive.
- Die historische Glaubwürdigkeit der „Getica" des Jordanes
- Der Ursprung der Ursprungslegenden der Goten
- Die sprachliche Analyse gotischer Namen als Quelle für historische Erkenntnisse
- Die Rolle der „Pferdegeschichte" und der These der skandinavischen Urheimat
- Die Bedeutung des Namens „Gaut" und seine Beziehung zu den Goten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Grundlage der Arbeit dar. Kapitel 2 widmet sich dem Werk und dem Autor Jordanes, beleuchtet seine Rolle als Epitomator der Gotischen Geschichte des Cassiodorus und analysiert die Getica als Zeugnis der Übertragung mündlicher Überlieferungen in Schriftform. Kapitel 3 erörtert die beiden Abstammungsgeschichten der Goten, die eine aus Britannien, die andere aus Skandinavien. Die „Pferdegeschichte" wird als mögliche Spottgeschichte interpretiert, während die These der skandinavischen Urheimat durch sprachwissenschaftliche Analysen untersucht wird. Kapitel 4 analysiert die Namen von vier Völkern, die in Jordanes' Aufzählung skandinavischer Völker auftauchen, und welche in Bezug zu den Goten stehen: Gauthigoth, Vagoth, Ostrogothae und Greotingi. Kapitel 5 geht auf den Namen des Stammvaters der Amaler, Gaut, ein und untersucht seine Bedeutung im Kontext der Gotenherkunft. Der letzte Teil beinhaltet eine Zusammenfassung und einige Verweise.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Gotengeschichte, die „Getica" des Jordanes, die Urheimat der Goten, die „Pferdegeschichte", Scandza, Gauthigoth, Vagoth, Ostrogothae, Greotingi, Gaut, sprachwissenschaftliche Analyse, sprachgeschichtliche Analyse, Historizität, mündliche Überlieferung, Mythen, Geschichte der Goten, germanische Stammeskunde, Skandinavien, Nordgermanisch, Gotisch, Ostgermanisch.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Getica“ des Jordanes?
Die „Getica“ ist ein spätantikes Geschichtswerk über die Goten, das als wichtige, wenn auch umstrittene Quelle für deren Herkunft gilt.
Wo liegt die legendäre Urheimat der Goten?
Jordanes bezeichnet Scandza (Skandinavien) als die „Vagina nationum“, aus der die Goten ursprünglich ausgezogen sein sollen.
Was besagt die sogenannte „Pferdegeschichte“?
Dies ist eine der Abstammungslegenden, die in der Forschung oft als Spottgeschichte oder Mythus über die Herkunft der Goten interpretiert wird.
Wer war Gaut und welche Bedeutung hat der Name?
Gaut gilt als mythischer Stammvater der Amaler und wird in der Arbeit sprachwissenschaftlich in Bezug auf die gotische Identität untersucht.
Wie glaubwürdig sind die Ursprungslegenden der Goten?
Die Arbeit analysiert, ob diese Legenden auf echten mündlichen Überlieferungen basieren oder literarische Erfindungen der Verfasser sind.
- Arbeit zitieren
- Marko Stevic (Autor:in), 2011, Die Getica und der Ursprung der Goten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273926