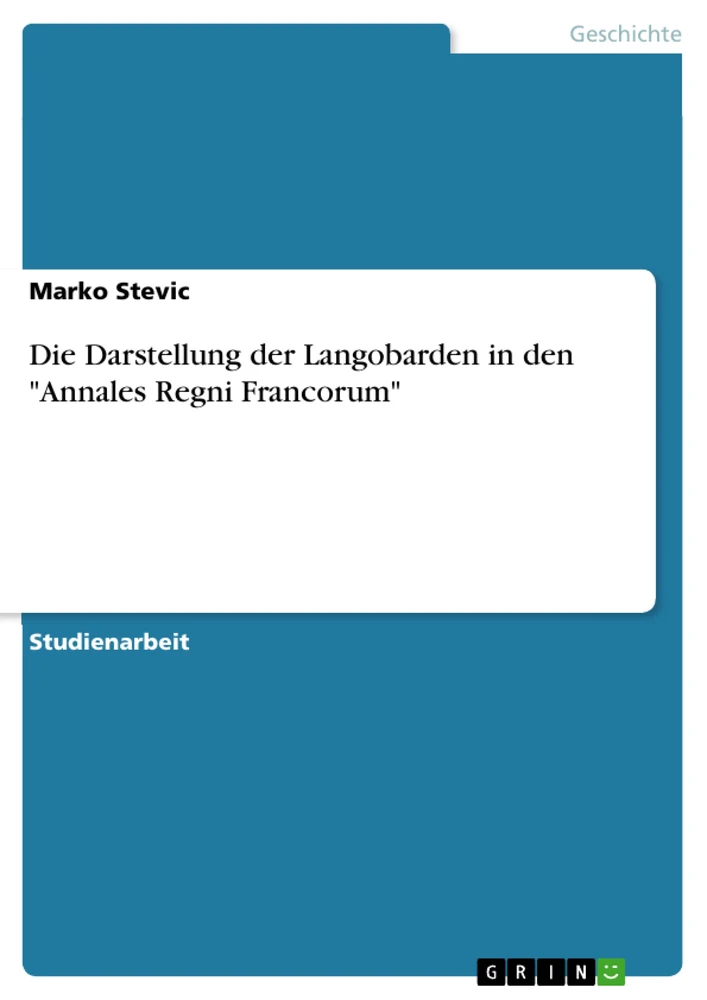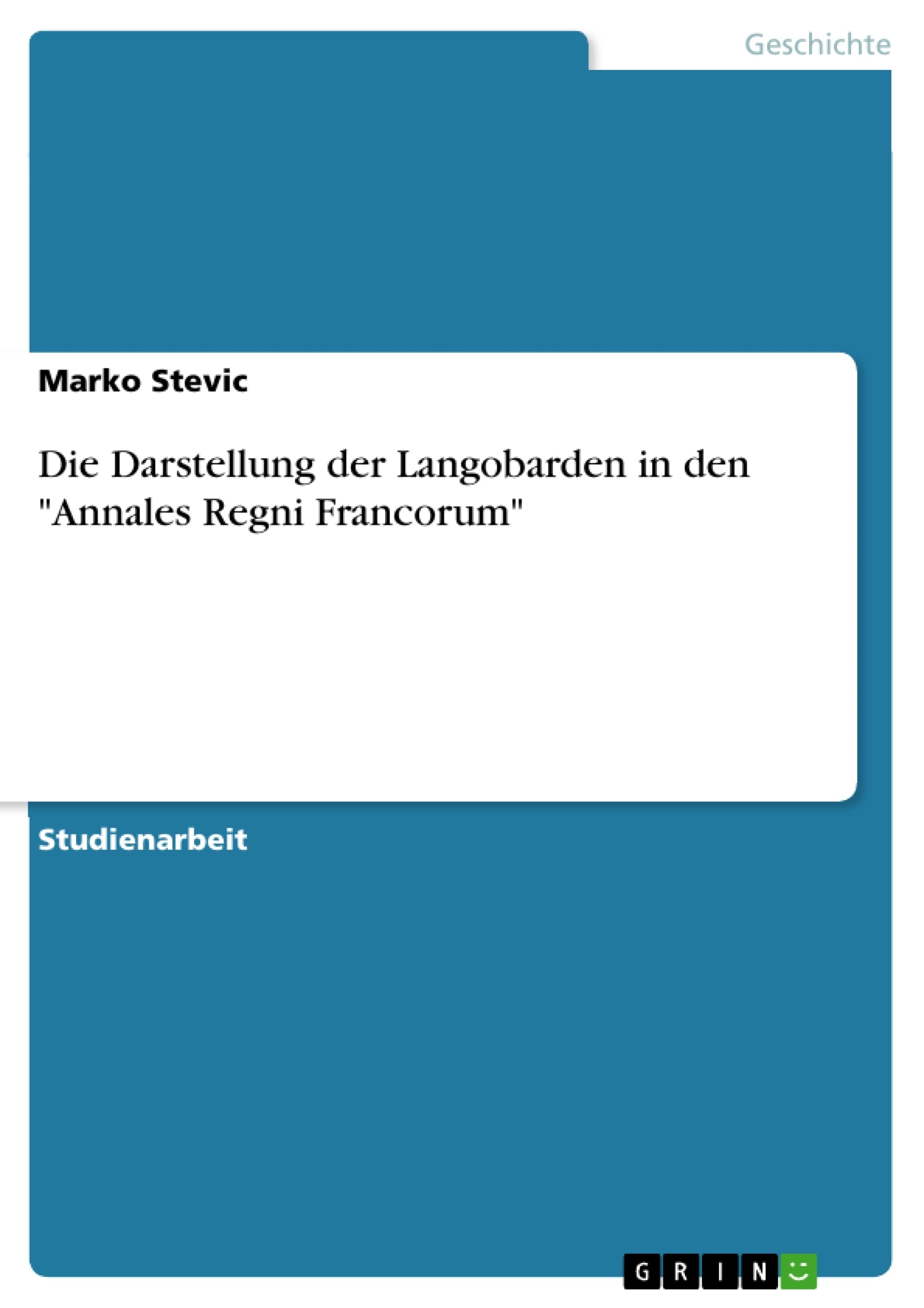Die vorliegende Arbeit widmet sich der Fragestellung, wie die Langobarden in den „Fränkischen Reichsannalen“ sowie der überarbeiteten Version, den „Einhardsannalen“ dargestellt wurden, und in welchen Bezügen die Darstellungen in diesen Quellen zum historischen Kontext ihrer Entstehungszeit stehen. Welche Absichten stecken hinter den Darstellungsweisen? Sind gewisse Diskurse feststellbar? Was für Abweichungen treten auf, und wie lassen sich diese erklären? Der Aufsatz berücksichtigt dabei die Zeitspanne, die sich zwischen der „Pippinischen Schenkung“ im Jahre 753 und dem Kriegszug nach Benevent im Jahre 800, der von Karls Sohn Pippin angeführt wurde, erstreckt.
Die verwendeten Quellentexte stammen aus der Freiherr von Stein-Gedächtnisausgabe: ARF, unter Benützung der Übersetzungen von Otto Abel und Julius von Jasmund neu bearb. und übers. von Reinhold Rau , in: Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte 1, Darmstadt 1955 (Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters, FSGA 5).
Bezüglich des Forschungsstandes sei auf Hartmanns Auflistung seiner Auswahl an rezipierter Literatur hingewiesen.1 Erwähnt seien Hägermanns umfangreiches Werk mit einer gewaltigen Anzahl von Quellenzitaten, reichhaltigen Ausführungen zur politischen und Sozialgeschichte, sowie Rosamond McKittericks „Studiensammlung“, die vertiefte Kenntnisse der Materie vermittelt.
Bezüglich der Methodologie wurden bei der vorliegenden Arbeit Quellentexte zitiert, wobei mittels durchgeführten „Inhaltsanalysen“ interne und mit Hilfe der verwendeten Sekundärliteratur externe Quelleninterpretationen unternommen wurden. Zusätzlich wurde der „historische Kontext“ erläutert. Betont sei, dass eine Auswahl vorgenommen wurde und dennoch der Rahmen gewaltig ausfiel und die Arbeit zu sprengen drohte. Die Arbeit ist thematisch folgendermassen gegliedert:
Nach der Einleitung erfolgt ein kurzer Abriss über die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte der Handschriften. Danach wird im dritten Teil Pippins Politik mit den Langobarden erläutert. Im vierten Teil wird die Heirat Karls mit der Tochter des Desiderius erklärt, sowie ihre anschliessende Verstossung und der „Bruch“ mit Desiderius. Im fünften Teil wird auf den Krieg Karls mit Desiderius sowie der Belagerung von Pavia eingegangen. Im sechsten Teil werden die Kriegszüge gegen den friaulischen Herzog Hrodgaud sowie gegen Benevent und Spoleto erläutert. Der siebte Teil bietet schliesslich eine überblicksartige Zusammenfassung, [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die „Reichsannalen“ als Quelle
- Pippin und Aistulf
- Die „Pippinische Schenkung“
- Kriegszug gegen Aistulf
- Karl der Grosse und die Tochter des Desiderius
- Die Nachfolge Papst Pauls I.
- Reichsteilung nach Pippins Tod
- Der Brief Papst Stephans III.
- Die Ehe mit der Tochter des Desiderius
- Krieg mit Desiderius
- Belagerung von Pavia
- Die Flucht des Adelchis
- Karl wird König der Langobarden
- Kriegszüge gegen Hrodgaud und Benevent
- Aufstand des Hrodgaud
- Kriegszüge gegen Benevent
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Langobarden in den „Fränkischen Reichsannalen“ und den „Einhardsannalen“, ihren Bezug zum historischen Kontext und die dahinterstehenden Absichten. Es werden Darstellungsweisen, Diskurse und Abweichungen analysiert, fokussiert auf die Zeit zwischen der „Pippinischen Schenkung“ (753) und dem Kriegszug nach Benevent (800).
- Die Darstellung der Langobarden in den „Reichsannalen“ und „Einhardsannalen“
- Der historische Kontext der Annalen und seine Auswirkungen auf die Darstellung
- Die Absichten und Diskurse hinter den unterschiedlichen Darstellungsweisen
- Analyse von Abweichungen zwischen den Quellen und deren Erklärung
- Die Rolle der „Pippinischen Schenkung“ und ihre Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Darstellung der Langobarden in den „Fränkischen Reichsannalen“ und „Einhardsannalen“, analysiert den historischen Kontext, die Intentionen der Autoren und etwaige Diskurse. Der Fokus liegt auf der Zeit zwischen der „Pippinischen Schenkung“ (753) und dem Benevent-Feldzug (800). Die Methodik umfasst Inhaltsanalysen und die Einbeziehung sekundärliterarischer Quellen.
Die „Reichsannalen“ als Quelle: Dieses Kapitel beleuchtet die „Annales regni Francorum“ (ARF), auch bekannt als „Fränkische Reichsannalen“, deren Entstehung und Überlieferung. Es wird auf die verschiedenen Handschriften, ihre Entstehungsorte und die Rolle Einharts als möglicher Überarbeiter eingegangen. Die Autoren fokussieren auf den König, verwenden verschiedene Quellen und vermeiden eine offizielle Darstellung. Die Frage der Urheberschaft und stilistischen Überarbeitungen wird diskutiert, wobei verschiedene Theorien und Meinungen von Historikern präsentiert werden. Die Bedeutung der ARF als Quelle für die Darstellung der Langobarden wird herausgestellt, ihre Weiterverwendung in anderen Annalen hervorgehoben und ihre Bedeutung für die historische Forschung betont.
Pippin und Aistulf: Dieses Kapitel analysiert die Ereignisse um die „Pippinische Schenkung“ und den darauf folgenden Krieg Pippins gegen Aistulf. Es vergleicht die Darstellungen in den „Reichsannalen“ und den „Einhardsannalen“, untersucht die Rolle Papst Stephans II. und die Intervention Karlmanns. Die Überarbeitung der „Einhardsannalen“ wird im Detail untersucht. Der Diskurs, der durch die unterschiedlichen Darstellungen entsteht, wird analysiert. Die politische Bedeutung der Schenkung und ihre Folgen für das Verhältnis zwischen Franken und Langobarden werden diskutiert. Der Text betont die strategische Bedeutung der Pippinischen Schenkung für den Papst und die langfristigen Folgen für die politische Landschaft Italiens.
Karl der Grosse und die Tochter des Desiderius: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Ehe Karls des Großen mit der Tochter des langobardischen Königs Desiderius und den damit verbundenen politischen Implikationen. Er analysiert die Darstellung dieses Ereignisses in den Quellen und seine Bedeutung für die späteren Konflikte zwischen Karl und Desiderius. Die verschiedenen politischen und religiösen Faktoren, die zu dieser Ehe und ihrer Auflösung führten, werden eingehend untersucht. Der Abschnitt betont auch die Rolle der päpstlichen Politik in diesen Ereignissen und die Komplexität der Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren.
Krieg mit Desiderius: Hier wird der Krieg Karls des Großen gegen Desiderius und die Belagerung von Pavia detailliert dargestellt, basierend auf den Quellen. Die militärischen Strategien, die politischen Motive und die Folgen des Krieges für die Langobarden werden analysiert. Der Abschnitt hebt die Bedeutung dieses Sieges für die Festigung der karolingischen Macht in Italien hervor und die endgültige Unterwerfung der Langobarden. Die Flucht von Adelchis und die Übernahme der langobardischen Krone durch Karl werden im Kontext der weiteren Entwicklungen des Frankenreiches betrachtet.
Kriegszüge gegen Hrodgaud und Benevent: Dieser Teil behandelt die Kriegszüge Karls gegen den friaulischen Herzog Hrodgaud und gegen Benevent. Die militärischen Kampagnen werden im Detail beschrieben und in den Kontext der karolingischen Expansionspolitik eingeordnet. Die Gründe für die Aufstände und die Strategien Karls werden analysiert. Der Abschnitt betont die Herausforderungen, denen sich Karl gegenüber sah, und seine Erfolge bei der Unterwerfung der aufständischen Regionen.
Schlüsselwörter
Langobarden, Fränkische Reichsannalen, Einhardsannalen, Pippin der Jüngere, Karl der Große, Aistulf, Desiderius, Pippinische Schenkung, Papst Stephan II., Italien, Quellenkritik, historische Kontextualisierung, Diskursanalyse, Kriegsführung, karolingische Herrschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung der Langobarden in den fränkischen Annalen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung der Langobarden in den „Fränkischen Reichsannalen“ und den „Einhardsannalen“ im Zeitraum zwischen der Pippinischen Schenkung (753) und dem Kriegszug nach Benevent (800). Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Darstellungsweisen, der historischen Kontexte und der dahinterliegenden Absichten der Autoren.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquellen sind die „Fränkischen Reichsannalen“ (Annales regni Francorum, ARF) und die „Einhardsannalen“. Die Arbeit untersucht die Entstehung, Überlieferung und die möglichen stilistischen Überarbeitungen dieser Annalen und diskutiert unterschiedliche Interpretationen und Theorien dazu.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert die Ereignisse um die Pippinische Schenkung, den Krieg Pippins gegen Aistulf, die Ehe Karls des Großen mit der Tochter Desiderius', den Krieg Karls gegen Desiderius inklusive der Belagerung von Pavia, und die Kriegszüge gegen Hrodgaud und Benevent. Dabei werden die jeweiligen Darstellungen in den Annalen verglichen und analysiert.
Welche Aspekte der Darstellung werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Darstellungsweisen der Langobarden in den Annalen, den historischen Kontext dieser Darstellungen, die Absichten und Diskurse der Autoren, Abweichungen zwischen den Quellen und deren mögliche Erklärungen, sowie die Rolle der Pippinischen Schenkung und ihrer Folgen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet Inhaltsanalysen der Annalen und bezieht sekundärliterarische Quellen ein, um die Darstellungen der Langobarden zu untersuchen und zu interpretieren. Die Quellenkritik spielt eine zentrale Rolle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, den Reichsannalen als Quelle, Pippin und Aistulf, Karl dem Großen und der Tochter Desiderius, dem Krieg mit Desiderius, den Kriegszügen gegen Hrodgaud und Benevent, und einer Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel fasst die relevanten Ereignisse zusammen und analysiert deren Darstellung in den Quellen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Langobarden, Fränkische Reichsannalen, Einhardsannalen, Pippin der Jüngere, Karl der Große, Aistulf, Desiderius, Pippinische Schenkung, Papst Stephan II., Italien, Quellenkritik, historische Kontextualisierung, Diskursanalyse, Kriegsführung, karolingische Herrschaft.
Welche Bedeutung hat die Pippinische Schenkung für die Arbeit?
Die Pippinische Schenkung bildet einen zentralen Punkt der Arbeit, da sie den Ausgangspunkt für die dargestellten Konflikte zwischen Franken und Langobarden darstellt und ihre langfristigen politischen Folgen für das Verhältnis zwischen Franken und Langobarden sowie für die italienische Politik analysiert werden.
Wie werden die Unterschiede zwischen den „Reichsannalen“ und den „Einhardsannalen“ behandelt?
Die Arbeit vergleicht die Darstellungen in den „Reichsannalen“ und den „Einhardsannalen“, untersucht mögliche Unterschiede und analysiert den Diskurs, der durch diese unterschiedlichen Darstellungen entsteht. Die Überarbeitung der „Einhardsannalen“ wird ebenfalls im Detail untersucht.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden in der Schlussbetrachtung zusammengefasst und bieten eine umfassende Interpretation der Darstellung der Langobarden in den ausgewählten Quellen im Kontext ihrer Zeit.
- Citar trabajo
- Marko Stevic (Autor), 2011, Die Darstellung der Langobarden in den "Annales Regni Francorum", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273939