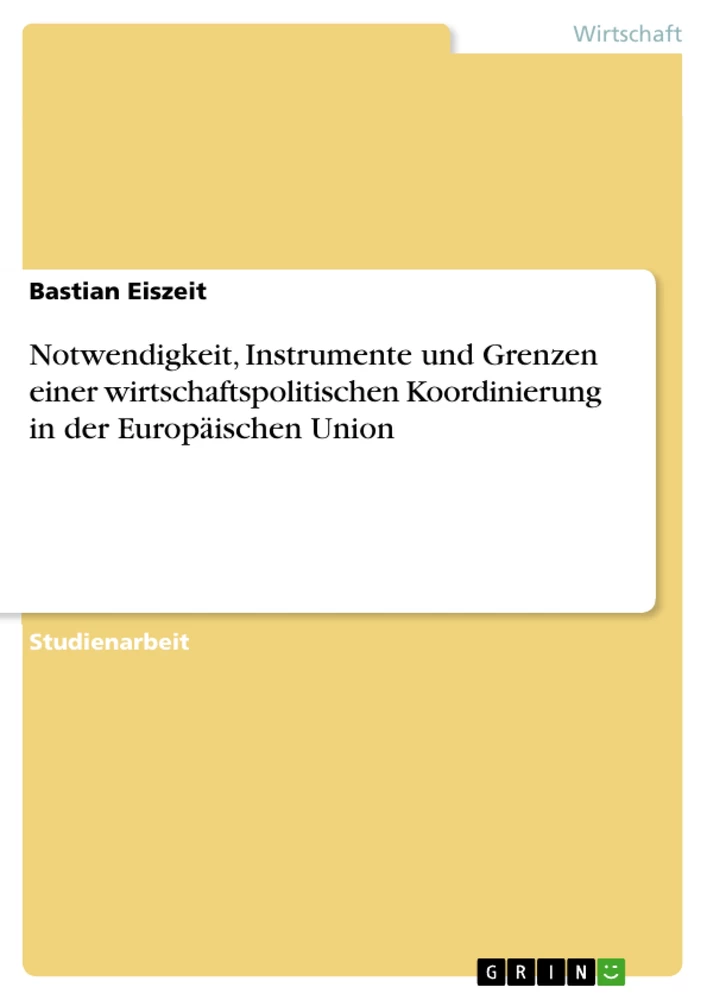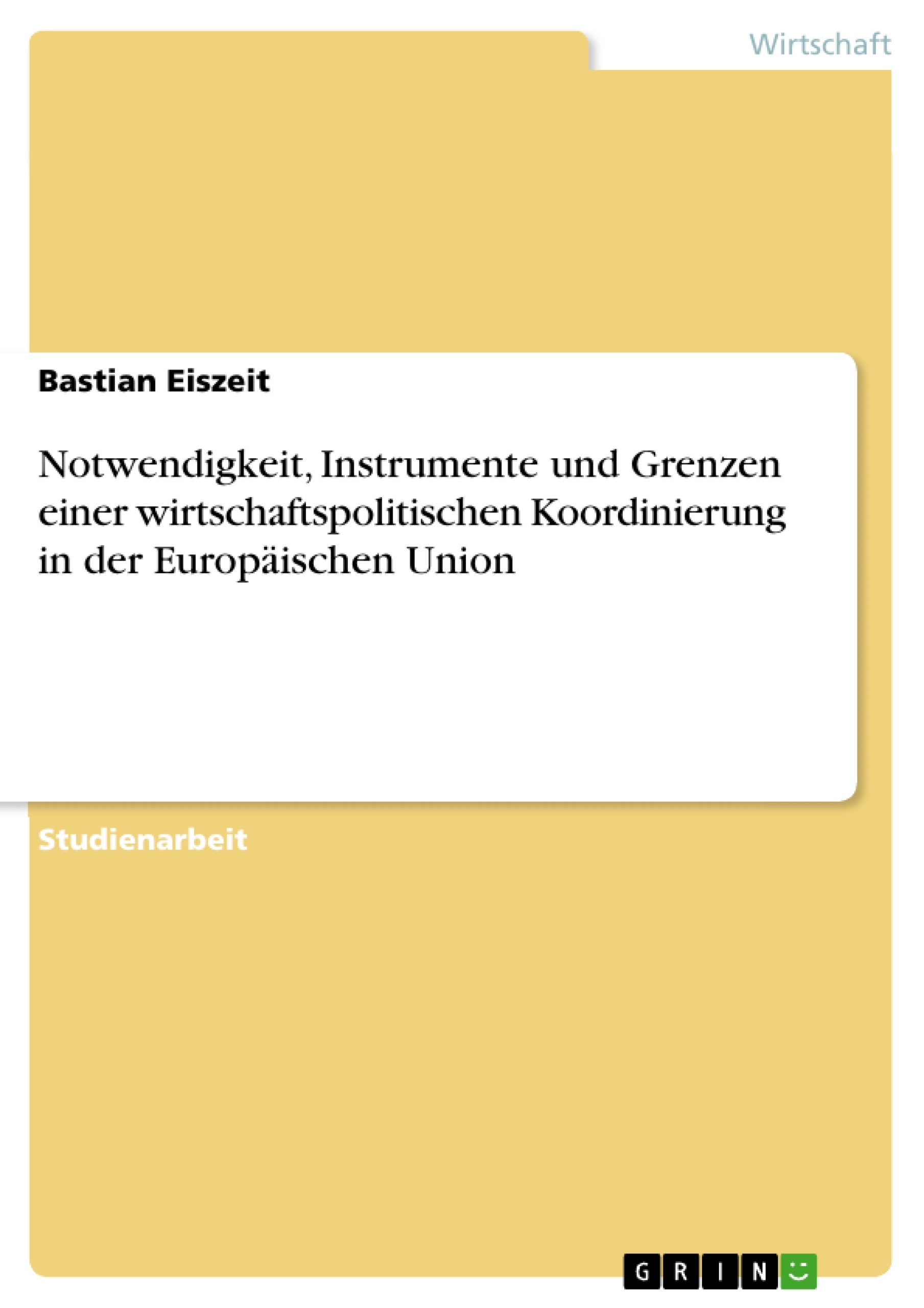Die Europäische Union, im Besonderen die Europäische Währungsunion, wurde in den letzten Jahren immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, bei den Bestrebungen ihr Ziel einen stabilen und weltweit führenden Wirtschaftsraum zu gestalten und zu erhalten. Auch wenn die Staatsschulden- und Finanzkrise eines der größeren Probleme darstellt, so gab es schon vor 2007 systematische Verstöße gegen die kooperativen Bestrebungen der Gemeinschaft, gemeinsam Wohlfahrt für alle EU-Bürger zu schaffen. In dieser Arbeit soll darum ein kurzer historischer Abriss über die Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion wiedergegeben, die Struktur und Instrumente der wirtschaftspolitischen Koordination auf europäischer Ebene, dabei im besonderen Fokus die Reformbemühungen ab 2010, aufgezeigt und die neuen geltenden
stabilitätsrelevanten Faktoren in aller kürze vorgestellt und evaluiert werden. Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit beschäftigt sich auch mit der Fragestellung, warum überhaupt eine Koordinierung der Wirtschaftspolitik in Europa notwendig ist und ob nicht die vorhandenen Mechanismen eben dies bereits in ausreichenden Maße gewährleisteten und die durchgeführten Reformen nicht als obsolet zu betrachten sind. Dabei wird nur unwesentlich auf die Arbeitsweise der Europäischen Institutionen eingegangen. Der Fokus der Ausführungen liegt, abgesehen von der essentiellen Bedeutung der Europäischen Kommission, vielmehr auf den vertraglichen Übereinkommen der Mitgliedstaaten und deren Auswirkungen. Dies liegt darin begründet, das die europäische Exekutive in weiten Teilen auf die Bereitschaft der Mitgliedstaaten angewiesen ist, da sie ohne diese nur schwer ihre Arbeit verrichten kann. Ebenfalls war und ist die Europäische Union immer auf das Wohlwollen fast aller Mitgliedstaaten angewiesen, wenn sie Versuche einer Reform oder Anpassung an die wirtschaftspolitischen Realitäten, dabei ist es unerheblich ob dies Bestrebungen zu mehr Integration generell oder mehr Macht- und Befugniskonzentration führen sollten, unternehmen wollte oder will. Die besondere Relevanz der Thematik, welche die treibende Kraft dieser Betrachtung und Analyse war, liegt in der allumfassenden Bedeutung für mehr als 500 Millionen Menschen. Europa befindet sich, abgesehen von einzelnen Rückschlägen bei den Integrationsbemühungen1 sowie unterschiedlichen Vorstellungen einiger Partner auf dem Weg zu einer supranationalen Institution für die bisher keine Referenzgrößen vorhanden sind, an welchen man .....
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Aufbau der Arbeit
- Europäische koordinierte Wirtschaftspolitik
- Die Notwendigkeit einer integralen Wirtschaftspolitik
- Der Weg zur WWU
- Stabilitäts- und Wachstumspakt von 1999 bis 2010
- Der Waigel-Plan und der Stabilitäts- und Wachstumspakt von Dublin
- Konzeptionelle Alternativvorstellungen zum Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Abschaffung des Paktes ganzheitlich
- Geldpolitischer Stabilitätspakt
- Steuern für Kredite
- Beispiele systematischen Versagens des SWP
- Beispiel: Griechenland
- Beispiel: Deutschland
- Konsequenzen des Systemversagens
- Entwicklungen und Reformen ab 2010
- Das Europäische Semester
- Economic Governance-Paket
- Neue sanktionsauslösende Verfehlungen
- Neue Sanktionsmöglichkeiten
- Quasi-Automatismus in der Verfolgung von Verletzungen
- Monitoring durch Scoreboard
- Kritik am Six Pack
- Two-Pack
- Fiscal Compact
- Kritik am Fiskalpakt
- Euro-Plus-Pakt
- Kritik am Euro-Plus-Pakt
- Grenzen der Integration
- Schlussbetrachtung
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Websiteverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Notwendigkeit, Instrumente und Grenzen einer wirtschaftspolitischen Koordinierung in der Europäischen Union. Sie untersucht die Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion, insbesondere die Reformbemühungen ab 2010, und evaluiert die neuen geltenden stabilitätsrelevanten Faktoren. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob eine Koordinierung der Wirtschaftspolitik in Europa notwendig ist und ob die vorhandenen Mechanismen dies bereits gewährleisten. Dabei liegt der Fokus auf den vertraglichen Übereinkommen der Mitgliedstaaten und deren Auswirkungen.
- Notwendigkeit einer koordinierten Wirtschaftspolitik in der EU
- Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
- Reformbemühungen ab 2010, insbesondere der Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Grenzen der Integration und die Rolle der Mitgliedstaaten
- Auswirkungen der Wirtschaftspolitik auf die EU-Bürger
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Europäischen Union als Wirtschaftsraum vor, die in den letzten Jahren vor immer neue Herausforderungen gestellt wurde. Die Arbeit analysiert die Geschichte der Wirtschafts- und Währungsunion, die Struktur und Instrumente der wirtschaftspolitischen Koordinierung auf europäischer Ebene und die neuen geltenden stabilitätsrelevanten Faktoren.
Das Kapitel 2.1 beleuchtet die Notwendigkeit einer integralen Wirtschaftspolitik in der EU. Die einheitliche Geldpolitik der Europäischen Währungsunion hat den Mitgliedstaaten die Möglichkeit genommen, auf wirtschaftliche Phasen durch Anpassung des Wechselkurses zu reagieren. Die EZB als unabhängige Zentralbank ist primär der Preisniveaustabilität verpflichtet, wodurch die Mitgliedstaaten bei der Ausübung ihrer Wirtschaftspolitik auf die Fiskalpolitik beschränkt sind. Die heterogenen Interessen der Mitgliedstaaten können zu einer Destabilisierung des Euro und des gemeinsamen Währungsraumes führen.
Kapitel 2.2 beschreibt den Weg zur WWU. Die supranationalen Bemühungen zur Schaffung einer engen Kooperation in Europa wurden durch den Fall der Berliner Mauer intensiviert. Der Europäische Rat einigte sich im Juni 1988 darauf, die Wirtschafts- und Währungsunion in drei Schritten zu realisieren. Die erste Stufe begann im Juli 1990, die zweite im Januar 1994 und die dritte im Januar 1999 mit der Einführung des Euros als Buchgeld.
Kapitel 2.3.1 untersucht den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der 1997 in Amsterdam beschlossen wurde. Der Pakt verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einem ausgeglichenen Haushalt und zur Einhaltung der Konvergenzkriterien. Bei einer sich abzeichnenden Neuverschuldung über 3% des BIP wird ein „Verfahren wegen übermäßigen Defizits" eingeleitet.
Kapitel 2.3.2 analysiert verschiedene Konzeptionelle Alternativvorstellungen zum Stabilitäts- und Wachstumspakt, wie die Abschaffung des Paktes, einen geldpolitischen Stabilitätspakt und die Einführung von Steuern für Kredite.
Die Kapitel 3.1 und 3.2 zeigen Beispiele systematischen Versagens des SWP am Beispiel von Griechenland und Deutschland auf. Griechenland erfüllte die Konvergenzkriterien nicht, wurde aber trotzdem in den Euro aufgenommen. Deutschland wurde 2002 eine Frühwarnung ausgesprochen, da es die SWP-Ziele nicht einhielt. Die Reformen 2004/2005, die die negativen Impulse der Finanzkrise 2007 bzw. der Staatsschuldenkrise ab 2010 begünstigten, zeigten die Machtposition einzelner Länder und die Grenzen des SWP.
Kapitel 4.1 stellt das Europäische Semester vor, das die wirtschaftlichen Integrationsbemühungen besser koordinieren soll. Das Europäische Semester bietet die Rahmenbedingung für die folgenden Reformen.
Kapitel 4.2 beschreibt das Economic Governance-Paket, auch als „Six Pack" bekannt. Das Paket zielte auf die Beschleunigung des Defizitverfahrens, eine garantierte Durchsetzung der Bestimmungen und die Nutzung eines „Scoreboards" zur makroökonomischen Überwachung.
Kapitel 4.3 analysiert die Kritik am Six Pack. Befürworter sehen die Wirksamkeit des Pakets bestätigt, während links-liberale Politiker eine zu einseitige Sparzwangpolitik kritisieren.
Kapitel 4.4 beschreibt den „Two-Pack", der eine Verschärfung des Six-Packs darstellt. Der Two-Pack regelt die Überwachung und Koordinierung der Haushaltspläne der Euro-Länder.
Kapitel 4.5 untersucht den Fiscal Compact, ein völkerrechtlicher Vertrag, der die Mitgliedstaaten zu einem ausgeglichenen Haushalt verpflichtet. Verletzungen des Vertrages werden nicht auf europäischer Ebene verfolgt, sondern können vor dem EuGH verklagt werden.
Kapitel 4.6 analysiert die Kritik am Fiskalpakt. Viele Politiker sehen im Pakt einen anmaßenden Eingriff in die staatliche Souveränität.
Kapitel 4.7 beschreibt den Euro-Plus-Pakt, eine Übereinkunft der Euro-Währungsländer über die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und Finanzstabilität.
Kapitel 4.8 analysiert die Kritik am Euro-Plus-Pakt. Kritiker befürchten, dass die Verordnungen den weniger wettbewerbsfähigen Staaten Opfer abverlangen.
Kapitel 5 beleuchtet die Grenzen der Integration. Die strukturellen Probleme der Euro-Krise sind seitens der Mitgliedstaaten verschuldet. Die Aufweichung des Fiskalpaktes 2004/2005 und die Nichtbeachtung der Vorschriften führten zu einer Destabilisierung des Euros.
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen. Die Europäische Union ist ein Projekt auf supranationaler Ebene, das Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten zu überbrücken versucht. Die wirtschaftliche Integration kann den Menschen die Notwendigkeit der EU zeigen. Die Integrationsbemühungen müssen weitergeführt werden, um einen koordinativen Prozess der Leistungserzeugung zu steuern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die wirtschaftspolitische Koordinierung, die Europäische Union, die Europäische Währungsunion (WWU), der Stabilitäts- und Wachstumspakt, die Reformbemühungen ab 2010, das Economic Governance-Paket (Six Pack), der Two-Pack, der Fiscal Compact, der Euro-Plus-Pakt, die Grenzen der Integration und die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik auf die EU-Bürger. Der Text beleuchtet die Notwendigkeit einer koordinierten Wirtschaftspolitik in der EU, die Entwicklung der WWU und die Herausforderungen der Integration.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist eine koordinierte Wirtschaftspolitik in der EU notwendig?
Da die Mitgliedstaaten der Währungsunion keine eigenständige Wechselkurspolitik mehr betreiben können, müssen Fiskal- und Wirtschaftspolitik koordiniert werden, um die Stabilität des Euro zu sichern.
Was ist das „Six Pack“ (Economic Governance-Paket)?
Es handelt sich um ein Reformpaket von 2010, das Sanktionen bei Defizitverstößen automatisiert und ein „Scoreboard“ zur Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte einführte.
Welche Kritik gibt es am Stabilitäts- und Wachstumspakt?
Kritiker bemängeln entweder zu hohe Hürden für weniger wettbewerbsfähige Staaten oder eine zu schwache Durchsetzung der Regeln durch die politische Einflussnahme der Mitgliedstaaten.
Was beinhaltet der Fiskalpakt (Fiscal Compact)?
Der Fiskalpakt ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der die Unterzeichnerstaaten zu einer Schuldenbremse und einem ausgeglichenen Haushalt verpflichtet.
Was sind die Grenzen der europäischen Integration in der Wirtschaftspolitik?
Die Grenzen liegen in der staatlichen Souveränität der Mitgliedstaaten, den heterogenen nationalen Interessen und der Bereitschaft, Kompetenzen an supranationale Institutionen abzugeben.
- Arbeit zitieren
- Bastian Eiszeit (Autor:in), 2013, Notwendigkeit, Instrumente und Grenzen einer wirtschaftspolitischen Koordinierung in der Europäischen Union, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274058