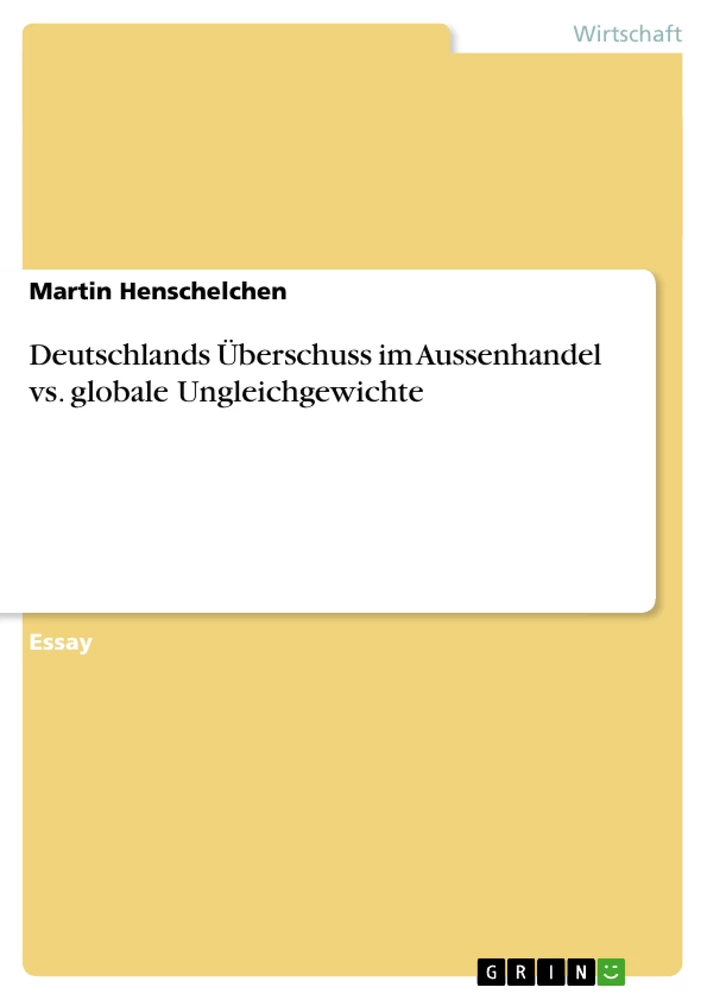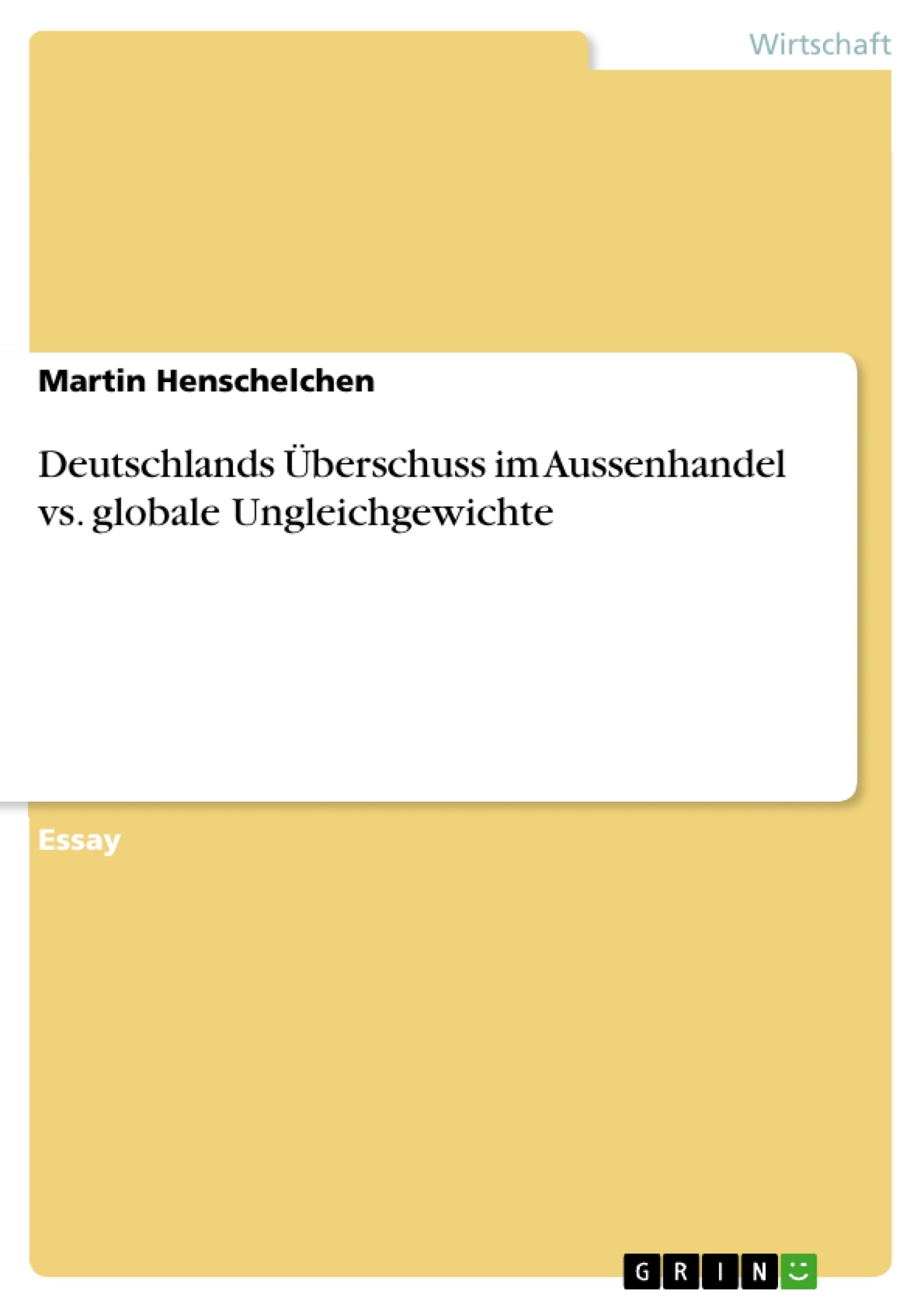Deutschland hat einen hohen Überschuss im Außenhandel.
Viele Länder fordern die Bundesregierung auf, etwas dagegen zu tun, um so die
Ungleichgewichte in Europa und der Welt zu lindern.
Die deutschen Exporteure finden zurück zu neuer Stärke und bleiben Garant des Aufschwungs. Dank glänzender Geschäfte in boomenden Schwellenländern wie China
verkauften die Unternehmen im September 3,0 Prozent mehr ins Ausland als im Vormonat - doppelt so viel wie erwartet. Insgesamt wurden Waren im Wert von 86,9
Milliarden Euro abgesetzt und damit 22,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt zuletzt mit. Das ist der höchste Umsatz seit knapp zwei Jahren.
Der Branchenverband rechnet 2010 mit dem stärksten Zuwachs seit zehn Jahren.
So positiv sieht man dies offensichtlich nicht im Ausland.Es herrscht Missgunst und Streit über globale Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen, vermeintliche Währungsmanipulationen und unfaire Wettbewerbsvorteile. Den Deutschen wird vorgeworfen, sie leben auf Kosten anderer Länder, da sie zu viel exportieren und zu wenig konsumieren. Die produzierten Handelsbilanzüberschüsse treiben die Defizitländer so in die Verschuldung. Gleichzeitig verschaffe sich Deutschland durch den schwachen Euro und durch zurückhaltende Lohnsteigerungen auf unfaire Art und Weise Wettbewerbsvorteile. Zu alledem weigert man sich, die Binnenwirtschaft durch neue Konjunkturprogramme anzukurbeln und dadurch die Absatzchancen ausländischer Waren hierzulande zu verbessern. Die Schwere Kritik kommt unter anderem von US-Präsident Barack Obama und dessen Finanzminister Timothy Geithner. Ebenso kritisch äußern sich Fachleute wie beispielsweise der Ökonomienobelpreisträger Paul Krugman zur deutschen Sparpolitik (“And it’s also important to send a message to the Germans: we are not going to let them export the consequences of their obsession with austerity. Nicely, nicely isn’t working. Time to get tough.”).1 Man fordert, einen Überschuss auf höchstens vier Prozent der Wirtschaftsleistung zu begrenzen und von deutscher Seite den Sparkurs aufzugeben, die Löhne zu erhöhen sowie neue Konjunkturprogramme zu starten.
Inhaltsverzeichnis
Deutschlands Überschuss im Aussenhandel vs. globale Ungleichgewichte
M. Henschelchen
Einleitung
2 Definition: Überschuss im Außenhandel
2.1 Leistungsbilanz
2.2 Leistungsbilanzüberschuss
2.3 Leistungsbilanzdefizit
2.4 Beziehungszusammenhang
2.5 Einflussfaktoren am Model einer Volkswirtschaft
3 Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss
4 Europäische Leistungsbilanz
5 Phänomen der globalen Ungleichgewichte
5.1 Auswirkungen globaler Ungleichgewichte auf die Weltwirtschaft
5.2 Mögliche Erklärungsperspektiven
6 Subsumtion
7 Makroökonomische Ungleichgewichte in der EWWU
7.1 Entwicklung
7.2 Schlussfolgerungen für Europa
7.3 Berechtigung der Forderungen an die deutsche Bundesregierung
8 Lösungsansätze und mögliche Implikationen
Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die deutschen Exporteure finden zurück zu neuer Stärke und bleiben Garant des Aufschwungs. Dank glänzender Geschäfte in boomenden Schwellenländern wie China verkauften die Unternehmen im September 3,0 Prozent mehr ins Ausland als im Vormonat - doppelt so viel wie erwartet. Insgesamt wurden Waren im Wert von 86,9 Milliarden Euro abgesetzt und damit 22,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt zuletzt mit. Das ist der höchste Umsatz seit knapp zwei Jahren. Der Branchenverband rechnet 2010 mit dem stärksten Zuwachs seit zehn Jahren.
So positiv sieht man dies offensichtlich nicht im Ausland. Es herrscht Missgunst und Streit über globale Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen, vermeintliche Währungs- manipulationen und unfaire Wettbewerbsvorteile. Den Deutschen wird vorgeworfen, sie leben auf Kosten anderer Länder, da sie zu viel exportieren und zu wenig konsumieren. Die produzierten Handelsbilanzüberschüsse treiben die Defizitländer so in die Verschuldung. Gleichzeitig verschaffe sich Deutschland durch den schwachen Euro und durch zurückhaltende Lohnsteigerungen auf unfaire Art und Weise Wettbewerbsvorteile. Zu alledem weigert man sich, die Binnenwirtschaft durch neue Konjunkturprogramme anzukurbeln und dadurch die Absatzchancen ausländischer Waren hierzulande zu verbessern. Die Schwere Kritik kommt unter anderem von US-Präsident Barack Obama und dessen Finanzminister Timothy Geithner. Ebenso kritisch äußern sich Fachleute wie beispielsweise der Ökonomienobelpreisträger Paul Krugman zur deutschen Sparpolitik (“And it’s also important to send a message to the Germans: we are not going to let them export the consequences of their obsession with austerity. Nicely, nicely isn’t working. Time to get tough.”).1 Man fordert, einen Überschuss auf höchstens vier Prozent der Wirtschaftsleistung zu begrenzen und von deutscher Seite den Sparkurs aufzugeben, die Löhne zu erhöhen sowie neue Konjunkturprogramme zu starten. Die US-Amerikanische Führung räumte zwar ein, ihren Konsum auf Pump einschränken zu müssen aber andere Länder müssten auch etwas tun. "Kein einzelnes Land kann unser gemeinsames Ziel einer starken, dauerhaften und ausgewogenen Erholung auf sich selbst gestellt erreichen".2 Die USA unterliegen derzeit einem gewaltigen Handelsbilanzdefizit. Daher fordert die US-Führung, insbesondere Unter- stützung von Deutschland und China (China wird vorgeworfen ihre Landeswährung zum Vorteil seiner Exporte künstlich niedrig zu halten). Beide Nationen gehören weltweit zu den größten Exportnationen. Stimmen aus Deutschland äußerten sich bisher vor allem kontrovers. Man ist hierzulande offensichtlich der Meinung, dass sich Ungleichgewichte in den Handelsbeziehungen eher auf die starke Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte zurückführen lassen. Deutscher Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) bezeichnete die Forderungen der US-Amerikaner als "inakzeptablen Rückfall in planwirtschaftliches Denken. Es wäre absurd, Länder dafür zu bestrafen, dass sie international wettbewerbsfähig sind und dazu beitragen, die Weltwirtschaft aus der Krise zu bringen."3
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnte erneut Zielkorridore oder andere messbare Vorgaben für Handelsströme ab und machte klar, "Quantifizierte Ziele wird Deutschland jedenfalls nicht mittragen“.4 Eine politische Festlegung von Obergrenzen für Leistungsbilanzüberschüsse oder -defizite sei "weder ökonomisch gerechtfertigt noch politisch angemessen. Dies wäre unvereinbar mit dem Ziel eines freien Welthandels."5
Kritik kommt jedoch nicht nur aus den USA, auch auf Gemeinschaftsebene wächst der Druck. So warf die französische Finanzministerin Christine Lagarde Deutschland vor, man exportiere sich auf Kosten der Partnerländer aus der Krise. Als Ursache wird unter anderem die deutsche Lohnpolitik angeführt. Deutschland halte im Vergleich zu seinen Nachbarn den Anstieg der Lohnstückkosten künstlich niedrig und nehme über die entstehenden Wettbewerbsvorteile anderen Mitgliedsstaaten so Marktanteile ab. Auch in Griechenland ist man dieser Meinung und mache Deutschland mitverantwortlich für die derzeitige Krise. Der französische Staatschef Nicolas Sarkozy hält gar ein neues Bretton-Woods-Abkommen für nötig,6 mit dem bereits nach dem zweiten Weltkrieg versucht wurde die demolierte Weltwirtschaft zu stabilisieren indem man sich auf feste Wechselkurse der Währungen zum Dollar einigte.
Obersatz:
Deutschland hat einen hohen Überschuss im Außenhandel. Viele Länder fordern die Bundesregierung auf, etwas dagegen zu tun, um so die Ungleichgewichte in Europa und der Welt zu lindern. Bewerten Sie diesen Vorschlag!
2 Definition: Überschuss im Außenhandel
2.1 Leistungsbilanz
Ein möglicher Überschuss im Außenhandel lässt sich anhand des Saldos deLeistungsbilanz verdeutlichen. Sie dokumentiert im Wesentlichen alle wirtschaftlichen Transaktionen im Güter- und Faktorenhandel zwischen In- und Ausland und gibt an wie leistungsfähig die Außenwirtschaft eines Landes ist (Zentrale Frage: „Sind die Importe durch die Exporte finanziert?“). Ein positiver Saldo kennzeichnet die erwirtschafteten Devisenüberschüsse. Der Leistungsbilanzsaldo ergibt sich aus dem Außenbeitrag zuzüglich dem Bilanzsaldo laufender Übertragungen. Folgende Formel kennzeichnet die Zusammenhänge:
(Bruttoinlandsprodukt + Importe) = (Konsum + Investitionen + Exporte)
Y+ Im = C + I + Ex
Die Leistungsbilanz selbst gilt neben der Kapitalbilanz, Devisenbilanz und Vermögensübertragungsbilanz als eine Teilbilanz der Zahlungsbilanz. Die Leistungsbilanz lässt sich weiter untergliedern in folgende Unterbilanzen:
Die Handelsbilanz erfasst alle grenzüberschreitenden Warentransaktionen als Gegenüberstellung von Warenexporten und Warenimporten und stellt regelmäßig die größte Teilbilanz der Leistungsbilanz dar. Sie erfasst die Exporte und Importe von Sachgütern, soweit diese mit einer Eigentumsübertragung verbunden sind (ausgenommen der Veredelungshandel). Die Dienstleistungsbilanz bezeichnet grenzüberschreitende Dienstleistungstransaktionen anhand der Gegenüberstellung von Dienstleistungsexporten und Dienstleistungsimporten. Ein Dienstleistungsimport liegt vor, wenn Inländer vom Ausland angebotene Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ein Dienstleistungsexport dagegen wenn umgekehrt Ausländer vom Inland angebotene Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
In der Übertragungsbilanz werden als Gegenüberstellung die geleisteten und empfangenen laufenden Übertragungen verbucht. Dabei werden als unentgeltlicher Transfer solche Leistungen gebucht, die ohne eine direkte Gegenleistung erfolgen.
Die Bilanz der Erwerbs- und Vermögenseinkommen dokumentiert die Faktoren- einkommensströme zwischen Inländern und Ausländern, mit der Gegenüberstellung von empfangenen und geleisteten Erwerbs- und Vermögenseinkommen. Dazu zählen Einkommen aus unselbständiger Arbeit sowie Einkommen aus Vermögen, welche Inländer aus dem Ausland bzw. Ausländer im Inland erwerben.7
2.2 Leistungsbilanzüberschuss
Bei einem Leistungsbilanzüberschuss ist der Saldo aus Ex- und Import von Gütern und Dienstleistungen positiv. Es kommt somit zu einem Anstieg des Nettoauslandsvermögens. Dabei ergibt sich die Höhe der Vermögenswertänderung aus der Summe vom Saldo der Leistungsbilanz und dessen der Vermögensübertragung. Dieser Vermögenszuwachs ist nicht nur positiv zu deuten, stellt er schließlich auch einen Abfluss von Kapital ins Ausland dar, der sich negativ auf die Höhe der möglichen Inlandsinvestitionen auswirkt. Eine sinkende Inlandsnachfrage und Unterbeschäftigung sind die Folge. Der mit Exportüberschüssen assoziierte Kapitalexport führt somit zu einem abgeschwächten Wirtschaftswachstum wenn nicht Exportüberschüsse durch Devisentransaktionen der Notenbank ausgeglichen werden. Auf der anderen Seite führen jedoch Exportüberschüsse zu Überproduktion mit dementsprechendem Arbeitskräftebedarf.
2.3 Leistungsbilanzdefizit
Im Gegensatz zum Leistungsbilanzüberschuss entsteht ein Leistungsbilanzdefizit wenn weniger exportiert als importiert wird. Ein Sinken des Nettoauslandsvermögens ist die Folge. Steht einem solchen negativen Außenbeitrag gleichzeitig ein Haushaltsdefizit gegenüber, spricht man von einem Doppeldefizit.
Analog zum Leistungsbilanzüberschuss kann dies sowohl negativ als auch positiv gedeutet werden. So stellt ein negativer Außenbeitrag einen Zufluss von ausländischem Kapital dar, welches zu einer entsprechend erhöhten Inlandsinvestition führen kann. Zu beachten ist, dass ein Leistungsbilanzdefizit jedoch nicht nur durch Importüberschüsse entstehen kann sondern auch wenn die Inlandnachfrage die eigene Wertschöpfung übersteigt.
2.4 Beziehungszusammenhang
Der Leistungsbilanzsaldo wird im Wesentlichen durch den Saldo der Waren- und Dienstleistungsimporte bzw. -Exporte bestimmt. Deren Höhe spiegelt sich in den Ersparnissen und Investitionen einer Volkswirtschaft wider. Der Beziehungszusammenhang lässt sich mathematisch wie folgt ableiten:
Y = a + b (Y-T) + G + d - n r + X - m Y
- Y = Einkommen
- a = konstante Konsumnachfrage
– b = Konsumneigung
– T = Steuern
– G = Staatsausgaben
– d = maximale Investitionen
– r = Realzins
– X = Export
– M = Importneigung
Der Konsum C) einer Volkswirtschaft ergibt sich aus dem konstanten Teil der Konsumnachfrage multipliziert mit dem Einkommen nach Steuern:
C = a + b (Y-T)
Die Volkswirtschaftlichen Investitionen (I)ergeben sich aus dem Realzins und der maximalen Investitionskraft:
I = d - n r
Der Nettoexport bzw. Leistungsbilanzsaldo (NX)ergibt sich wiederum aus dem Export abzüglich der Importneigung
NX = X - m Y
Dazu wirken sich auch die Staatsausgaben G) auf das Inlandsprodukt aus.
Die volkswirtschaftliche Ersparnis (S) ergibt sich wiederum aus dem Einkommen abzüglich der Staatsausgaben und dem Konsum:
S = Y - C - G
Löst man die Gleichung nun nach der volkswirtschaftlichen Ersparnis auf, erhält man die
Beziehung zwischen Ersparnis/Investition zum Leistungsbilanzsaldo.
Y = a + b (Y-T) + G + d - n r + X - m Y
Y = C + G + I + NX
Y - C - G = I + NX
S = I + NX | NX = S - I
Daraus folgt, dass der Leistungsbilanzsaldo dem Saldo aus Ersparnissen und Investitionen entspricht. Folgendes Model verdeutlicht den Zusammenhang:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung: Beziehungszusammenhang
S, I
0 Leistungsbilanzsaldo
Im stark vereinfachten Model wird von einer Volkswirtschaft mit vollkommenem Kapitalmarkt ausgegangen, mit nur sehr geringem Einfluss auf den Weltzinssatz (r). Es zeigt sich die Abhängigkeit der Höhe der Ersparnisse und Investitionen vom Weltzinssatz. Einem hohen Zinssatz folgen somit hohe Ersparnisse und entsprechend niedrige Investitionen. Es stellt sich ein Leistungsbilanzüberschuss ein. Bei einem niedrigem Zinssatz verhält es sich entsprechend spiegelbildlich.
2.5 Einflussfaktoren am Model einer Volkswirtschaft
Dem vereinfachten Model der im „Beziehungszusammenhang“ dargestellten Volkswirtschaft nach, führt ein niedriger Weltzinssatz zu einer hohen Investition. Es kommt zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch. Reichen die Produktionskapazitäten nicht aus und muss der Verbrauch durch Importe gedeckt werden, steht nur noch ein geringerer Teil der inländischen Produktionskapazität für den Export zur Verfügung. Damit sinkt die Exportmenge und es kommt zu einem Importüberschuss. Tendenziell ist ein defizitärer Leistungsbilanzsaldo die Folge. Ein Leistungsbilanzüberschuss dagegen folgt entsprechend einem hohen Weltzinssatz. Neben dem Weltzinssatz wirkt sich auch die Fiskalpolitik der jeweiligen Volkswirtschaft aus. So können beispielsweise Steuersenkungen zu einem höheren Einkommen führen und damit tendenziell zu einer Konsumsteigerung. Die staatlichen Ersparnisse und volkswirtschaftliche Gesamtersparnis würden sich durch die fehlenden Steuereinnahmen entsprechend reduzieren. Ein erhöhter Ressourcenverbrauch und Importüberschüsse wären wiederum die Folge. Es käme damit tendenziell zu einem Leistungsbilanzdefizit. Neben den fiskalpolitischen Bedingungen beeinflusst auch das Verhältnis von Export- zu Importpreisen und damit letztlich das Realeinkommen die Leistungsbilanz.
Die Frage einer protektionistischen Einflussnahme kann dabei ebenso eine entscheidende Rolle spielen. Versucht ein Staat beispielsweise die Einfuhr ausländischer Güter regulatorisch zu begrenzen, führt dies automatisch zu einer Erhöhung des Nettoexportüberschusses (kurzfristig). Diese Art der Einflussnahme wirkt sich jedoch für sich betrachtet nicht auf die Ersparnisse oder Investitionen eines Landes aus und damit auch nicht auf den Leistungsbilanzsaldo. Es würde sich letztlich also das gleiche Verhältnis einstellen. Dies wäre verbunden mit einer Erhöhung des Wechselkurses mit einer dementsprechenden Verteuerung der Produkte. Die Folge ist ein Exportrückgang mit einer verbundenen Abnahme des Handelsvolumens und einer entsprechenden Wohlstandsabnahme. Soviel zum vereinfachten Model. In einer großen Volkswirtschaft kann man jedoch davon ausgehen, dass wirtschaftspolitische Maßnahmen den Zinssatz ebenso beeinflussen und somit letztlich auch den Leistungsbilanzsaldo.
3 Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss
Abbildung: Leistungsbilanz8
Wie das Statistische Bundesamt für das zweite Quartal meldete, ist der deutsche Leistungsbilanzüberschuss erneut stark gestiegen. Ende des zweiten Quartals lag dieser bei 12,9 Mrd. €. Dieser Einnahmenüberschuss kann zur Finanzierung von anderen Zahlungsabflüssen dienen, die in den weiteren Teilbilanzen der Zahlungsbilanz erfasst werden. Der Wert ergibt sich zum einen aus dem hohen Aktivsaldo der Handelsbilanz zum andern durch das regelmäßige geringe Defizit im Bereich der Leistungstransaktionen, welche Dienstleistungen, Erwerbs- und Vermögenseinkommen sowie laufende Übertragungen umfassen. Der Aktivsaldo im Außenhandel stieg um 4,3 Mrd. € auf 14,1 Mrd. €. Zu einem negativen Saldo kam es ebenso bei den Direktinvestitionen in Höhe von 15,3 Mrd. €. Verantwortlich dafür war vorwiegend das Auslandsengagement deutscher Unternehmen. Ausländische Unternehmen investierten dagegen in einem geringeren Ausmaß in ihren deutschen Gesellschaften.
Der übrige Kapitaltransfer ergab im Juni Netto-Kapitalzuflüsse in Höhe von 43,6 Mrd. €.9 Wie das Statistische Bundesamt zuletzt meldete, wurden von Deutschland im September 2010 Waren im Wert von 86,9 Mrd. € exportiert und Waren im Wert von 70,1 Mrd. € importiert. Damit stiegen die Exporte im September um 22,5% und die Importe um 18,0% im Vergleich zum Vorjahr. Es zeichnete sich damit für September 2010 ein Handelsbilanzüberschuss in Höhe von 16,8 Mrd. € ab. Im Vergleich dazu betrug der Vorjahressaldo 11,5 Mrd. €. Dass einem deutlich positiven Saldo in der Handelsbilanz regelmäßig negative Salden in der Dienstleistungsbilanz und der Übertragungsbilanz gegenüberstehen, ergibt sich auch für den Monat September. Insgesamt ergab sich in Summe aus den Salden für Dienstleistungen (- 1,2 Mrd. €.), Erwerbs- und Vermögenseinkommen (+ 3,0 Mrd. €.), laufende Übertragungen (- 3,5 Mrd. €.) sowie Ergänzungen zum Außenhandel (- 1,2 Mrd. €.) nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank eine Leistungsbilanz im September 2010 mit einem Überschuss von 14,0 Mrd. €. Das ergibt ein Plus von 3,3 Mrd. € im Vergleich zum Vorjahr. Der Ausfuhr von Waren in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, im September 2010 in Höhe von 52,1 Mrd. €, standen eingeführte Waren im Wert von 44,6 Mrd. € gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die EU-Ausfuhren um 14,1% und die EU- Einfuhren um 17,8 %. Saisonbedingte Abweichungen sollen bei der vorliegenden Betrachtung außer Ansatz bleiben. Doch auch mit einer entsprechenden Berücksichtigung ergibt sich aus den veröffentlichten Zahlen, dass Deutschland ein so genanntes Überschuss-Land ist. Die Exporte übersteigen die Importe regelmäßig. Damit leistet Deutschland einen positiven Außenbeitrag. Des Weiteren kann festgestellt werden, dass sich Deutschland nach der Krise wieder im Aufschwung befindet, sowohl Importe als auch Exporte steigen. Deutlich wird auch, dass die EU-Exporte die EU-Importe prozentual übersteigen.10
4 Europäische Leistungsbilanz
Die Europäische Währungsgemeinschaft verzeichnete im zweiten Quartal 2010 ein Leistungsbilanzdefizit von 37,1 Mrd. €. Das bedeutet ein Plus gegenüber dem ersten Quartal in Höhe von 5,3 Mrd. € und ein Minus von 5 Mrd. € im Vergleich zum Vorjahr. Der negative Saldo des Warenhandels stieg im zweiten Quartal auf -29,9 Mrd. €. Das ergibt ein Plus von 15,0 Mrd. € im Vergleich zum Vorjahr. Bei den laufenden Übertragungen stieg das Defizit auf -14,2 Mrd. gegenüber -11,9 Mrd. Bei der Dienstleistungsbilanz ergab sich ein Anstieg von 16,7 Mrd. € (zum Vorjahr) auf 19,3 Mrd. (zum 1. Quartal 2010) während das Defizit bei der Einkommensbilanz auf -12,4 Mrd. gegenüber -32,1 Mrd. sank.11 Im Vergleich zur Deutschen Leistungsbilanz kam es also auf der EU27-Ebene im zweiten Quartal 2010 zu einem Leistungsbilanzdefizit. Die wichtigsten Handelspartner sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.
Tabelle: Anteil der Handelspartner an der EU27-Leistungsbilanz
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5 Phänomen der globalen Ungleichgewichte
Der Begriff der Ungleichgewichte stellt ein Phänomen der internationalen Wirtschafts- beziehungen dar und ist eine Begleiterscheinung der zunehmenden Globalisierung. Er erklärt sich aus den weltweiten Waren- und Kapitalströmen zwischen verschiedenen Wirtschafts- regionen. Die Globalisierung ist dabei besonders für die Notenbanken von Interesse, da es deren Aufgabe ist, Preisstabilität sicherzustellen und die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten. Insbesondere die globalen Ungleichgewichte werden dabei kritisch betrachtet, bergen sie doch grundsätzlich Risiken in sich, mit entsprechend negativen Einflüssen auf die Finanzmarktstabilität.
5.1 Auswirkungen globaler Ungleichgewichte auf die Weltwirtschaft
Im Model einer idealen Welt stellen Ungleichgewichte kein Problem dar, sondern es stellt sich automatisch ein Gleichgewicht ein. So gehen den Exporten Gewinne einher, mit der Folge eines ansteigenden Lohnniveaus. Daraus resultiert im Gegenzug ein Preisanstieg der heimischen Produktion mit der Folge, dass sich der Export wieder abschwächt. Für den Kurs der Landeswährung gilt in etwa das Gleiche. Werden die exportierten Güter in der Landeswährung finanziert steigt die Nachfrage der heimischen Währung. Die Folge ist ein Kursanstieg. Schließlich führt auch diese Währungsaufwertung zu einem Preisanstieg der Exporte mit einem damit verbundenen Exportrückgang (vgl. Problem des Chinesischen Währungsprotektionismus). Zum Bestreben der G 20-Staaten gehört es nun aber, die bestehenden globalen Ungleichgewichte zu bekämpfen. Dazu sind die Ökonomen jedoch zweigeteilter Ansicht. Inwieweit sich Ungleichgewichte in der Leistungsbilanz nämlich schädlich für die Weltwirtschaft auswirken ist umstritten. Globale Ungleichgewichte gab es von jeher und sind weder ungewöhnlich noch schädlich. Sie können jedoch als problematisch betrachtet werden, wenn Sie nicht auf marktpreisbasierten Prozessen beruhen und eine hohe Persistenz aufweisen.
Den Keynesianern stehen nun den Vertretern einer expansiven, restriktiven Haushaltspolitik gegenüber. Erstere halten die Entwicklung der Ungleichgewichte für äußerst dramatisch. Das ansteigende Leistungsbilanzdefizit der USA und der hohe Überschuss in Ländern wie Deutschland oder China wird als besorgniserregend angesehen. Man hält die globalen Ungleichgewichte verantwortlich für die Finanzkrise, indem der immense Kapitalimport der USA die Verschuldung und die zu große Kreditvergabe, begünstigte und schließlich in die Krise führte. Als weiterer Grund kommt ein möglicher Nachfrageausfall bedingt durch die Ungleichgewichte in Betracht. Übersteigen die Importe die Exporte, fließt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ins Ausland ab. Die Folge ist eine geringere Produktion und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit.
Auf der anderen Seite hält man dies für eine Mischung aus Protektionismus und Keynesianismuss. Stattdessen ist man der Meinung, dass Leistungsbilanzdefizite oder - Überschüsse keine Ungleichgewichte darstellen, die der Korrektur bedürfen. Viel wichtiger seien andere Faktoren. Leistungsbilanzüberschüsse werden als Kapitalexport von Leistungsbilanzüberschussländern wie Deutschland und China in defizitäre Länder wie die USA betrachtet, als Kapitalanlage der erwirtschafteten Ersparnis und somit als natürliche Folge eines attraktiven Kapitalanlegestandortes. Danach kann ein Leistungsbilanzüberschuss durchaus positive Verwendung finden wenn das Kapital sinnvoll im Ausland investiert wird. Eine sinnvolle Verwendung rechtfertigt im Umkehrschluss ein entsprechendes Leistungs- bilanzdefizit. Die deutschen bzw. chinesischen Überschüsse benötigen daher keiner Korrektur. Als Beispiel dafür kann Deutschland nach der Wiedervereinigung betrachtet werden. In der Zeit nach der Wende kam es in Deutschland zu einem Leistungsbilanzdefizit. Deutschland war zu dieser Zeit auf ausländische Investitionen angewiesen. Zehn Jahre später erwirtschaftete Deutschland schließlich wieder die gewohnten Überschüsse.
Man kann also zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Festzuhalten bleibt, dass Leistungsbilanzdefizite irgendwann in der Zukunft durch Leistungsbilanzüberschüsse auch wieder ausgeglichen werden müssen, da kein Staat eine ewig defizitäre Leistungsbilanz haben darf. Dieses wäre gleichbedeutend mit einem stetigen Anstieg der Verbindlichkeiten und einer fortlaufenden Verschlechterung des Auslandsvermögensstatus. Da diese Entwicklung nicht ewig beibehalten werden kann, ist es auch keine Frage ob es zu einer künftigen Korrektur globaler Ungleichgewichte kommen muss, sondern nur wann und in welcher Form. Es stellt sich die Frage, ob sich eine marktinduzierte Anpassung ohne wirtschaftliche Probleme einstellen wird, oder ob es ratsam wäre über wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen diesen Prozess zu initiieren bzw. zu flankieren. Letzteres könnte erheblichen negativen Auswirkungen vorbeugen und zu einer Risikoreduktion beitragen.
5.2 Mögliche Erklärungsperspektiven
Als Mögliche Erklärungsmuster kommen grundsätzlich zwei Erklärungsperspektiven in Frage, zum einen die Handelssicht, welche die Differenz zwischen Ausfuhren und Einfuhren, näher betrachtet, zum anderen die Sicht des Kapitalverkehrs, mit Fokus auf den grenzüberschreitenden Nettokapitalstrom, sprich die Differenz zwischen Ersparnis und Investitionen.
Aus Handelssicht betrachten die Leistungsbilanzungleichgewichte vor allem die Entwicklungen der Nettoexporte in die verschiedenen Länder. Danach ist es gerade die hohe Importnachfrage der USA die zu entsprechenden Nettoimporten führe. Auch die Wachstums- strategie der exportorientierten Länder (vorwiegend im Asiatischen Raum) ist verantwortlich für die den Außenhandelsüberschüssen einhergehenden Nettoexporte. Das US-Leistungs- bilanzdefizit spiegelt sich also zu einem großen Teil in den chinesischen Nettoexporten wider. Diese Strategie, und die daraus resultierenden Ungleichgewichte stellen jedoch, solange man die Strategie beibehält, keine Gefahr dar, denn auch diese führt zu einem nachhaltigen und tragfähigen Kapitalstrom.
Aus Kapitalverkehrssicht ergibt sich die Vorstellung, dass sich das Leistungsbilanzdefizit der USA durch die (Ersparnis-) der Überschussländer finanziert und von diesen entscheidend mitbestimmt wird. Auch Entwicklungs- und Schwellenländer nutzen ihre Exportüberschüsse vornehmlich dazu, Auslandsforderungen in Form von Währungsreserven aufzubauen und damit Kapital zu exportieren. Nach dieser Sichtweise ist es das Motiv vieler Schwellenländer, finanzielle Mittel als Rücklagen für Krisenzeiten im Ausland anzulegen. Dieser letztlich immense Nettokapitalexport in die USA führt dazu, dass die USA ein enormes Leistungsbilanzdefizit aufweisen. Sowohl die Kapitalverkehrssicht als auch die Handelssicht schließen sich nicht einander aus, sondern ergänzen einander. Aus stabilitätspolitischen Zielen stellt sich nun die Frage nach der Nachhaltigkeit und Tragfähigkeit der gegenwärtigen Entwicklung und die sich daraus ergebenden Risiken.
6 Subsumtion
Das derzeit starke Interesse an den Leistungsbilanzentwicklungen liegt besonders am hohen weiter ansteigenden Leistungsbilanzdefizit der USA. Die derzeitige Situation zeigt, dass besonders die USA seit Jahrzehnten über ihre Verhältnissen leben, indem sie weit mehr importieren als exportieren. Das dadurch entstandene Defizit wird dabei von anderen Staaten finanziert. Zurzeit entfallen auf die USA in etwa ¾ des globalen Leistungsbilanzdefizits, wohingegen Überschüsse sich über viele Wirtschaftsregionen verteilen. Aufgrund der hohen Nettokapitalimporte weist die Leistungsbilanz der USA ein erhebliches Defizit aus. Länder, wie China und Deutschland, aber auch Erdölexportierende Staaten, weisen dagegen erhebliche Leistungsbilanzüberschüsse und damit Nettokapitalexporte auf. Die Vereinigten Staaten „saugen“ quasi die weltweite Ersparnis auf. Im Fall der USA handelt es sich dazu um ein so genanntes Zwillingsdefizit bestehend aus Leistungsbilanzdefizit, gekoppelt an ein riesiges Haushaltsdefizit in Höhe von knapp 14 Billionen Dollar. Bereits in den 80er Jahren entstand in den USA ein defizitärer Haushalt. Um die bestehenden Ausgaben zu decken wurde das Zinsniveau angehoben, was zu einer Aufwertung des Doller führte. Mit der Aufwertung der Währung kam es schließlich zu einem Anstieg der Importe und einer Reduzierung der Exporte. Es folgte eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit. Diese Entwicklung steht in einem Kontrast zur Situation Anfang der 80er Jahre. Damals flossen Nettokapitalströme vorwiegend in Richtung der Entwicklungs- und Schwellenländer, während sie heute von ärmeren Regionen zu den reichen fließen. Verantwortlich dafür ist die starke Zunahme von Devisenreserven in den Überschussländern. So hat China bisher Währungsreserven in Höhe von ca. zweieinhalb Billionen Dollar in US-Staatsanleihen angelegt. Für China ergaben sich infolge der Kopplung des Renminbi an den Dollar Chancen. Da man aus chinesischer Sicht ein Grossteil der Waren in die USA exportierte, durften die hieraus resultierenden Dollar- Überschüsse nicht zu einer Aufwertung der heimischen Währung führen. Dies wurde ermöglicht in dem die chinesische Notenbank die Dollarbeträge zum Festkurs umtauscht und in den USA investiert. Das starke Anhäufen von Devisenreserven in Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen gilt somit als Teil des Phänomens der globalen Ungleichgewichte. Aus Sorge, dass die Ungleichgewichte außer Kontrolle geraten und in der Zukunft nicht mehr beherrschbar sind wurde bereits im vergangenen September in Pittsburgh vereinbart, globale Ungleichgewichte zu reduzieren.
7 Makroökonomische Ungleichgewichte in der EWWU
7.1 Entwicklung
Seit der Einführung der Gemeinschaftswährung kennzeichnete den Staatenbund eine vergleichsweise ausgeprägte makroökonomische Stabilität. Neben einer relativ hohen Geldwertstabilität herrschte eine Phase geringer realwirtschaftlicher Volatilität. Trotz der günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bauten sich innerhalb der Gemeinschaft jedoch makroökonomische Ungleichgewichte auf. Es kam zu Ungleichgewichten in den Leistungsbilanzen und zu einer erodierenden preislichen Wettbewerbsfähigkeit einiger Peripherieländer. Als Ursache kommen binnenwirtschaftliche Fehlentwicklungen in Frage, so die im Verhältnis zu inländischen Produktionsmöglichkeiten, zu kräftige expandierende Binnennachfrage. Die einhergehende verstärkende Lohnentwicklung war den heimischen Produktivitätsverhältnissen vielfach enteilt. Daneben wurde die Nachfrage in diesen Ländern teilweise durch eine expansive Fiskalpolitik befeuert. In der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise wurden diese Fehlentwicklungen nun offenbar. Erstmals ging im Euro-Raum die gesamtwirtschaftliche Produktion zurück. Dabei erlitten gerade die exportorientierten Volkswirtschaften Deutschland und Finnland die größten Einbrüche, welche sich jedoch primär durch den vorübergehenden Rückgang der Auslandsnachfrage deutlich machte. Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte blieb dagegen recht stabil. Die kräftige Erholung des Welthandels ließ in den exportorientierten Ländern das Wachstum spürbar über dem EWU-Durchschnitt ansteigen.
Die Peripherieländer wie Griechenland, Irland, Portugal und Spanien erlebten die Rezession dagegen anders. Einem wegen der geringeren Exportabhängigkeit schwachen Einbruchs des BIPs folgten hausgemachte Probleme. Bereits vor der Krise war das Wachstum diese Länder nicht als nachhaltig anzusehen. Sowohl die konjunkturelle Überhitzung der Immobilienpreise als auch die maroden Haushalte mündeten in einer größeren Rezession. Die Binnennachfrage überschritt in diesen Ländern die heimischen Produktions- und Einkommensspielräume. Dabei gelang es nicht, den Anstieg der Lohnstückkosten zu bremsen und das Potenzialwachstum zu steigern. In Griechenland folgte die Finanzpolitik einem sehr expansiven, auf Dauer nicht tragfähigen Kurs, der das Land schließlich in die jetzige Verschuldungskrise gestürzt hat.12
7.2 Schlussfolgerungen für Europa
Die Entwicklung in den einzelnen Peripherieländern zeigt, dass sich makroökonomische Fehlentwicklungen nicht auf das betreffende Land begrenzen lassen, sondern erzeugen unter der Bedingung einer Gemeinschaftswährung Ausstrahlungs- und Ansteckungseffekte. Im Ergebnis belastet der notwendige Korrektur- und Anpassungsprozess damit nicht nur die konjunkturellen Aussichten der jeweiligen Volkswirtschaft sondern die Stabilität des realwirtschaftlichen Gefüges und des Finanzsystems im gesamten Währungsraum.
Nimmt man die Argumente der jüngsten Zeit auf, so bedeutet dies einen entsprechenden Handlungsbedarf für die Mitgliedsstaaten der EWU. Die Gefahr, dass die Staaten insbesondere des asiatischen Raums Europa den Rang ablaufen ist unübersehbar. Daher muss die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Wirtschaftsraum gesteigert werden. Bezogen auf die innereuropäischen Ungleichgewichte erwartet man besonders von Deutschland, geeignete Schritte zu ergreifen, so ein Anpassen an das Lohnniveau und der Verschuldung der anderen Mitgliedsstaaten und ein Aufgeben der deutschen Sparpolitik. Andernfalls drohe die Gefahr einer Abwärtsspirale, indem die Defizitländer sich der deutschen Sparpolitik und dem deutschen Lohnniveau anpassen würden, mit der Folge der Deflation und schrumpfender Wirtschaft. Von deutscher Seite argumentiert man hingegen, dass eine weitere Verschuldung den Staat handlungsunfähig mache, mit Inflation als Folge.13 Überhaupt sind es eher die Defizitländer welche Handlungsbedarf haben. Man müsse dort aufhören, über den Verhältnissen zu leben und von Seiten des Staates entgegensteuern. Doch welche Forderungen sind realistisch und welche Möglichkeiten bieten sich?
7.3 Berechtigung der Forderungen an die deutsche Bundesregierung
Die Forderungen an die deutsche Bundesregierung aus dem Ausland richten sich vor allem an die deutsche Wachstumsstrategie. Man solle von deutscher Seite seine Sparpolitik aufgeben und seine Exportüberschüsse einschränken. Insbesondere sollen hierzulande das Lohnniveau angepasst, und neue Konjunkturprogramme gestartet und Umstrukturierungen vorgenommen werden. Der Vorwurf, dass von deutscher Seite Lohndumping betrieben wird, mit dem Ziel der Exportsteigerung deutscher Güter, und die Schlussfolgerung, dass andere Mitgliedsstaaten dadurch in ein „race to the bottom“ gezwungen würden ist jedoch unangebracht, denn das deutsche Wachstumsmodell orientiert sich an internationaler Arbeitsteilung, welche unter Effizienzgesichtspunkten und dem Aspekt der Wohlstandssteigerung für alle von Vorteil ist.
Ebenso gilt hierzulande das Prinzip der Tarifautonomie, welche unverzichtbar zum Ordnungsrahmen der Sozialen Marktwirtschaft gehört. Das heißt Löhne werden zwischen Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite ausgehandelt. Staatliche Eingriffe (Privatsektor) spielen bisher nur eine untergeordnete Rolle und sollten auch unter der Berücksichtigung der Europäischen Grundfreiheiten (Bsp. Arbeitnehmerfreizügigkeit) und der Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes begrenzt werden. Im Umkehrschluss könnte man argumentieren, dass die Lohnentwicklung in den anderen Mitgliedsstaaten den heimischen Produktivitätsverhältnissen unangemessen ist.
Die ebenfalls geforderten nötigen Strukturreformen wurden von deutscher Seite in den letzten Jahren bereits umfangreich auf den Weg gebracht. In Zukunft wird man von deutscher Seite jedoch weitere nötige Reformen auf den Weg bringen müssen um besonders den deutschen Binnenmarkt zu stärken. Darauf ziehen im Endeffekt auch die geforderten Konjunkturprogramme ab. Hierzu könnten von deutscher Seite insbesondere fiskalpolitische Maßnahmen in Betracht kommen. Diese dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass kompensierende Maßnahmen von deutscher Seite mittels einer Stimulierung des Binnenmarktes, infolge einer entsprechenden Steuerpolitik, weder problemadäquat noch angesichts der geringen Ausstrahlungseffekte, den Defizitländern maßgeblich Entlastung verschaffen. Ein Grossteil der Maßnahmen muss also von den defizitären Mitgliedsstaaten selbst vorgenommen werden.14
Ein weiterer wesentlicher Standpunkt gegen die Bekämpfung deutscher Bilanzüberschüsse ist jedoch aus der Betrachtungsperspektive abzuleiten. Betrachtet man die Bundesrepublik für sich genommen so kristallisiert sich klar ein Leistungsbilanzüberschuss heraus. Betrachtet man dagegen die Mitgliedsstaaten der EWU als Ganzes, so zeigt sich, dass die europäische Leistungsbilanz gerade Dank der deutschen Überschüsse nahezu ausgeglichen ist. Ein einseitiger deutscher Ansatz ohne eine einhergehende Reduzierung der negativen Leistungsbilanzen würde letztlich zu einem immensen europäischen Leistungsbilanzdefizit führen und damit zu einer instabilen Weltwirtschaft beitragen. Die deutschen Exportüberschüsse tragen damit zur Stabilisierung des Euros bei, von der auch die Partnerländer profitieren.
Insgesamt lassen sich die hohen deutschen Bilanzüberschüsse wohl neben einer Lohnzurück- haltung im öffentlichen und im privaten Sektor wohl eher auf die hohe Exportstärke infolge einer intensiven außenwirtschaftlichen Verflechtung zurückführen. Die deutsche Exportstärke ist das Resultat eines intensiven internationalen Wettbewerbs, verbunden mit einer innovationsfreudigen, diversifizierten und spezialisierten Wirtschaftsausrichtung. Deutsche Unternehmen tragen dabei maßgeblich durch Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit zur Exportstärke bei. Weiterhin argumentiert man, dass die deutschen Exportüberschüsse nicht Folge staatlicher Einflussnahme seien sondern sich auf die hohe Qualität zu angemessenen Preisen zurückführen ließen.
Eine Aufgabe des deutschen Wirtschaftsmodels würde außerdem andere Länder wie Korea, Indien und vor allem aber China die Möglichkeit geben, die entstehende Lücke aufzufüllen. Auch die USA haben nichts davon wenn Deutschland seine Exportstärke reduziert. Denn es ist vor allem die Nachfrage aus Asien, die derzeit die deutsche Wirtschaft beflügelt. Die nach außen ausgeglichene Leistungsbilanz der europäischen Währungsgemeinschaft darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich innerhalb der Eurozone hohe Leistungsbilanzdivergenzen entwickelt haben. Diese wirken sich negativ auf die Stabilität des Euros und der Finanzmärkte aus. Von daher ist ein geordneter Abbau der innereuropäischen Ungleichgewichte erforderlich. Eine Entwicklung hin zu einer Wirtschaftsunion könnte dabei Abhilfe schaffen. So könnten koordinative Maßnahmen wie die Überwachung und Identifikation von Ursachen der makroökonomischen Ungleichgewichte dazu beitragen, Probleme frühzeitige zu erkennen und auf gemeinschaftlicher Ebene Abhilfe zu schaffen. Die Bundesregierung ist sich dabei der Aufgabe bewusst, einen Beitrag zum Abbau der Divergenzen innerhalb des europäischen Binnenmarktes leisten zu müssen. Die notwendigen Maßnahmen sollten jedoch nicht in einer Schwächung preislicher Wettbewerbsfähigkeit liegen. Es ist eher eine Stärkung der Binnennachfrage durch fiskalpolitische Maßnahmen verbunden mit einem Ausbau des Dienstleistungssektors, eine vorrangige Aufgabe der Bundesregierung, welche sich schließlich positiv auf einen Abbau der bilanziellen Ungleichgewichte auswirkt.
8 Lösungsansätze und mögliche Implikationen
Maßnahmen zum Abbau der globalen Ungleichgewichte müssen an verschiedenen Stellen ansetzen. So muss es zu einem Anstieg der volkswirtschaftlichen Ersparnisse in den USA kommen. Dazu gehören entsprechende Ersparnisse im privaten Bereich als auch eine entsprechende US-Haushaltskonsolidierung. Das heißt im Klartext für die Amerikaner, kürzen der Sozialausgaben, Steigerung der Steuereinnahmen, weniger Mittel für das Militär und ein erhöhen des Renteneintrittsalters. Harte aber unvermeidliche Sparmaßnahmen sind auf jeden Fall nötig. Als weiterer Ansatz gilt das Gewährleisten einer ausreichenden Wechselkurs- flexibilität. Insbesondere Chinas Aufgabe ist es eine realistische Aufwertung des Renminbi zu ermöglichen aber auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gegenüber den Handelspartnern und damit der real effektive Wechselkurs erscheinen tendenziell etwas zu niedrig. Währungsmanipulation und protektionistische Maßnahmen wie Schutzzölle sollten also generell vermieden werden. Das gilt auch für die USA mit ihrem durch die USNotenbank umstrittenen Aufkauf amerikanischer Staatsanleihen im Gesamtvolumen von 600 Milliarden Dollar (430 Milliarden Euro). Wobei zu beachten ist, dass es durch die Fed sicher zu keiner Inflation kommen wird sondern eher zu deflationären Tendenzen. Ein weiteres Beispiel ist Brasilien. Dort hat man im vergangenen Jahr Kapitalverkehrsregulierungen eingeführt, aus Angst vor einer immensen Aufwertung der Landeswährung und den daraus resultierenden Nachteilen im internationalen Wettbewerb.15
Als weiterer Ansatzpunkt gilt ein stetiges und nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Europa und den asiatischen Ländern zu schaffen, um nicht nur die Ungleichgewichte abzubauen sondern auch um zu einem ausgeglichenen globalen Wirtschaftswachstum zu gelangen, das letztlich auch dem Abbau der Ungleichgewichte dienlich sein sollte.
Mit welchen Mitteln die Zielwerte, welche von den USA vorgeschlagen wurden, nämlich ein Leistungsbilanzüberschuss- bzw. -defizit auf 4 % des BIP zu begrenzen erreicht werden sollen ist fraglich. Denn eine Steuerung über die Wechselkurspolitik erweist sich als problematisch, da die Leistungsbilanz nur mit zeitlicher Verzögerung auf den Wechselkurs reagiert. Dazu kommt, dass man im Vorfeld nicht weiß, welcher Kurs notwendig ist um den deutschen Leistungsbilanzüberschuss auf weniger als 4 % zu senken. In diesem Jahr wird der deutsche Leistungsbilanzüberschuss voraussichtlich bei 6,1 % des BIP’s liegen. (China 4,7%, Griechenland -10,8 % und Portugal mit -10,0 %). Betrachtet man jedoch die Leistungsbilanz- überschüsse seit 1950 so hätte man den vorgeschlagenen Zielwert meist eingehalten. Daher wäre dies auch für Deutschland durchaus eine denkbare Option, welche durchaus sinnvoll wäre und vielleicht auch günstiger ist schwächeren Staaten dauernd aus der Krise zu helfen. Feste Regeln a la Bretton Woods II für die Wechselkurspolitik, wie unter anderem vom französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy gefordert, könnten ebenso eine Maßnahme darstellen. Feste Wechselkurse sind allerdings äußerst problematisch wie uns die Geschichte gezeigt hat. Denn manche Wechselkurse lassen sich nur schwer stabilisieren. Dazu bieten sie eine zu große Angriffsfläche für Spekulationen gegen einen festen Kurs. Von einer weltweit einheitlichen Währung wie in der EU ist man dazu Lichtjahre entfernt. Daher sind frei schwankende Währungen wohl die bessere Alternative.
Fazit
Ob und inwieweit sich makroökonomische Ungleichgewichte überhaupt auf die Weltwirtschaft auswirken ist umstritten. Fest steht jedoch, dass Ungleichgewichte auch irgendwann wieder ausgeglichen werden müssen. Denn kein Staat darf für ewig ein Leistungsbilanzdefizit haben. Dieses wäre gleichbedeutend mit einem stetigen Anstieg der Verbindlichkeiten und einer fortlaufenden Verschlechterung des Auslandsvermögensstatus. In welcher Form es zu einer künftigen Korrektur globaler Ungleichgewichte kommt ist jedoch umstritten. In der Fachwelt prallen dazu zwei unterschiedliche Ansichten aufeinander. Dabei kann man kann sich in der Tat darüber streiten, ob sich ein Gleichgewicht infolge einer marktinduzierten Anpassung von selbst einstellen wird, oder ob es ratsam wäre wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen zu ergreifen um diesen Prozess zu initiieren. Letzteres könnte erhebliche negative Auswirkungen vorbeugen und zu einer Risikoreduktion beitragen. Die Sorge, dass in der Zukunft Ungleichgewichte nicht mehr beherrschbar sind und außer Kontrolle geraten könnten ruft geradezu nach einem systematischen und geordneten Abbau der globalen Ungleichgewichte. Dies ist jedoch nicht auf kurzer Sicht zu realisieren, sondern muss nachhaltig erfolgen. Alle Beteiligten sind dabei gefordert ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Ob die Problemlage dabei asymmetrisch ist und die Defizitländer eher Handlungsbedarf aufweisen, ist völlig egal, denn eine entsprechende Koordination aller Beteiligten ist in jedem Fall erforderlich. Dazu hat auch Deutschland seinen Teil beizutragen. In Frage kommen fiskalpolitische Maßnahmen um den Binnenkonsum zu stärken, vor allem den Dienstleistungssektor. Künftig müssen jedoch weitere Schritte insbesondere von China und den USA folgen. Mit einer höheren Glaubwürdigkeit privater Schuldner können die USA die staatliche Kreditvergabe reduzieren. Um dies zu erreichen, müssen sie mittels gedeckter Anleihen vertrauenswürdigere Wertpapierstrukturen schaffen und von ihren Banken höhere Eigenkapitaleinlagen verlangen. Für China gilt indes von einer künstlichen Währungs- abwertung künftig abzusehen und die Wechselkurse künftig vom Markt bestimmen zu lassen. Denn die aufkommende Sorge um einen Wettlauf der Währungsabwertungen und neu aufkommender Protektionismus ist groß.
Für Länder mit schlechter Wettbewerbsposition und hohen Leistungsbilanzdefiziten führt letztlich kein Weg vorbei an einschneidenden, schmerzlichen Strukturreformen. Es gilt den Trend der letzten Jahre, in Verantwortung für kommende Generationen, nachhaltig umzukehren.
Literaturverzeichnis
[1]The New York Times, The Conscience of a Libaral, Dealing with Chermany, Paul Krugman 11.06.2010
[2]Financial Times Deutschland, dpa, Obama kontra Merkel, Vor G20-Gipfel Streit um Handel, 10.11.2010
[3]Die Zeit, Wir senken die Steuern später 10.11.2010
[4]http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/11/ 2010-11-10
[5]Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20-Gipfeltreffen, Merkel warnt vor neuer Finanzblase, 11.11. 2010
[6]FOCUS MONEY ONLINE, Sarkozy will Finanzsystem umbauen, 27.01.2010
[7]M./Kutschker, S./Schmid, Internationales Management, Oldenbourg 2008, 6. Aufl. S. 150
[8]IMF World Economic Outlook Database, April 2009
[9]Deutsche Bundesbank, Pressenotiz, 10.08.2010, Frankfurt/M, Die deutsche Zahlungsbilanz Juni 2010
[10]Statistische Bundesamt Deutschland, Pressemitteilung Nr.403, 08.11.2010
[11]EUROSTAT, euroindikatoren, Zweite Schätzung für das zweite Quartal 2010, EU27 verzeichnet Leistungsbilanzdefizit von 37,1 Mrd. Euro Pressemitteilung 156/2010, 20.10.2010
[12]DEUTSCHE BUNDESBANK, Monatsbericht Juli 2010, Zur Problematik makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Raum
[13]DER SPIEGEL 26/2010, Gegen den Rest der Welt, 28.06.2010
[...]
1 Vgl.: The New York Times, The Conscience of a Libaral, Dealing with Chermany, Paul Krugman 11.06.2010
2 Vgl.: Financial Times Deutschland, dpa, Obama kontra Merkel, Vor G20-Gipfel Streit um Handel, 10.11.2010
3 Vgl.: Zeit, Wir senken die Steuern später 10.11.2010
4 Vgl.: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/11/2010-11-10
5 Vgl.: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20-Gipfeltreffen, Merkel warnt vor neuer Finanzblase, 11.11. 2010
6 Vgl.: FOCUS MONEY ONLINE, Sarkozy will Finanzsystem umbauen, 27.01.2010
7 Vgl.: M./Kutschker, S./Schmid, Internationales Management, Oldenbourg 2008, 6. Aufl. S. 150
8 Vgl.: IMF World Economic Outlook Database, April 2009
9 Vgl. Deutsche Bundesbank, Pressenotiz, 10.08.2010, Frankfurt/M, Die deutsche Zahlungsbilanz Juni 2010
10 Vgl.: Statistische Bundesamt Deutschland, Pressemitteilung Nr.403, 08.11.2010
11 Vgl.: EUROSTAT, euroindikatoren, Zweite Schätzung für das zweite Quartal 2010, EU27 verzeichnet Leistungsbilanzdefizit von 37,1 Mrd. Euro Pressemitteilung 156/2010, 20.10.2010
12 Vgl.: DEUTSCHE BUNDESBANK, Monatsbericht Juli 2010, Zur Problematik makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Raum
13 Vgl.: DER SPIEGEL 26/2010,Gegen den Rest der Welt, 28.06.2010
14 Vgl.: DEUTSCHE BUNDESBANK, Monatsbericht Juli 2010, Zur Problematik makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Raum
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Überschuss im Außenhandel laut diesem Dokument?
Der Überschuss im Außenhandel wird anhand des Saldos der Leistungsbilanz verdeutlicht. Die Leistungsbilanz dokumentiert alle wirtschaftlichen Transaktionen im Güter- und Faktorenhandel zwischen In- und Ausland. Ein positiver Saldo kennzeichnet Devisenüberschüsse.
Wie ist die Leistungsbilanz definiert?
Die Leistungsbilanz setzt sich aus der Handelsbilanz, der Dienstleistungsbilanz, der Übertragungsbilanz und der Bilanz der Erwerbs- und Vermögenseinkommen zusammen.
Was bedeutet ein Leistungsbilanzüberschuss?
Ein Leistungsbilanzüberschuss bedeutet, dass der Saldo aus Export und Import von Gütern und Dienstleistungen positiv ist, was zu einem Anstieg des Nettoauslandsvermögens führt.
Was ist ein Leistungsbilanzdefizit?
Ein Leistungsbilanzdefizit entsteht, wenn weniger exportiert als importiert wird, was zu einem Sinken des Nettoauslandsvermögens führt.
Was sind globale Ungleichgewichte?
Globale Ungleichgewichte sind ein Phänomen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, das eine Begleiterscheinung der zunehmenden Globalisierung ist und sich aus den weltweiten Waren- und Kapitalströmen ergibt.
Welche Auswirkungen haben globale Ungleichgewichte auf die Weltwirtschaft?
Die Auswirkungen globaler Ungleichgewichte sind umstritten. Einige sehen sie als problematisch an, wenn sie nicht auf marktpreisbasierten Prozessen beruhen und eine hohe Persistenz aufweisen. Andere sehen sie als natürliche Folge von Kapitalströmen und attraktiven Kapitalanlagestandorten.
Wie entwickelt sich Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss?
Laut dem Dokument ist der deutsche Leistungsbilanzüberschuss gestiegen und lag Ende des zweiten Quartals bei 12,9 Mrd. €. Dieser Einnahmenüberschuss kann zur Finanzierung von anderen Zahlungsabflüssen dienen.
Wie ist die europäische Leistungsbilanzsituation?
Die Europäische Währungsgemeinschaft verzeichnete im zweiten Quartal 2010 ein Leistungsbilanzdefizit von 37,1 Mrd. €.
Welche Rolle spielt Deutschland in Bezug auf die makroökonomischen Ungleichgewichte in der EWWU?
Deutschland wird oft aufgefordert, seine Sparpolitik aufzugeben und seine Exportüberschüsse einzuschränken, um die Ungleichgewichte in der EWWU zu lindern. Es gibt jedoch unterschiedliche Meinungen darüber, inwieweit diese Forderungen gerechtfertigt sind.
Welche Lösungsansätze gibt es, um die globalen Ungleichgewichte abzubauen?
Mögliche Lösungsansätze umfassen einen Anstieg der volkswirtschaftlichen Ersparnisse in den USA, eine ausreichende Wechselkursflexibilität (insbesondere in China), die Vermeidung von Währungsmanipulationen und protektionistischen Maßnahmen sowie die Schaffung eines stetigen und nachhaltigen Wirtschaftswachstums weltweit.
Was sind die Schlussfolgerungen des Dokuments bezüglich Deutschlands Überschuss im Aussenhandel vs. globale Ungleichgewichte?
Das Dokument schließt, dass es notwendig ist, einen systematischen und geordneten Abbau der globalen Ungleichgewichte anzustreben. Dies erfordert die Koordination aller Beteiligten und die Ausschöpfung ihrer Möglichkeiten, einschließlich Deutschlands. Es werden fiskalpolitische Maßnahmen zur Stärkung des Binnenkonsums, insbesondere im Dienstleistungssektor, vorgeschlagen.
- Arbeit zitieren
- Martin Henschelchen (Autor:in), 2010, Deutschlands Überschuss im Aussenhandel vs. globale Ungleichgewichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274076