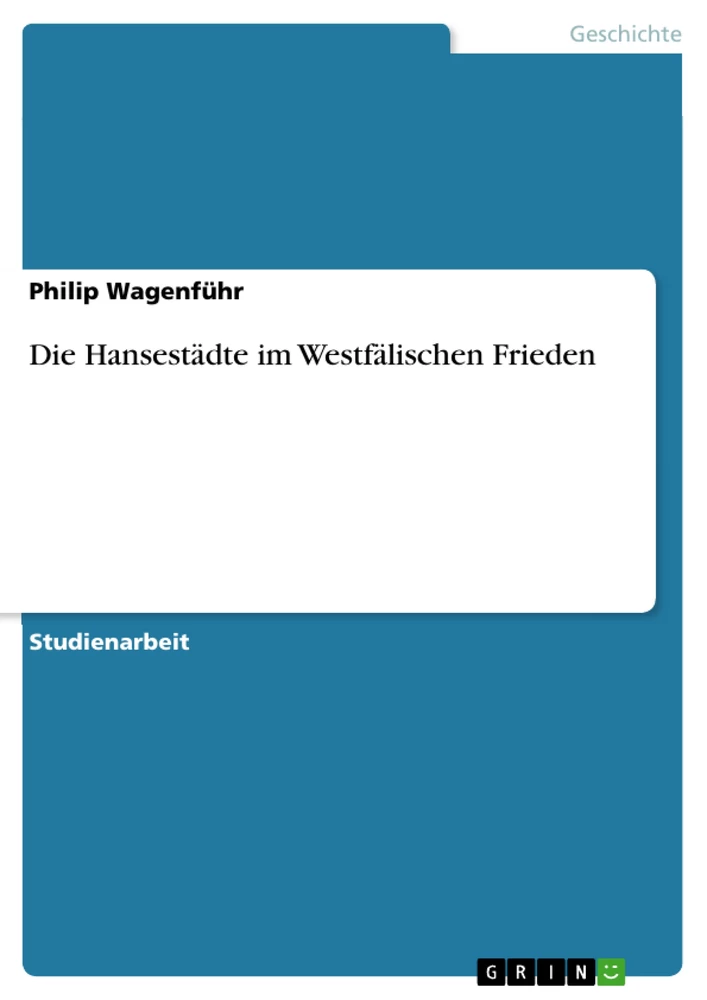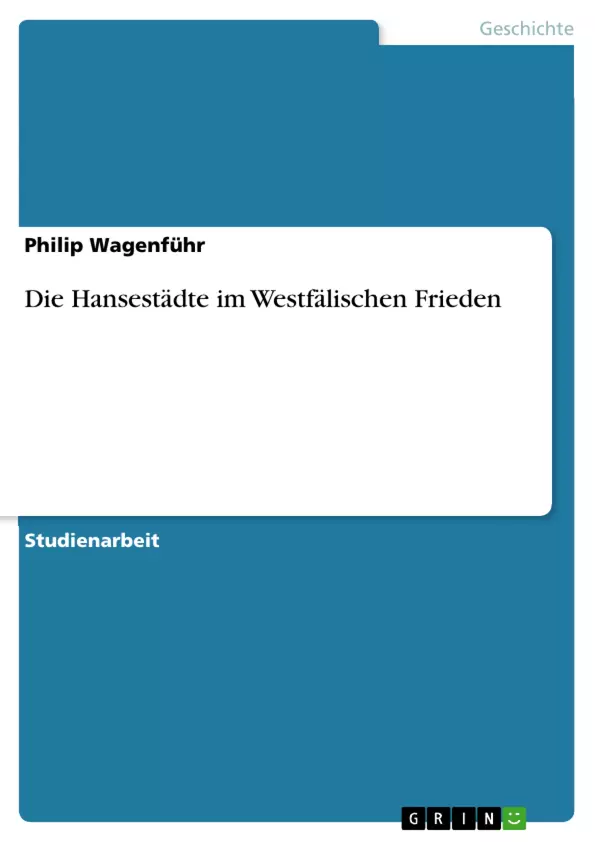Die Hanse war als Verbund von Städten im Europa des Mittelalters und der Frühen Neuzeit über mehrere Jahrhunderte hinweg in der Lage, gemeinsam politisch zu agieren und den Handel in Nordeuropa zu dominieren. Zudem konnte sie einer Großzahl ihrer Mitgliedsstädte bis ins 17. Jahrhundert hinein gewisse Freiheiten garantieren. Warum kam es also im Laufe des 17. Jahrhunderts zum faktischen Ende der Hanse, nachdem sie doch durch den Westfälischen Frieden, wie diese Arbeit noch aufzeigen wird, erstmals in ihrer Geschichte rechtliche Anerkennung erfahren hatte? Dieser Frage soll im Folgenden nachgegangen werden. Zudem soll erörtert werden, wie der Abstieg der Hanse vor sich ging und welche einzelnen Ursachen er hatte. Ein besonderes Augenmerk soll hierbei auf die Gegner der Hanse, vor allem die Fürsten und Territorialherren gerichtet werden, die auf dem Westfälischen Friedenskongress immer wieder versuchten, die Vertreter der Hanse von den Verhandlungen auszuschließen und ihre Rechtmäßigkeit in Frage stellten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hanse im Vorfeld des Westfälischen Friedens
- Der Zustand der Hanse vor dem Dreißigjährigen Krieg
- Die Entwicklung der Hanse während des Dreißigjährigen Krieges
- Die Hanse auf dem Westfälischen Friedenskongress
- Die hansische Vertretung
- Die Verhandlungen auf dem Friedenskongress
- Die Folgen und das Ende der Hanse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Sekundärliteratur
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle der Hanse im Westfälischen Frieden und analysiert, wie der Abstieg der Hanse im 17. Jahrhundert vor sich ging und welche Ursachen er hatte. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf den Gegnern der Hanse, insbesondere den Fürsten und Territorialherren, die auf dem Friedenskongress versuchten, die Vertreter der Hanse auszuschließen und ihre Rechtmäßigkeit in Frage stellten.
- Der Zustand der Hanse vor dem Dreißigjährigen Krieg
- Die Entwicklung der Hanse während des Dreißigjährigen Krieges
- Die Teilnahme der Hanse am Westfälischen Friedenskongress
- Die Ergebnisse des Friedensvertrages für die Hanse
- Die Folgen und das Ende der Hanse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem faktischen Ende der Hanse im 17. Jahrhundert, obwohl diese durch den Westfälischen Frieden erstmals rechtliche Anerkennung erfahren hatte. Die Arbeit soll den Abstieg der Hanse erörtern, insbesondere die Rolle der Fürsten und Territorialherren als Gegner der Hanse.
Kapitel 2 beschreibt den Zustand der Hanse vor dem Dreißigjährigen Krieg, insbesondere den Rückgang der Teilnehmer an den Hansetagen, die wachsende Uneinigkeit zwischen den Hansestädten und den wirtschaftlichen Niedergang einiger Städte. Es werden die strukturellen Veränderungen auf territorialstaatlicher Ebene, die wachsende politische Macht des Reiches und die Schwierigkeiten der Hanse, sich auf gemeinsame Regeln zu einigen, als Ursachen für die Probleme des Hansebundes dargestellt.
Kapitel 2.2 behandelt die Entwicklung der Hanse während des Dreißigjährigen Krieges. Die Hanse entschied sich, trotz Bündnisvorschlägen der Habsburger, nicht an einem Bündnis mit den Habsburgern teilzunehmen, um ihre kommerziellen Beziehungen zu den protestantischen Mächten im Ostseeraum nicht zu gefährden. Die meisten Hansestädte stellten sich auf die Seite Schwedens. Der letzte Hansetag im Jahr 1629 markierte einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Hanse, da die Städte Lübeck, Hamburg und Bremen mit der Vertretung der gesamten Hanse beauftragt wurden. Die drei Städte schlossen ein Defensivbündnis, das die Entsendung von Truppen und Kriegsschiffen im Falle eines Angriffs auf eine der Städte beinhaltete. Die Entscheidung, die Vertretung der Hanse in die Hände von nur drei Mitgliedsstädten zu geben, kann als eine "Liquidierung der Gemeinschaft" angesehen werden, da die Einzelinteressen der drei Städte, insbesondere Lübecks, im Vordergrund standen.
Kapitel 3.1 beschreibt die hansische Vertretung auf dem Westfälischen Friedenskongress. Die Städte Lübeck, Hamburg und Bremen beschlossen 1643, am Kongress im Namen der Hanse teilzunehmen. Die Gesandtschaft der Hanse bestand aus dem Lübecker Syndicus Dr. David Gloxin, den Bremer Ratsherren Dr. Gerhard Koch und Liborius von Linen und dem Hamburger Syndicus Dr. Christoph Meurer. Gloxin, der durch die Stellung Lübecks in der Hanse und die Reichsstandschaft Lübecks eine Führungsrolle innehatte, zeigte in den Verhandlungen großes Verhandlungsgeschick.
Kapitel 3.2 behandelt die Verhandlungen auf dem Friedenskongress. Die wichtigsten Forderungen der Hanse waren die rechtliche Stellung der Reichsstädte, die Aufnahme der Hanse in den Friedensvertrag, der Abbau von Handelserschwernissen und die Sicherung des Reformationsrechts der Reichsstädte. Die Fürsten und der Kaiser lehnten die Hanse als politische Korporation ab, doch Gloxin gelang es, die Hanse in die Schrift aufzunehmen, die auf die Friedensofferten Frankreichs und Schwedens antwortete. Die Hanse wurde somit diplomatisch erstmals anerkannt.
Kapitel 3.3 beschreibt die Ergebnisse des Friedensvertrages für die Hanse. Die Hanse wurde in den Friedensvertrag als "civitates Anseatlcae" aufgenommen. Die Reichsstädte erhielten das Reformationsrecht zugesichert, das Recht auf das "votum decisivum" und die Bestätigung ihrer Privilegien und Freiheiten. Allerdings konnten nicht alle Forderungen der Hanse durchgesetzt werden, insbesondere im Bereich des Handels. Der Weserzoll sollte trotz der Forderung nach Abschaffung von Zöllen bestehen bleiben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Hanse, den Westfälischen Frieden, die Fürsten und Territorialherren, die Reichsstädte, den Dreißigjährigen Krieg, die Reichsstandschaft, die Handelspolitik, die politische und wirtschaftliche Bedeutung der Hanse, der Niedergang der Hanse und die Rolle der Hanse im europäischen Mächtesystem.
Häufig gestellte Fragen
Warum endete die Hanse trotz Anerkennung im Westfälischen Frieden?
Obwohl die Hanse erstmals rechtliche Anerkennung als „civitates Anseaticae“ erfuhr, führten interne Uneinigkeit, der Aufstieg der Territorialfürsten und wirtschaftlicher Niedergang zum faktischen Ende des Bundes.
Welche Rolle spielten Lübeck, Hamburg und Bremen beim Friedenskongress?
Ab 1629 vertraten diese drei Städte die gesamte Hanse. Auf dem Kongress führten sie die Verhandlungen, um Privilegien und Handelsfreiheiten für den schrumpfenden Städtebund zu sichern.
Wer waren die größten Gegner der Hanse im 17. Jahrhundert?
Vor allem die Landesfürsten und Territorialherren versuchten, die Hanse von den Verhandlungen auszuschließen und deren politische Rechtmäßigkeit in Frage zu stellen.
Was war das „votum decisivum“ der Reichsstädte?
Es war das entscheidende Stimmrecht auf dem Reichstag, das den Reichsstädten im Westfälischen Frieden zugesichert wurde und ihre politische Stellung stärkte.
Warum wird 1629 als Wendepunkt der Hansegeschichte gesehen?
Der letzte Hansetag 1629 markierte die „Liquidierung der Gemeinschaft“, da die Vertretung auf nur noch drei Städte übertragen wurde, was die Einzelinteressen in den Vordergrund rückte.
- Quote paper
- M.A. Philip Wagenführ (Author), 2010, Die Hansestädte im Westfälischen Frieden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274148