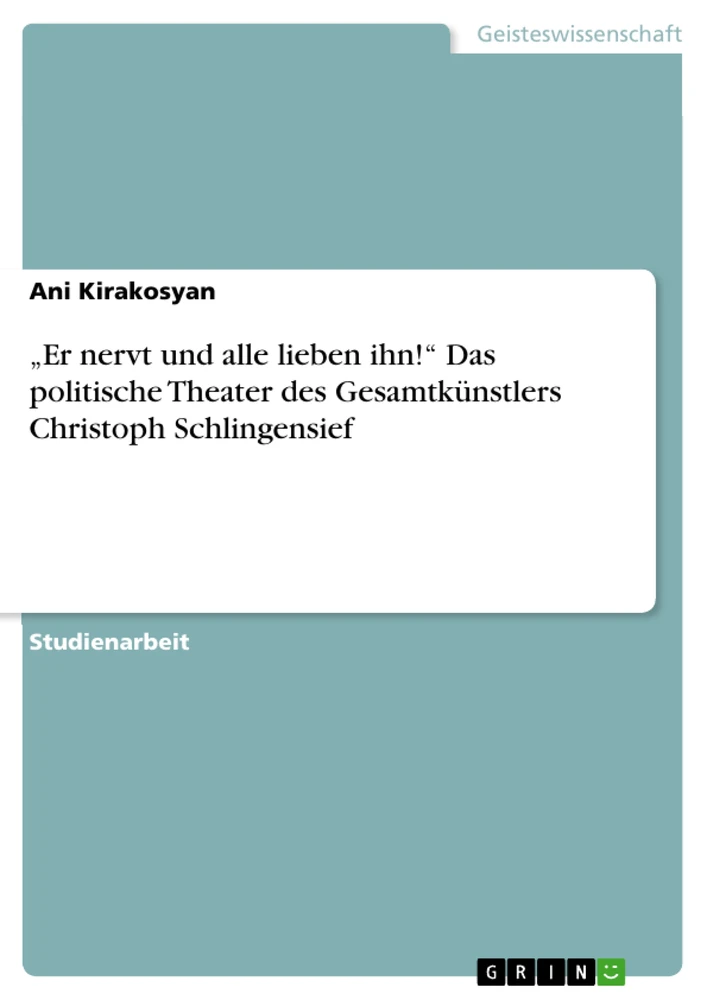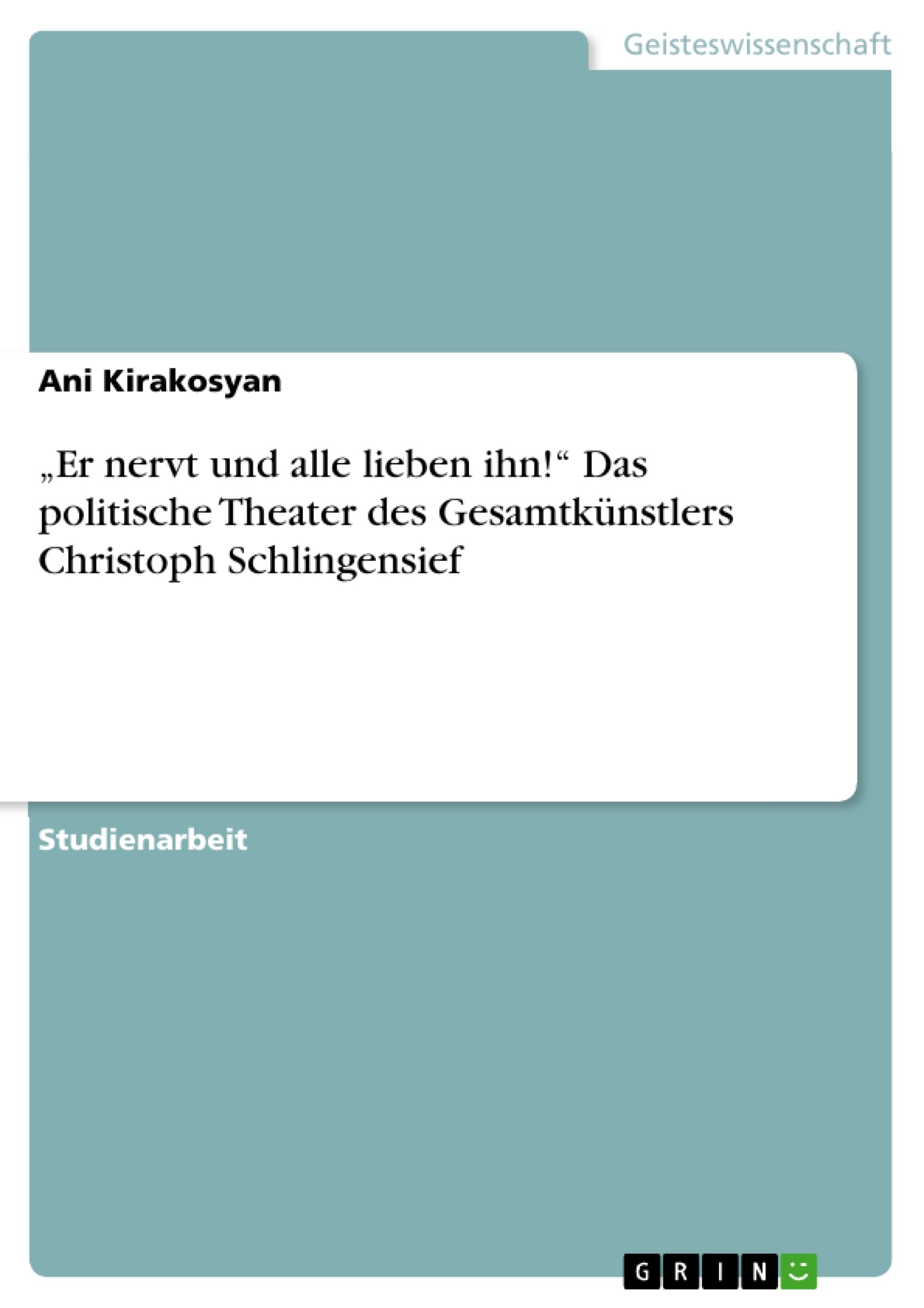Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Gesamtkünstler Christoph Schlingensief auseinander. Es wird der Versuch unternommen, mit Hilfe einiger ausgewählter Werke, den politischen sowie theatral-ästhetischen Gehalt dieser zu untersuchen. Die Arbeiten Schlingensiefs auf einen Aspekt hin zu begrenzen, stellt eine Herausforderung dar. Die notwendige Auswahl von nur wenigen Arbeiten und die selektive Untersuchung dieser können weder dem Künstler noch seiner künstlerischen Schöpfung gerecht werden. Dennoch werde ich versuchen, anhand dreier verschiedener Aktionen Schlingensiefs, nämlich "Chance 2000", "Bitte liebt Österreich" und "Hamlet", die spannende und brisante Frage zu beantworten, ob das Schlingensiefsche Theater ein politisches oder doch eher nur eine geschickt durchdachte Aufführungskunst war, um sich selbst zu inszenieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung (mit Bezugnahme auf die Quelle als Grundlage für die Arbeit)
- Hinführung zum Thema
- Politik und das Politische: Begriffstrennung
- Politisches Theater
- Chance 2000
- Bitte liebt Österreich...
- Die politische Dimension von Bitte liebt Österreich
- Hamlet
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Werk des Gesamtkünstlers Christoph Schlingensief, insbesondere in Bezug auf seine Aktionen, die an der Schnittstelle von politischem Theater und theatrale Politik angesiedelt sind. Die Arbeit analysiert ausgewählte Werke Schlingensiefs, um zu ergründen, inwieweit sie als politisches Theater verstanden werden können.
- Begriffsdefinition von "Politik" und "Politisches"
- Analyse der theatralen Elemente in Schlingensiefs Arbeiten
- Beurteilung des politischen Gehalts der Aktionen
- Untersuchung der Rolle des Publikums und des öffentlichen Raumes in Schlingensiefs Werk
- Diskussion der Frage, ob Schlingensiefs Aktionen eher politisches Theater oder theatrale Politik darstellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt den Leser in die Thematik des politischen Theaters ein. Sie beleuchtet den Artikel von Mariam Lau in der Zeitschrift "Theater heute" als Ausgangspunkt für die Untersuchung.
- Hinführung zum Thema: In diesem Kapitel wird die Person Christoph Schlingensief vorgestellt und sein Werk im Kontext des politischen Theaters des 20. Jahrhunderts eingeordnet. Es werden die Ziele der Arbeit sowie die methodischen Herangehensweisen erläutert.
- Politik und das Politische: Begriffstrennung: Das Kapitel definiert die Begriffe "Politik" und "Politisches" und verdeutlicht die Bedeutung dieser Begriffe im Zusammenhang mit der Arbeit.
- Chance 2000: Dieses Kapitel beleuchtet die Aktion "Chance 2000" als Beispiel für Schlingensiefs politisches Theater. Es wird die Inszenierung, die Botschaft und die Reaktionen des Publikums analysiert.
- Bitte liebt Österreich...: In diesem Kapitel wird die Aktion "Bitte liebt Österreich..." analysiert, wobei der Fokus auf die politische Dimension des Werks liegt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem politischen Theater, dem Werk von Christoph Schlingensief, Aktionen, Inszenierungen, Publikumsreaktionen, öffentliche Raum, Politisches, Begriffsbestimmung, Theaterästhetik, Medienphänomen.
Häufig gestellte Fragen
War Christoph Schlingensiefs Theater politisch oder Selbstdarstellung?
Die Arbeit untersucht genau diese Ambivalenz. Schlingensief nutzte theatrale Mittel, um politische Diskurse in den öffentlichen Raum zu tragen, wobei die Grenze zwischen Kunstaktion und politischer Realität oft verschwamm.
Was war die Aktion "Bitte liebt Österreich"?
In dieser Aktion (Wien 2000) inszenierte Schlingensief einen Container für Asylbewerber im Stil einer Reality-Show ("Big Brother"), um die Fremdenfeindlichkeit und die politische Lage in Österreich zu kritisieren.
Welche Rolle spielt das Publikum in seinen Werken?
Das Publikum ist bei Schlingensief oft nicht nur Zuschauer, sondern Teil der Inszenierung. Durch Provokation und Interaktion im öffentlichen Raum werden Passanten zu Akteuren im politischen Theater.
Was verbirgt sich hinter "Chance 2000"?
"Chance 2000" war eine von Schlingensief gegründete Partei zur Bundestagswahl 1998, die als Kunstprojekt die Mechanismen des Wahlkampfs und die Ausgrenzung von Randgruppen thematisierte.
Warum wird Schlingensief als "Gesamtkünstler" bezeichnet?
Sein Werk umfasst Film, Theater, Oper und politische Aktionen, die alle ineinandergreifen und traditionelle Genregrenzen sowie die Trennung von Kunst und Leben aufheben.
- Citar trabajo
- Ani Kirakosyan (Autor), 2012, „Er nervt und alle lieben ihn!“ Das politische Theater des Gesamtkünstlers Christoph Schlingensief, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274187