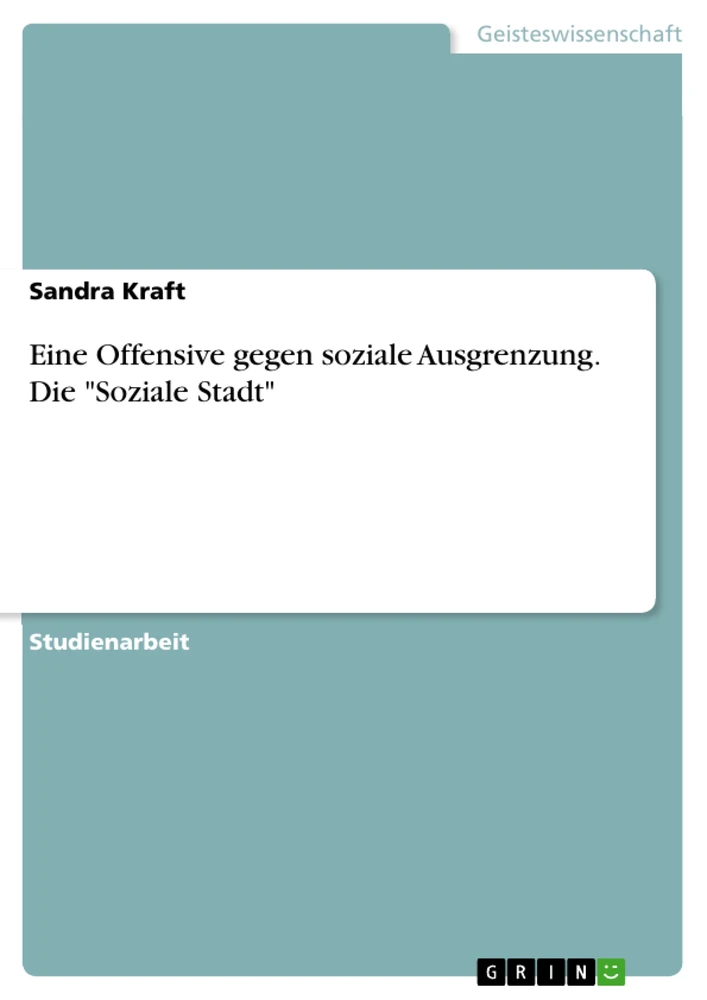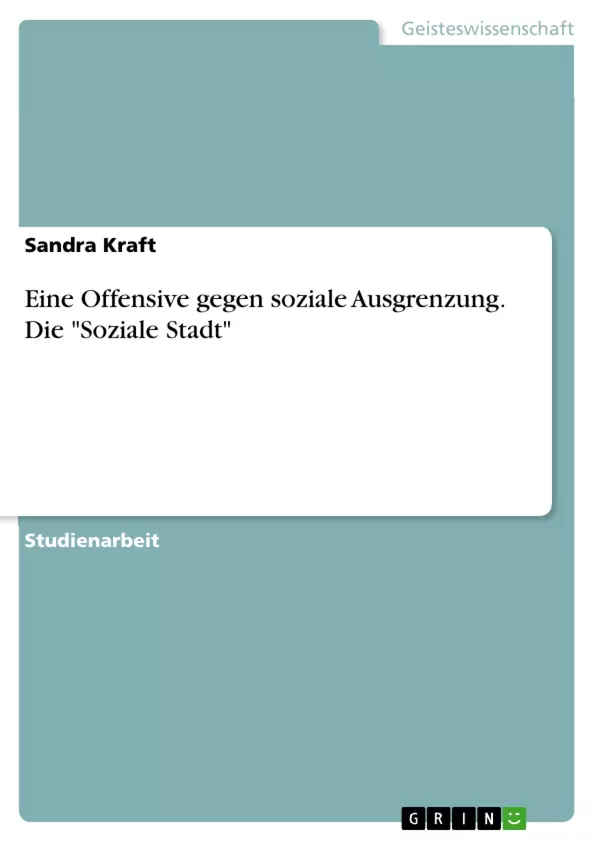Unter einer sozialen Stadt stellt man sich eine gemeinnützige, integrative, fördernde und wohlwollende Stadt vor. Eine Stadt, die die Lebenslage unterschiedlicher Menschen in benachteiligten Stadtteilen verbessert, offen für fremde Kulturen ist und Perspektiven für sozial schwächere MitbürgerInnen aufzeigt. Aber ist das Programm „Soziale Stadt“ eine sinnvolle Maßnahme gegen soziale Ausgrenzung von schwächeren Bezirken der Städte? Um diese zentrale Frage beantworten zu können, wird zunächst das Programm einmal näher betrachtet. Das Förderungsprogramm be-zieht sich auf verschiedene Handlungskonzepte, die größtenteils von Erfolg geprägt sind und im Laufe der Jahre weiterentwickelt wurden. Dagegen stehen viele Bereiche eher im Hintergrund und müssen kritisch hinterfragt werden, um mögliche Lücken schließen zu können.
Zugleich stellt sich eine ebenfalls doch so wichtige Frage, denn wie kommt es überhaupt zu den benachteiligten Stadtteilen und wann zählt ein Bezirk als „ausgegrenzt“? Hier gibt es etliche Einflüsse, die zu der Entstehung von „Problemvierteln“ ihren Beitrag leisten. Mögliche Effekte werden, in dieser Arbeit, anhand von vier Dimensionen näher erläutert: materielle Ressourcen, politische Repräsentanz, Symbolik des Ortes und soziales Milieu. Des Weiteren werden die Anforderungen an Schulen in Problembezirken betrachtet, denn auch hier ist ein hoher Handlungsbedarf erforderlich. Abschließend wird, anhand eines Praxisbeispiels in dem Stadtteil „Aschenberg“ in Fulda, die Re-Integration mit Hilfe des Förderungsprogramms „Soziale Stadt“ beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“
- Programmgrundlagen
- Ziele und Maßnahmen
- Die Entstehung von „Problemvierteln“
- Vier Dimensionen möglicher benachteiligender Effekte
- Segregation durch die Schulen
- Re-Integration benachteiligter Stadtteile am Beispiel „Aschenberg“ in Fulda
- Darstellung des Projekts „Brückenschlag“
- Zusammenstellung der Ergebnisse
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit „Eine Offensive gegen soziale Ausgrenzung - Die „Soziale Stadt“" befasst sich mit dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“, das sich auf die Verbesserung der Lebensbedingungen in benachteiligten Stadtteilen konzentriert. Die Arbeit analysiert die Ziele und Maßnahmen des Programms, die Entstehung von „Problemvierteln“ und die Re-Integration benachteiligter Stadtteile am Beispiel von „Aschenberg“ in Fulda.
- Analyse des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“
- Untersuchung der Entstehung von „Problemvierteln“
- Bewertung der Re-Integration von benachteiligten Stadtteilen
- Praxisbeispiel „Aschenberg“ in Fulda
- Bewertung der Wirksamkeit des Programms „Soziale Stadt“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Soziale Stadt“ ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Im zweiten Kapitel wird das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ detailliert beleuchtet, einschließlich seiner Programmgrundlagen, Ziele und Maßnahmen. Kapitel drei widmet sich der Entstehung von „Problemvierteln“ und analysiert die verschiedenen Dimensionen möglicher benachteiligender Effekte.
Im vierten Kapitel wird die Re-Integration von benachteiligten Stadtteilen am Beispiel des Stadtteils „Aschenberg“ in Fulda erläutert. Dabei wird insbesondere das Projekt „Brückenschlag“ vorgestellt und dessen Ergebnisse zusammengestellt.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit behandelt die Themen Soziale Ausgrenzung, „Soziale Stadt“, Städtebauförderung, benachteiligte Stadtteile, Re-Integration, „Problemviertel“, Integration, soziale Ungleichheit, Lebensbedingungen, Stadtentwicklung, Handlungskonzepte, Quartiersmanagement, Projektmanagement, Schulsozialarbeit, Praxisbeispiel, Aschenberg, Fulda.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Programms „Soziale Stadt“?
Das Ziel ist die Verbesserung der Lebensbedingungen in benachteiligten Stadtteilen durch integrative und fördernde Maßnahmen gegen soziale Ausgrenzung.
Wie entstehen sogenannte „Problemviertel“?
Die Entstehung wird durch vier Dimensionen erklärt: materielle Ressourcen, politische Repräsentanz, Symbolik des Ortes und das soziale Milieu.
Welche Rolle spielen Schulen bei der sozialen Ausgrenzung?
Schulen können zur Segregation beitragen; daher untersucht die Arbeit die speziellen Anforderungen an Bildungseinrichtungen in Problembezirken.
Was wird im Praxisbeispiel „Aschenberg“ in Fulda untersucht?
Es wird das Projekt „Brückenschlag“ vorgestellt, das zeigt, wie die Re-Integration eines benachteiligten Stadtteils durch das Programm gelingen kann.
Ist das Programm „Soziale Stadt“ uneingeschränkt erfolgreich?
Obwohl viele Konzepte erfolgreich sind, weist die Arbeit darauf hin, dass einige Bereiche kritisch hinterfragt werden müssen, um Lücken in der Förderung zu schließen.
- Arbeit zitieren
- Sandra Kraft (Autor:in), 2014, Eine Offensive gegen soziale Ausgrenzung. Die "Soziale Stadt", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274341