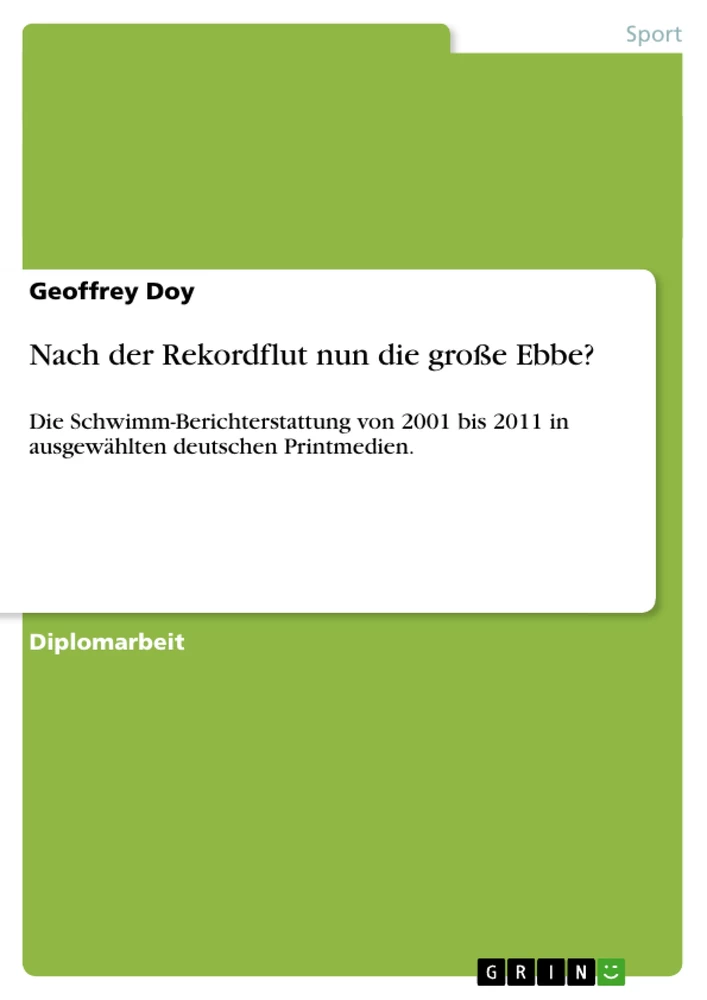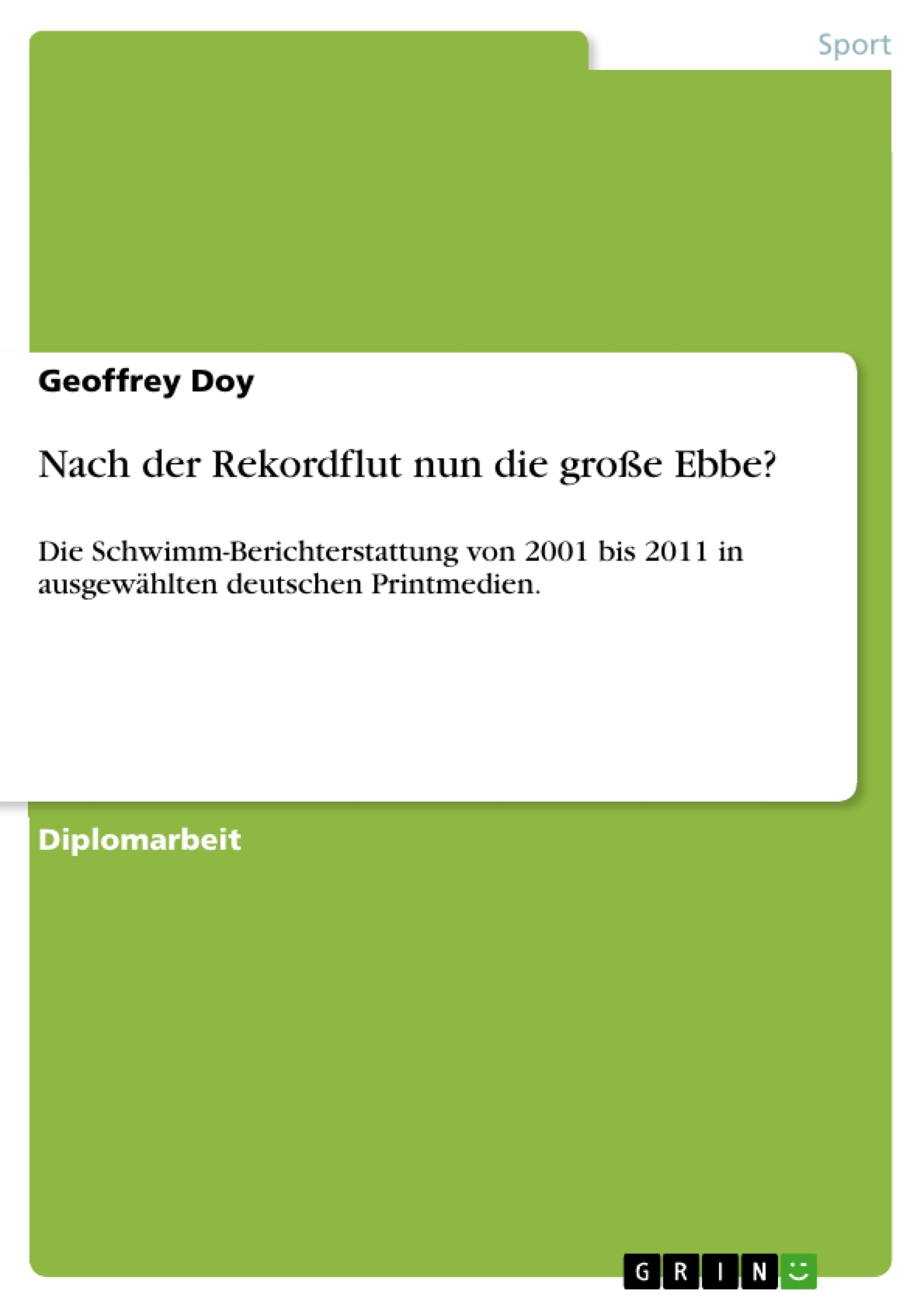Thomas Hahns Beschreibung des Schwimmsports aus dem Jahr 2007 schien sich also auch 2009 zu bewahrheiten: „die Schwimmer [schienen] ihre Meisterschaften ohne Weltrekorde gar nicht mehr zu akzeptieren, [...] als brauchten sie die Bestzeiten, weil die Dramaturgie ihrer Rennen sonst zu schwach sei“ (Hahn, 2007).
Großen Anteil an diesen „irrsinnigen Rekordexzessen“ (Steinle, 2009) hatten die Anzughersteller, deren Technologien die Schwimmer bis zu 5% schneller machten: zum Beispiel schwamm Paul Biedermann die 200m Freistil mit High-Tech-Anzug 4,82 Sekunden schneller als in Stoffhosen, in denen er für die gleiche Strecke ursprünglich 1:46:82 Minuten gebraucht hatte (vgl. hei/sid, 2010).
Doch just als die Rekordflut ihren Zenit bei der WM 2009 erreichte, wurde durch Beschluss der FINA-Delegierten ein Verbot der mit Plastik beschichteten High-Tech-Anzüge in die Wege geleitet. Ab 2010 waren für Männer nur noch knielange Stoffbadehosen zugelassen, bei den Frauen dementsprechend kurze Badeanzüge (vgl. Kelnberger, 2009).
Schwimmexperten prognostizierten daraufhin, dass mit Stoffanzügen auf absehbare Zeit keine neuen Weltrekorde mehr erzielt werden würden (ebd., 2009) und „Heldentum“ der Vergangenheit angehören würde. Betrachtet man im Nachgang die tatsächliche Entwicklung der Schwimm-Weltrekorde, war das Jahr 2010 in der Tat ein Jahr ohne Rekorde und auch im Jahr 2011 konnten nur zwei neue Weltrekorde aufgestellt werden.
Die vorliegende Arbeit soll am Beispiel der Printmedien untersuchen, wie sich die Schwimm-Berichterstattung im Allgemeinen im Laufe der Zeit entwickelte und, wenn möglich, im Speziellen analysieren, inwieweit die Reglementänderung bzgl. der Schwimmanzüge auf die Schwimmberichterstattung Einfluss hatte. Als Untersuchungszeiträume wurden die Schwimm-WM-Zeiträume von 2001 bis 2011 gewählt, denn die Schwimm-WM 2001 war die erste, in der ein mit einem Ganzkörperschwimmanzug ausgestattete Schwimmer zu den Wettkämpfen antrat (vgl. Philippsen, 2001).
Als wichtigster Bestandteil der Untersuchung soll die Erforschung der Nachrichtenfaktoren dienen, die letztendlich in den jeweiligen Redaktionen ausschlaggebend gewesen sein könnten, über die Schwimm-Weltmeisterschaften zu berichten. Um diese Forschungsziele zu erreichen, werden sechs ausgewählte Tageszeitungen (BILD-Zeitung, Münchner Abendzeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur und Hamburger Abendblatt) mit der empirischen Methode der Inhaltsanalyse untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsidee
- Wissenschaftliche Relevanz und Forschungsstand
- Einordnung der Arbeit in das Forschungsfeld
- Historie der kommunikationswissenschaftlichen Erforschung des Sportjournalismus
- Forschungsstand im Sportjournalismus zum Schwimmsport
- Schwimmsport in den Medien
- Nachrichtenforschung in der Kommunikationswissenschaft
- Walter Lippmann: Vater des Nachrichtenwerts
- Östgaard und die europäische Forschungstradition
- Galtung & Ruge: Erster empirischer Beleg für die Nachrichtenwerttheorie
- Sande: Die Nachrichtenwerttheorie auf dem Prüfstand
- Schulz: Realität in den Massenmedien
- Staab: Aufteilung der Nachrichtenwerttheorie in ein Kausal- und Finalmodell
- Eilders: Nachrichtenfaktoren mit dynamisch-transaktionalem Hintergrund
- Kepplinger und Bastian: Prognostischer Gehalt der Nachrichtenwert-Theorie
- Erneute Neuformulierung der Nachrichtenwert-Theorie
- Kepplinger & Bastians neues Analysemodell
- Zusammenfassung
- Meilensteine der Nachrichtenwerttheorie in der Sportberichterstattung
- Loosen: Erster Nachrichtenfaktorenkatalog für die Sportberichterstattung
- Dachenhausen: Nachrichtenfaktoren aus Sicht der Sportjournalisten
- Die Zeitung als Massenmedium
- Massenmedien: Definition und Funktion
- Entwicklung der deutschen Tagespresse seit 1945
- Die 1990er Jahre und die schwere Krise nach der Jahrtausendwende
- Aktueller Zeitungsmarkt
- Sport in der Tageszeitung
- Schwimmsport
- Der moderne Schwimmsport seit 1900
- Schwimmweltmeisterschaften
- Untersuchungsdesign dieser Arbeit
- Forschungsleitende Fragestellungen
- Hypothesen
- Methodenentscheidung
- Inhaltsanalyse
- Quantitative vs. qualitative Inhaltsanalyse
- Vor- und Nachteile gegenüber anderen Methoden
- Untersuchungsgegenstände
- Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Die Süddeutsche Zeitung
- Die BILD-Zeitung
- Die Münchener Abendzeitung
- Der Münchner Merkur
- Das Hamburger Abendblatt
- Untersuchungszeiträume
- Ablauf der Inhaltsanalyse
- Untersuchungseinheiten
- Kategoriensystem
- Analyseebene I: Formale Ebene
- Analyseebene II: Inhaltliche Kategorien und Nachrichtenfaktoren
- Hauptthemen
- Schlagwortgruppen: Weltrekord, Weltmeister, Schwimmanzug
- Haupthandlungsträger allgemein
- Tonalität
- Haupthandlungsträger im Speziellen
- Nachrichtenfaktoren
- Analyseebene III: Abbildungen
- Abbildungsart
- Art der Abbildungsbeschriftung
- Abbildungsbeschriftungen — Detailliert
- Abbildungsquellen
- Abgebildete Schwimm-Sportart
- Geschlecht der abgebildeten Person
- Abgebildete Personen
- Funktion und Situation der abgebildeten Person
- Tonalität der Abbildung
- Pretests
- Reliabilitätstest
- Präsentation und Diskussion der Ergebnisse
- Basisdaten
- Ergebnisse Analyseebene I: Formale Ebene
- Journalistische Darstellungsform
- Quellenangaben
- Überschriften
- Ergebnisse Analyseebene II: Inhaltliche Kategorien und Nachrichtenfaktoren
- Hauptthemen
- Schlagwortgruppen: Weltrekord, Weltmeister, Schwimmanzug
- Haupthandlungsträger allgemein
- Tonalität
- Haupthandlungsträger im Speziellen
- Nachrichtenfaktoren
- Ergebnisse Analyseebene III: Abbildungen
- Abbildungsart
- Art der Abbildungsbeschriftung
- Abbildungsbeschriftungen — Detailliert
- Abbildungsquellen
- Abgebildete Schwimm-Sportart
- Geschlecht der abgebildeten Person
- Abgebildete Personen
- Funktion und Situation der abgebildeten Person
- Tonalität der Abbildung
- Hypothesendiskussion
- FAZIT
- Literaturverzeichnis
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- Anhang
- Codebuch
- Hauptthemen gesamt pro WM
- Hauptthemen gesamt pro Zeitung
- Haupthandlungsträger gesamt
Häufig gestellte Fragen
Warum wurden High-Tech-Schwimmanzüge verboten?
Die FINA verbot die Anzüge ab 2010, da sie durch Plastikbeschichtungen und Kompression die Schwimmer bis zu 5 % schneller machten, was zu einer als unnatürlich empfundenen Rekordflut führte.
Wie beeinflusste das Verbot die Anzahl der Weltrekorde?
Nach dem Verbot der High-Tech-Anzüge gab es eine 'Ebbe': Im Jahr 2010 wurden gar keine und 2011 nur zwei neue Weltrekorde aufgestellt.
Welche Rolle spielen Nachrichtenfaktoren in der Sportberichterstattung?
Nachrichtenfaktoren wie 'Rekord', 'Erfolg' oder 'Skandal' entscheiden darüber, wie intensiv Medien über Sportereignisse wie die Schwimm-WM berichten.
Welche Zeitungen wurden in der Inhaltsanalyse untersucht?
Untersucht wurden die BILD-Zeitung, Münchner Abendzeitung, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur und das Hamburger Abendblatt.
Hat die Änderung der Schwimmanzug-Regeln die Medienberichterstattung verändert?
Die Arbeit analysiert, ob das Fehlen von Rekorden zu einem Rückgang des medialen Interesses oder zu einer thematischen Verschiebung in den Printmedien geführt hat.
- Quote paper
- Geoffrey Doy (Author), 2013, Nach der Rekordflut nun die große Ebbe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274396