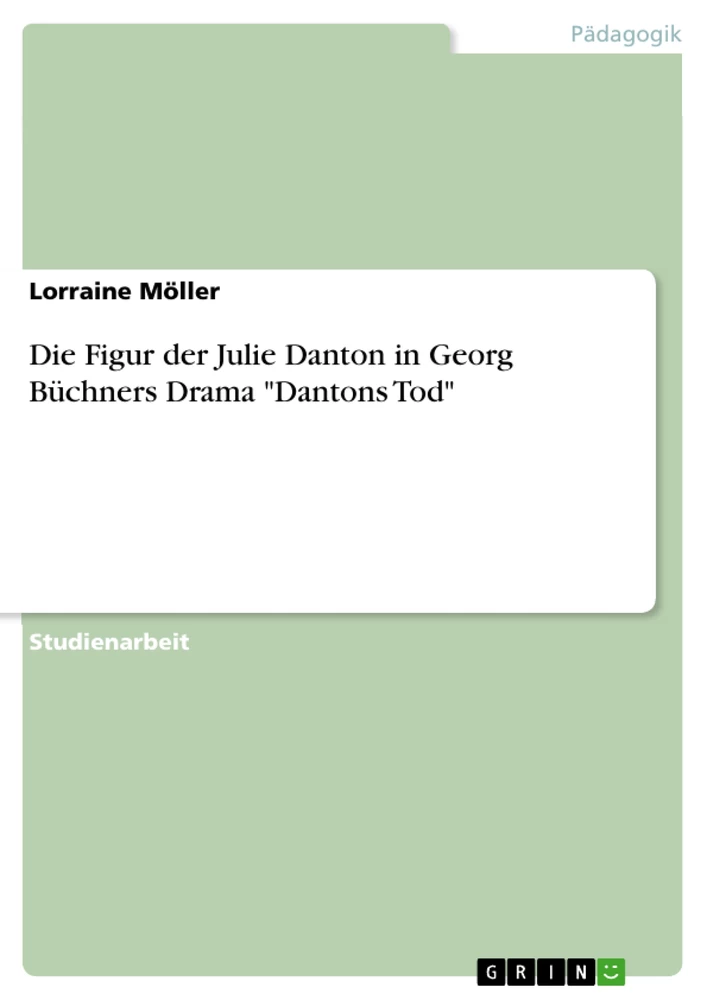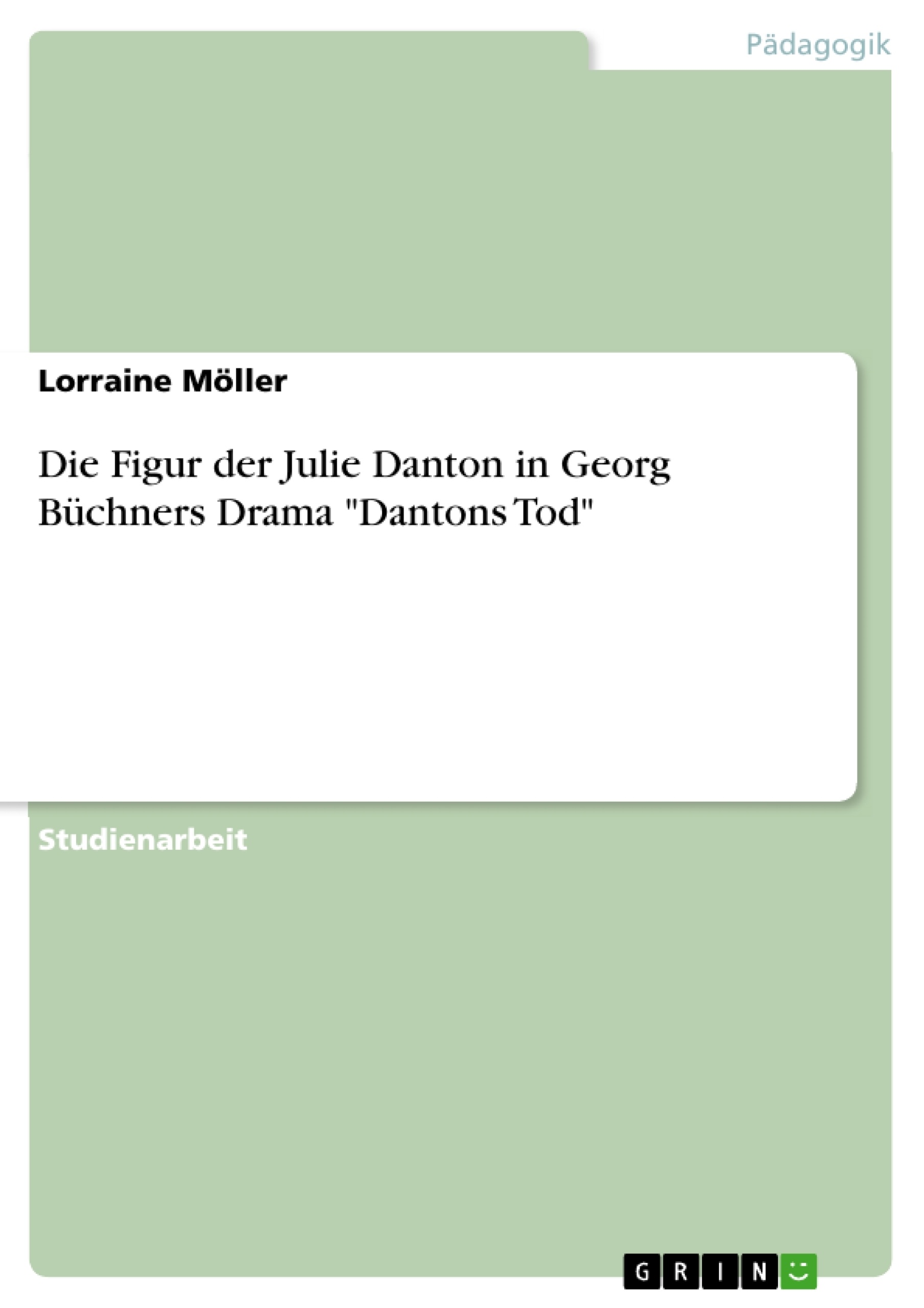Georg Büchner lässt sein Stück "Dantons Tod" mit Dantons Überlegungen zu „coeur“ und „carreau“ beginnen, die weiterführen zu einer Liebeserklärung an Julie, und beendet es mit Luciles Schlussworten, die ihren Gatten nicht überleben will, womit das Stück als Ganzes von der Liebe und den beiden weiblichen Hauptfiguren eingeschlossen ist. „Lieb Georg“, sagt Julie zu ihrem Danton. Und Danton nennt seine Frau „lieb Kind“, so wie Büchner selbst seine Wilhelmine Jaeglé gerne anredete, was für ein besonderes Interesse Büchners an der Julie-Figur spricht, die in dieser Arbeit mit ihrem Wesen und ihrer Beziehung zu Danton im Fokus der Betrachtung stehen soll.
Um die Figur der Julie Danton näher zu untersuchen, wird zunächst auf die gesellschaftliche Rolle der Frau im Drama eingegangen. Danach wird gezeigt, dass Büchner im Fall der Frauenfiguren von den historischen Vorbildern abweicht, um sie nach seiner Phantasie so zu gestalten, dass sie die von ihm angedachten Rollen erfüllen können.
Im anschließenden Teil wird durch die Untersuchung der vier Auftritte von Julie (I.1, II.5, IV.2, IV.6) gezeigt werden, dass sie die stärkere und gefasstere Persönlichkeit der beiden Eheleute ist und sich gegenüber Danton als echte Partnerin erweist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ansatzpunkte für die Bedeutung der Frauenfiguren
- Die gesellschaftliche Rolle der Frau im Drama
- Dichterische Schöpfung statt historischer Bezüge für die Charaktere der Frauenfiguren
- Das Wesen der Julie Danton und das Verhältnis zu ihrem Gatten Georg Danton
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Figur der Julie Danton im Drama „Dantons Tod" von Georg Büchner. Sie untersucht die gesellschaftliche Rolle der Frau in der Zeit der Französischen Revolution, die sich im Drama widerspiegelt, und beleuchtet die dichterische Freiheit, die Büchner bei der Gestaltung der Frauenfiguren ausübt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beziehung zwischen Julie Danton und ihrem Ehemann Georg Danton, wobei ihre Liebe und ihr gemeinsames Schicksal im Mittelpunkt stehen.
- Die gesellschaftliche Rolle der Frau im Drama
- Die dichterische Gestaltung der Frauenfiguren
- Die Beziehung zwischen Julie Danton und Georg Danton
- Das Motiv des Liebestodes
- Die Verbindung von Liebe und Tod
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet die Rezeption des Dramas „Dantons Tod". Sie stellt die Rolle der Frauenfiguren in der Forschungsliteratur dar und hebt die Bedeutung der Liebe und des Liebestodes im Stück hervor.
Das zweite Kapitel widmet sich der gesellschaftlichen Rolle der Frau im Drama und beleuchtet die Geschlechterrollen im späten 18. Jahrhundert. Es wird gezeigt, dass Frauen in dieser Zeit als ungeeignet für das öffentliche Leben galten und auf ihre Körperlichkeit und Sexualität reduziert wurden. Die Männer im Drama repräsentieren die patriarchalische Revolution und sehen Frauen als „das andere Geschlecht", dessen Sexualität ihr Denken beeinflusst.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der dichterischen Schöpfung der Frauenfiguren. Es wird dargelegt, dass Büchner im Gegensatz zu den männlichen Figuren von den historischen Vorbildern der Frauenfiguren abweicht und sie nach seiner Phantasie gestaltet. Er lehnt sich dabei an literarische Vorbilder wie Julia aus Shakespeares „Romeo and Juliet" und Ophelia aus „Hamlet" an und kreiert zwei asymmetrische Figuren: Julie, die in Dantons Sozialmilieu integriert ist und ihn versteht, und Lucile, die dem öffentlichen Raum fern steht und politische Überlegungen nicht versteht.
Das vierte Kapitel analysiert die Figur der Julie Danton und ihre Beziehung zu ihrem Gatten Georg Danton. Es werden die vier Auftritte der Figur im Drama untersucht und die Dialoge zwischen Julie und Danton interpretiert. Die Liebe und der Wunsch nach Ruhe und Geborgenheit, den Danton verspürt, stehen im Zentrum der Analyse. Julie wird als die stärkere und gefasstere Persönlichkeit der beiden dargestellt, die Danton in seinen Alpträumen tröstet und ihm in seinem letzten Lebensabschnitt beisteht. Ihr selbstbestimmter Liebestod in Szene IV_6 zeigt ihre tiefe Verbundenheit und bedingungslose Liebe zu Danton.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Figur der Julie Danton, das Drama „Dantons Tod", Georg Büchner, die gesellschaftliche Rolle der Frau in der Zeit der Französischen Revolution, die dichterische Gestaltung der Frauenfiguren, die Beziehung zwischen Julie Danton und Georg Danton, das Motiv des Liebestodes, die Verbindung von Liebe und Tod, die Asymmetrie der Frauenfiguren, die literarischen Vorbilder Julia und Ophelia, der Wunsch nach Ruhe und Geborgenheit, der selbstbestimmte Liebestod, die tiefe Verbundenheit und bedingungslose Liebe.
- Quote paper
- Lorraine Möller (Author), 2013, Die Figur der Julie Danton in Georg Büchners Drama "Dantons Tod", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274444