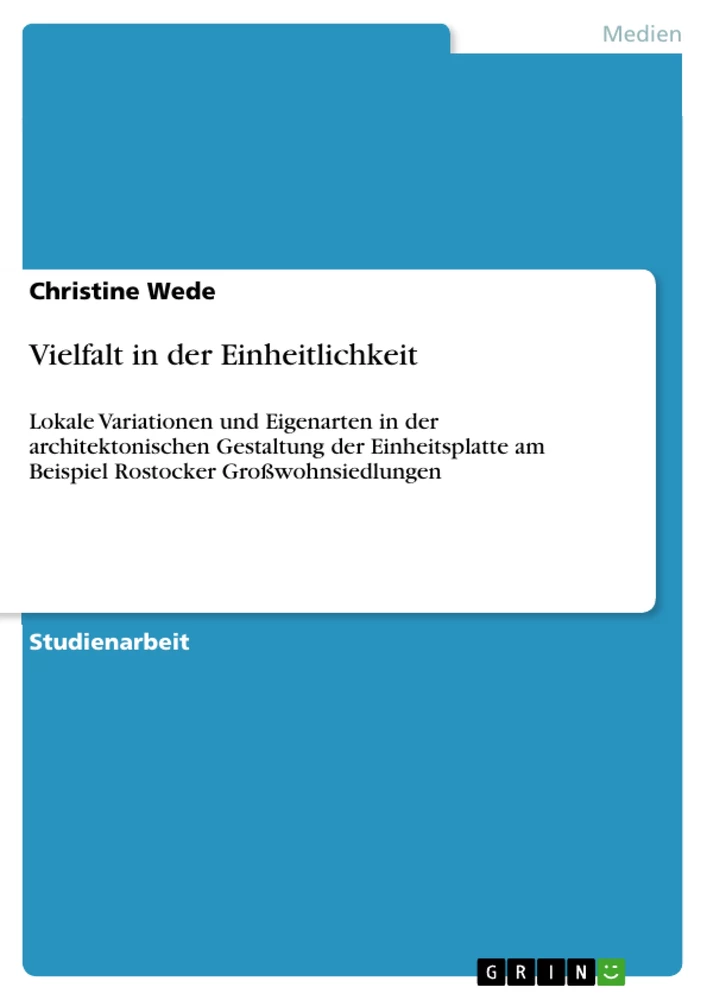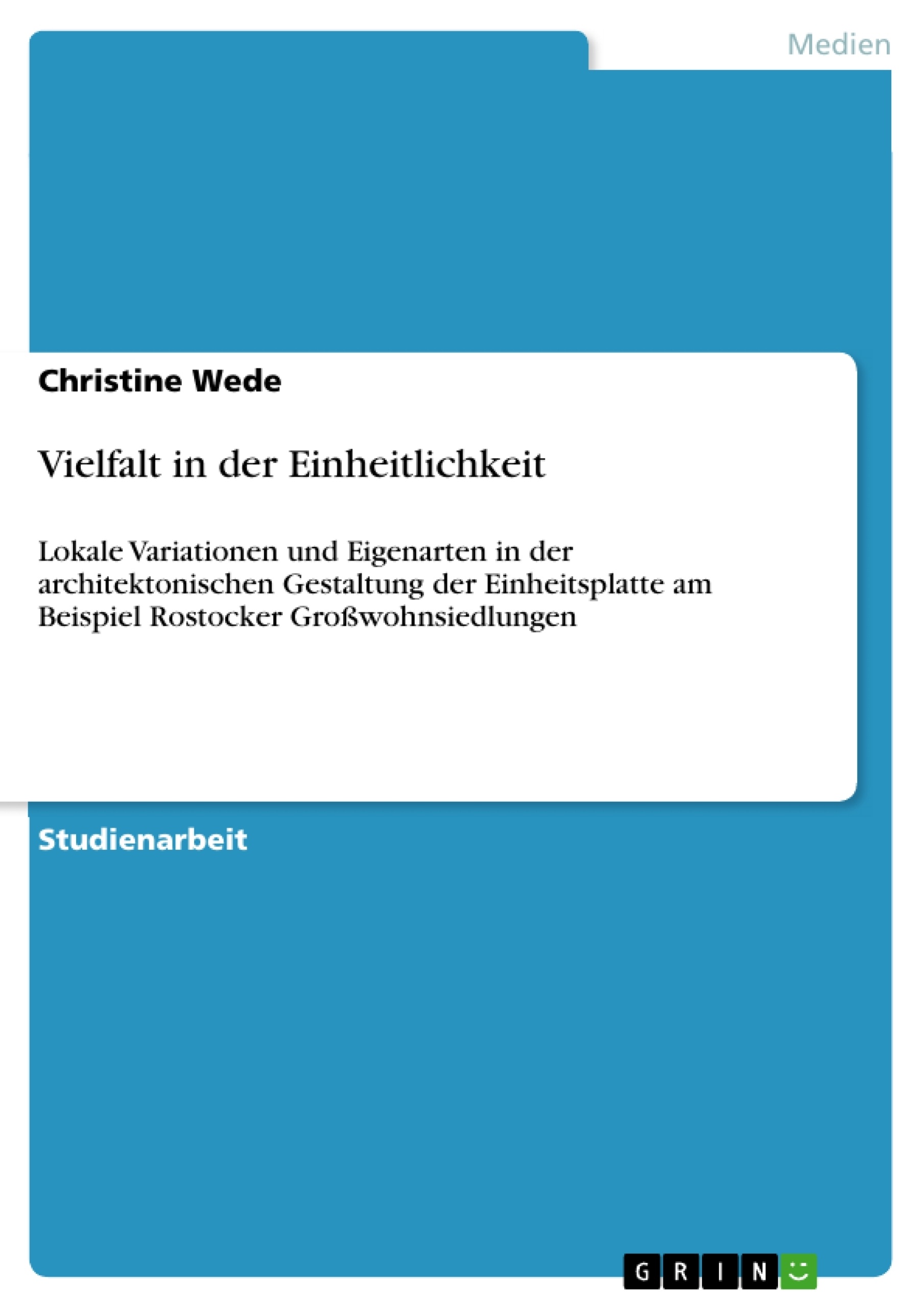In seinem 1990 erschienen Artikel „Die betonierte Zukunft - Zum Wohnungsbauprogramm der DDR“ formulierte Jürgen Rostock zusammenfassend, dass Architektur in der DDR nur ausnahmsweise stattgefunden habe. Es entstand massenhaft Monotonie. Als Hauptursache dieser Monotonie galt dabei die Umstellung des Bauwesens auf die Industrialisierung der bauproduktiven Prozesse ab Mitte der 50er Jahre. Damit verbunden waren nicht nur eine Standardisierung, Typisierung und späteren Reduktion des Wohnungsbaus auf ein Mindestmaß, sondern auch Auswirkungen auf die bauliche Gestalt der Gebäude. Bis Anfang der siebziger Jahre wurden immer wieder neue Bautypen für den Wohnungsbau entwickelt und eingeführt. Mit jedem neuen Serientyp werden funktionelle, konstruktive und technologische Bauelemente weiter vereinfacht und genormt, um trotz Ressourcenmangels die Idee eines Baukastensystems immer näher zu kommen. Ungeachtet der Dominanz des industriellen Bauens durch Vorfertigungen, materialsparender Konzeption und Vor-Ort- Montage wurden die angestrebten ökonomischen, technologisch-konstruktiven und bauproduktiven Anforderungen nicht erreicht. Die Einwohnerdichte lag auf Grund der weitläufigen, offenen Bebauung der Neubaugebiete an den städtischen Randlagen unter den Erwartungen. Auf Beschluss der 5. Baukonferenz des Zentralkomitees der SED und des Ministerrates der DDR sollte ab 1970 ein kosteneffektiveres „Einheitssystem Bau“ entwickelt werden, der nicht nur die Einwohnerzahl steigern, sondern auch den städtischen Raum stärker verdichten sollte. Hintergrund bildete dabei die sozialpolitische Neuorientierung der SED-Führung auf Grund des Wohnungsmangels in der DDR. Die „Lösung der Wohnungsfrage“ war Reaktion auf eine verfehlte Wohnungspolitik in den vorangegangenen Jahren in der Ulbricht-Ära. Die Bauwirtschaft und der Wohnungsbau spielten lange Zeit eine untergeordnete Rolle. In den Nachkriegsjahren war der Aufbau einer vom Westen unabhängigen Schwerindustrie innerhalb der DDR bestimmend. Diese Bemühungen banden für einen langen Zeitraum für den Wohnungsbau notwendiges Geld, Baumaterialien und Humankapital. In erster Linie entstand neuer Wohnraum im Einzugsgebiet großer Städte wie Leipzig, Dresden oder Berlin, an Küstengebieten mit einer vorhandenen Industriestruktur und essentiellen Industrieschwerpunkten wie Eisenhüttenstadt und Hoyerswerda.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Verständnis von Architektur und Technik
- Das Rostocker Wohnungsbauprogramm
- Entwicklungstendenzen in den 50er und 60 Jahren
- Die Großwohnsiedlungen der 70er Jahre
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der architektonischen Gestaltung der Einheitsplatte am Beispiel Rostocker Großwohnsiedlungen und untersucht die lokalen Variationen und Eigenarten in der Umsetzung des einheitlichen Bauprogramms der DDR. Sie analysiert den Einfluss von politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren auf die Gestaltung der Plattenbauten und die Entwicklung der Rostocker Wohnungsbauprogramme in den 50er bis 80er Jahren.
- Die Entwicklung des Wohnungsbauprogramms der DDR und die Entstehung der Einheitsplatte
- Das Verhältnis von Architektur und Technik im Kontext des industriellen Wohnungsbaus
- Die Herausforderungen der Gestaltung von Großwohnsiedlungen und die Suche nach lokalen Lösungen
- Die Rolle von politischer Ideologie und ökonomischen Zwängen in der Gestaltung der Plattenbauten
- Die Bedeutung von Architektur und Städtebau für die Identifikation der Bewohner mit dem neuen Wohngebiet
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Es beleuchtet die Entwicklung des Wohnungsbauprogramms der DDR und die Entstehung der Einheitsplatte als Reaktion auf den Wohnungsmangel und die sozialpolitische Neuorientierung der SED-Führung. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Verständnis von Architektur und Technik im Kontext des industriellen Wohnungsbaus. Es analysiert die Vorgaben der sozialistischen Städtebau- und Architekturpolitik und die Herausforderungen der Gestaltung von Wohngebieten unter den Bedingungen der industriellen Fertigung. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf das Rostocker Wohnungsbauprogramm. Es untersucht die Entwicklungstendenzen in den 50er und 60er Jahren und analysiert die Besonderheiten der Großwohnsiedlungen der 70er Jahre, wie Evershagen, Lichtenhagen und Schmarl. Es beleuchtet die spezifischen Gestaltungslösungen, die im Kontext der Rostocker Gegebenheiten entwickelt wurden, und die Auswirkungen von politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren auf die Architektur der Plattenbauten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Einheitsplatte, Großwohnsiedlungen, Rostocker Wohnungsbauprogramm, DDR-Architektur, Industrialisierung des Bauwesens, lokale Variationen, Gestaltungsvielfalt, Einheitlichkeit, Monotonie, politische Ideologie, ökonomische Zwänge, städtebauliche Entwicklung, Wohnungsbaupolitik, sozialistische Gesellschaft, Identifikation der Bewohner, Heimatgefühl, Architektur und Technik, Fassadengestaltung, Städtebau, Wohnumwelt, Stadtentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Einheitssystem Bau" der DDR?
Es war ein ab 1970 entwickeltes Baukastensystem zur industriellen Fertigung von Wohnraum (Plattenbau), um die Wohnungsnot kosteneffektiv zu lösen.
Warum wird von "Vielfalt in der Einheitlichkeit" gesprochen?
Trotz der Standardisierung der Plattenbauweise gab es in Städten wie Rostock lokale Variationen und gestalterische Eigenarten, um Monotonie entgegenzuwirken.
Welche Rostocker Stadtteile werden als Beispiele genannt?
Die Arbeit analysiert die Großwohnsiedlungen Evershagen, Lichtenhagen und Schmarl aus den 1970er Jahren.
Was war die Ursache für die Monotonie im DDR-Wohnungsbau?
Hauptursachen waren die Industrialisierung der Bauprozesse, Ressourcenmangel sowie die extreme Typisierung und Reduktion auf ein Mindestmaß an Bauelementen.
Wie beeinflusste die Politik die Architektur in der DDR?
Die SED-Führung priorisierte die "Lösung der Wohnungsfrage" als sozialpolitisches Ziel, was zu einer Dominanz von Ökonomie und Technik über die künstlerische Gestaltung führte.
Welche Rolle spielten die "5. Baukonferenz" und der Ministerrat?
Auf diesen Gremien wurde der Beschluss gefasst, das Bauwesen radikal zu rationalisieren und das industrielle Bauen als Standard für die gesamte Republik festzulegen.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Ing. Christine Wede (Autor:in), 2012, Vielfalt in der Einheitlichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274676