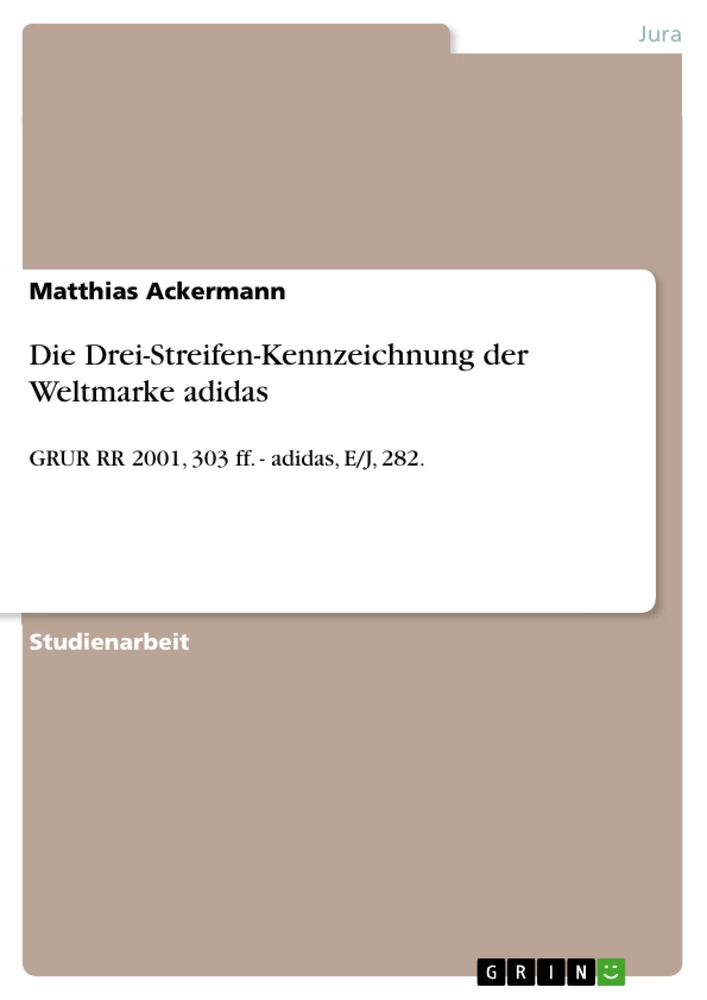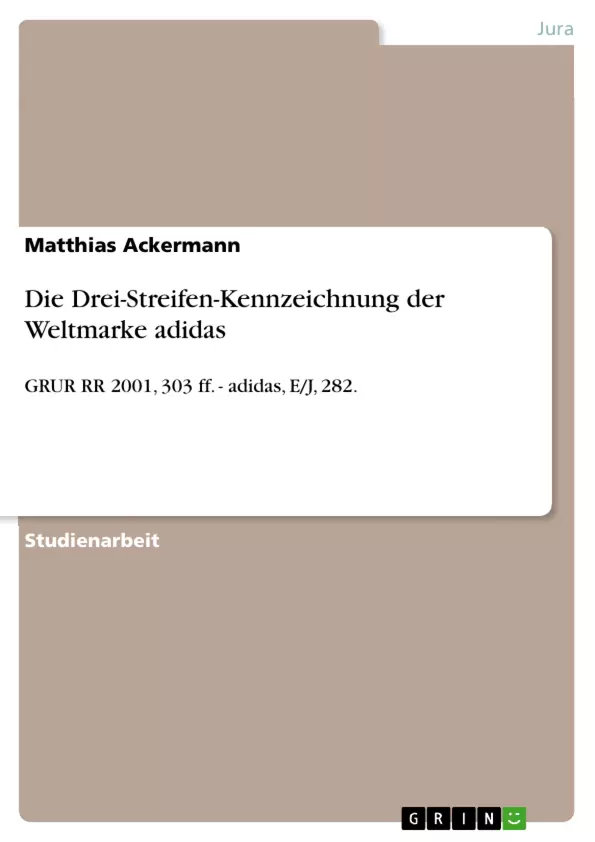Adidas ist einer der weltweit größten Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Herzogenaurach. 2012 beschäftigt der Konzern über 46.000 Mitarbeiter mit einem Umsatz von fast 15 Milliarden Euro. Die adidas Erfolgsgeschichte begann jedoch schon vor mehr als 60 Jahren. Denn am 18. August 1949 gründete Adi Dassler nicht nur die „Adi Dassler adidas Sportschuhfabrik“ sondern ließ am selben Tag auch einen Schuh in das Fürther Handelsregister eintragen sowie das berühmte Markenzeichen der 3-Streifen. Unter dieser Kennzeichnung wurde adidas auch mit dem Slogan „Die Marke mit den Drei Streifen“ bekannt und hat einen überaus hohen Bekanntheitsgrad und Wiedererkennungswert inne. Eines der Ziele vom Unternehmen adidas ist es die eigene Marke und deren Kennzeichnung gegenüber dem Wettbewerb zu schützen. Denn in Fällen der Affinität von Waren kann eine Zeichenähnlichkeit bezüglich der Kennzeichnung der verkauften Produkte zur Verwechslung der Marke führen. Um dem jedoch entgegenzusteuern sowie die eigene Marke zu schützen beschreiten Unternehmen wie adidas den Klageweg. Im Folgenden wird eine von adidas erhobene Klage, die im Jahr 2001 vom Oberlandesgericht München entschieden wurde, genauer betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Ablauf der Arbeit
- Die adidas-Entscheidung — Das Urteil des OLG München, 29.07.2001 -29 U 2361/97
- Der Verfahrensgang
- Die Rechtsgrundlagen
- Der Tatbestand
- Zusammenfassung des Urteils
- Die Entscheidungsgründe
- Kritische Betrachtung des Urteils
- Die Markenrechtliche Verwechslungsgefahr
- Die Frage der Warenähnlichkeit
- Die Frage der Kennzeichnungskraft der Kennzeichnung
- Die Beurteilung des Gesamteindruckes der Marke
- Die Verwechslung durch den Verbraucher
- Sonstige Faktoren zur Urteilsfindung
- Die Markenrechtliche Verwechslungsgefahr
- Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Urteil des Oberlandesgerichts München vom 29. Juli 2001, das sich mit der Drei-Streifen-Kennzeichnung der Marke adidas auseinandersetzt. Ziel der Arbeit ist es, die Entscheidungsgründe des Gerichts zu analysieren und kritisch zu betrachten. Dabei werden die relevanten Rechtsgrundlagen und die Argumente der Klägerin und der Beklagten beleuchtet.
- Markenrechtliche Verwechslungsgefahr
- Kennzeichnungskraft der Drei-Streifen-Kennzeichnung
- Warenähnlichkeit
- Schutzumfang der Marke
- Verwechslungsgefahr durch den Verbraucher
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Problemstellung und die Zielsetzung dar. Das zweite Kapitel erläutert das Urteil des OLG München, wobei der Verfahrensgang, die Rechtsgrundlagen, der Tatbestand, die Zusammenfassung des Urteils und die Entscheidungsgründe dargestellt werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit der kritischen Betrachtung des Urteils, indem die markenrechtliche Verwechslungsgefahr, die Kennzeichnungskraft der Kennzeichnung, die Warenähnlichkeit und die Verwechslungsgefahr durch den Verbraucher untersucht werden. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Drei-Streifen-Kennzeichnung, die Markenrechtliche Verwechslungsgefahr, die Kennzeichnungskraft, die Warenähnlichkeit, den Schutzumfang der Marke, die Verwechslungsgefahr durch den Verbraucher, das Urteil des OLG München, die Rechtsgrundlagen und die kritische Betrachtung des Urteils.
- Quote paper
- Matthias Ackermann (Author), 2014, Die Drei-Streifen-Kennzeichnung der Weltmarke adidas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274806