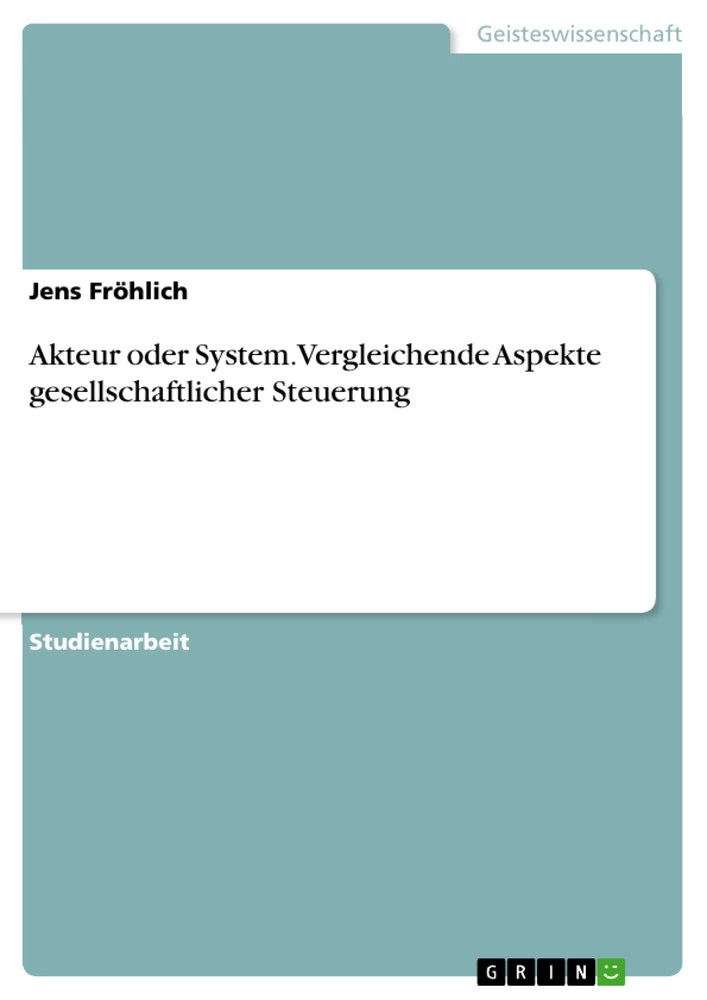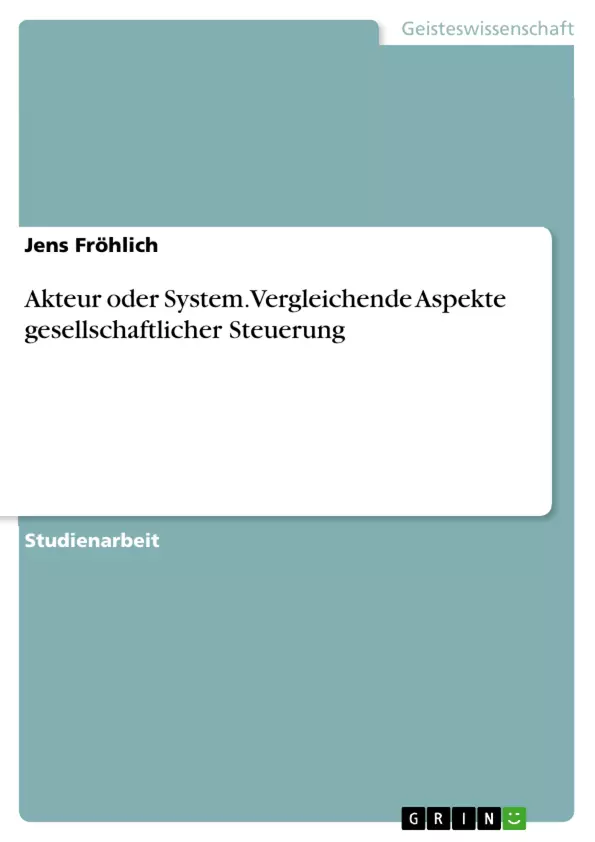„Selbst auf der Ebene der Schulaufsicht, die in der Regel eher mangelnde Veränderungsbereitschaft zeigte, gab es für Reformen zugängliche Einzelpersonen“ (Hüwe/ Roebke, 2006).
Inhaltlich betrachtet birgt das o. g. Zitat, welches sich auf Vorgänge im Zusammenhang mit der Entstehung erster Integrationsklassen in der Bundesrepublik Deutschland in den neunzehnhundertsiebziger Jahren bezieht, eine übersichtliche und verständliche Aussage. Soziologisch allerdings impliziert sie trotz ihrer Kürze und Einfachheit eine nicht nur beachtliche Anzahl, sondern auch eine umfangreiche Verflechtung gesellschaftlicher Steuerungsaspekte.
Da gibt es die Ebene der Schulaufsicht, auf der möglicherweise nicht viel verändert werden soll, was aber nicht heißen muss, dass durch sie nicht gesteuert wird. Weiterhin die Gruppe der Eltern, also sowohl Einzelner als auch Elterninitiativen/Organisationen, die sich eben für die oben angeführten Reformen aussprechen. Schließlich sind da noch die genannten Einzelpersonen. Letztere nehmen eine sehr interessante Position ein, wenn man bedenkt, dass sie als individuelle Akteure innerhalb eines bildungspolitischen Teilsystems Entscheidungen treffen könnten, die potenziell nicht mit ihrer Bereichskompetenz korrespondieren.
Unter der Annahme einer funktional differenzierten Gesellschaft haben wir es hier also mit steuernden Einzelakteuren, Organisationen und Teilsystemen zu tun. Die subjektiven Akteure handeln innerhalb korporativer Systeme und beeinflussen mutmaßlich die in ihnen festgelegten Zielsetzungen. Aber auch von den Organisationen und gesellschaftlichen Teilsystemen gehen Steuerungsversuche aus. Kann man auch hier von handlungsfähigen Akteuren sprechen?
In dieser Arbeit möchte ich zeigen, wie vielfältig sich der Bereich der gesellschaftlichen Steuerung/Selbststeuerung darstellen kann. Nachdem ich die Herkunft des Steuerungsbegriffs und seine möglichen modalen Verwendungszusammenhänge aufgezeigt habe, lässt sich dieser aus systemtheoretischer und akteurtheoretischer Sicht genauer ausleuchten. Ein Blick auf verschiedene Kombinationsmöglichkeiten zwischen System und Akteur schließt sich an, um abschließend Ansätze einer aktiven Gesellschaftssteuerung zu betrachten, die sich mit der Handlungsfähigkeit korporativer Akteure beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Differenzierung des Begriffs der gesellschaftlichen Steuerung/Selbststeuerung
- Entwicklung und Bedeutung des Steuerungsbegriffs
- Wirk-Modi und Akteurtypen
- Systemtheoretische Gesichtspunkte gesellschaftlicher Steuerung/Selbststeuerung
- Kybemetik und Differenzminderung
- Selbststeuerung autopoietischer Systeme
- Strukturelle Kopplung
- Akteurtheoretische Überlegungen zur Begrifflichkeit der gesellschaftlichen Steuerung/Selbststeuerung
- Steuerungsfähigkeit des Handelns
- Orientierungsgeprägtes Steuerungshandeln
- Assoziation akteurtheoretischer und systemtheoretischer Ansätze gesellschaftlicher Steuerung/Selbststeuerung
- Der absente Akteur
- Rekonstituierung des Akteurs im Rahmen systemtheoretischer Präsumtion
- Organisationen und Teilsysteme als Handlungseinheiten
- Kollektive individueller Akteure
- Systemischer Status der Organisation als handelnder Akteur
- Akteursysteme
- Korporative Systeme als aktiv steuernde Akteure
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem komplexen Thema der gesellschaftlichen Steuerung und Selbststeuerung. Ziel ist es, die verschiedenen theoretischen Ansätze, insbesondere aus der Systemtheorie und der Akteurstheorie, zu beleuchten und ihre Relevanz für die Erklärung von Steuerungsvorgängen in der Gesellschaft zu erörtern. Dabei werden die unterschiedlichen Perspektiven auf den Akteur und das System, sowie die Interaktion zwischen beiden, analysiert.
- Entwicklung und Bedeutung des Steuerungsbegriffs
- Systemtheoretische und akteurtheoretische Ansätze zur Erklärung von Steuerungsprozessen
- Die Rolle von Organisationen und Teilsystemen in der Steuerung
- Korporative Systeme als aktive Steuerungsakteure
- Die Bedeutung von Wissen für gesellschaftliche Steuerung und Selbststeuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der gesellschaftlichen Steuerung und Selbststeuerung ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Steuerung differenziert und seine Entwicklung und Bedeutung im Kontext unterschiedlicher Sichtweisen beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich systemtheoretischen Gesichtspunkten und erläutert die Konzepte der Kybernetik, der Selbststeuerung autopoietischer Systeme und der strukturellen Kopplung. Kapitel 4 betrachtet die gesellschaftliche Steuerung aus akteurtheoretischer Perspektive und analysiert die Steuerungsfähigkeit des Handelns sowie die Rolle von Handlungsorientierungen. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Assoziation von systemtheoretischen und akteurtheoretischen Ansätzen und analysiert die Rekonstituierung des Akteurs im Rahmen systemtheoretischer Präsumtion sowie die Rolle von Organisationen und Teilsystemen als Handlungseinheiten. Kapitel 6 widmet sich den korporativen Systemen als aktiven Steuerungsakteuren und beleuchtet die Bedeutung von Selbsttransformation, kollektivem Wissen und repräsentationaler Interaktion.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen gesellschaftliche Steuerung, Selbststeuerung, Systemtheorie, Akteurstheorie, funktional differenzierte Gesellschaft, Organisationen, Teilsysteme, korporative Systeme, kollektives Wissen, strukturelle Kopplung, Steuerungsprobleme und Reflexion.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet gesellschaftliche Steuerung?
Gesellschaftliche Steuerung bezeichnet die Beeinflussung von gesellschaftlichen Prozessen und Systemen durch Akteure (Individuen), Organisationen oder Teilsysteme, um bestimmte Ziele zu erreichen.
Was ist der Unterschied zwischen Akteur- und Systemtheorie?
Die Akteurtheorie fokussiert auf das Handeln und die Entscheidungen von Individuen. Die Systemtheorie (nach Luhmann) betrachtet die Gesellschaft als Geflecht autopoietischer Systeme, die sich primär selbst steuern.
Was sind autopoietische Systeme?
In der Systemtheorie sind dies Systeme, die sich selbst erhalten und ihre eigenen Elemente durch interne Kommunikation produzieren, was eine direkte Steuerung von außen erschwert.
Können Organisationen als handlungsfähige Akteure gelten?
Ja, im Sinne korporativer Akteure können Organisationen Ziele verfolgen und Entscheidungen treffen, die über das Handeln einzelner Individuen hinausgehen.
Welche Rolle spielt Wissen bei der Steuerung?
Kollektives Wissen ist eine Voraussetzung für aktive Gesellschaftssteuerung, da es die Grundlage für Reflexion und die Transformation von Systemen bildet.
- Quote paper
- Jens Fröhlich (Author), 2014, Akteur oder System. Vergleichende Aspekte gesellschaftlicher Steuerung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274846