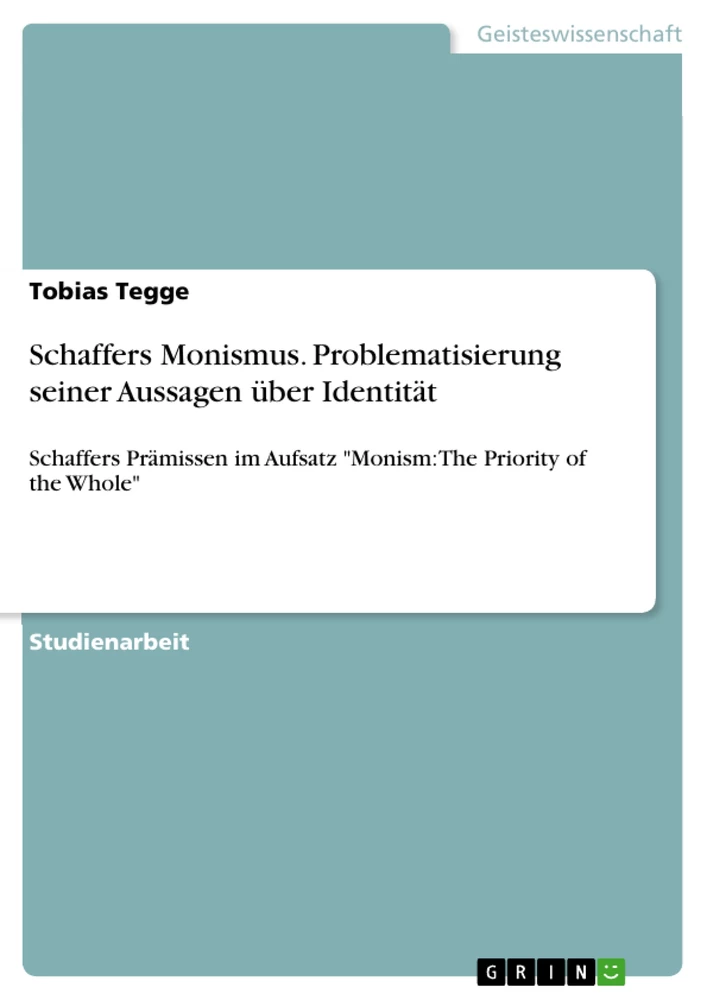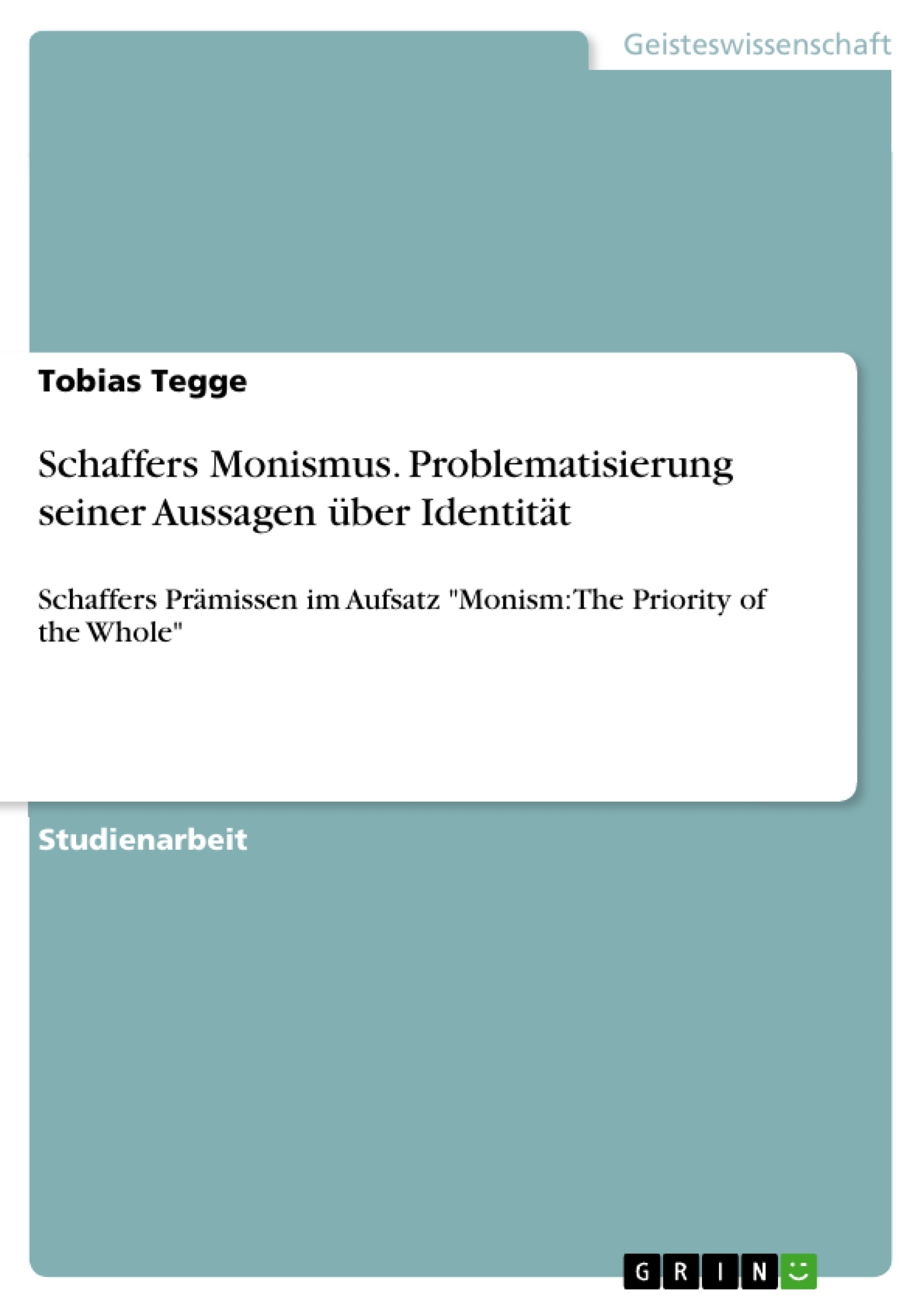In seinem Aufsatz "Monism: The Priority of the Whole" präsentiert Jonathan Schaffer eine Reihe von Argumenten für eine monistische Perspektive auf die Welt. Sein mereologisches Grundgerüst stützt sich dabei unter anderem auf eine Reihe von Aussagen über Identität – oder auch nicht. Ich möchte im Folgenden aufzeigen, warum seine Prämissen in sich unstimmig sind, sofern sie tatsächlich auf Identität bezogen werden und ich möchte erklären, warum Schaffer in besagten Prämissen Aussagen über Identitätsbeziehungen macht. Ich werde nicht auf seine eigentlichen Argumente eingehen, denn diese basieren schon auf den aus meiner Sicht problematischen Annahmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Gliederung
- Jonathan Schaffers mereologischen Prämissen
- Analyse der Annahmen
- Die Annahme von Welt und Teilen
- Die Annahme von Teilbeziehungen, Dependenzbeziehungen, Cx und Bx
- Die Abdeckungsannahme
- Die Annahme, dass sich keine fundamentalen Objekte überlappen
- Die Identitätsprämisse und ihre Interpretationen
- Besteht für Schaffer die Möglichkeit: Identität als Komposition zuzulassen?
- Die common sense-Argumentation
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Prämissen und Argumente von Jonathan Schaffers Monismus-These, wie sie in seinem Aufsatz "Monism: The Priority of the Whole" präsentiert werden. Ziel ist es, die Kohärenz und Plausibilität dieser Prämissen zu überprüfen, insbesondere im Hinblick auf Schaffers Annahme, dass Identität nicht in Komposition besteht. Die Arbeit untersucht, wie diese Annahme zu Widersprüchen führt und ob alternative Interpretationen der Identitätsprämisse den Monismus retten könnten.
- Schaffers mereologische Prämissen und ihre Interpretationen
- Die Problematik der Identitätsprämisse und ihre Auswirkungen auf den Monismus
- Die Rolle des "common sense" in der Kritik an Schaffers Argumentation
- Die Frage nach der ontologischen Fundierung von Teil und Ganzem
- Die Möglichkeit, Objekte als gleichzeitig Ganzes und Teil von Ganzem zu betrachten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Arbeit und ihre Zielsetzung vor. Sie erläutert, dass sich die Arbeit auf die Analyse von Schaffers Prämissen konzentriert und nicht auf die Argumente selbst. Die Arbeit wird in mehreren Schritten aufgebaut, die in der Einleitung vorgestellt werden.
Das zweite Kapitel stellt Schaffers mereologische Prämissen vor. Diese Prämissen beinhalten die Existenz einer Welt (u) als größtes materielles Objekt und die Existenz von Teilen (Cx) dieser Welt. Die Arbeit stellt diese Prämissen in Formalisierungen dar, die Schaffer nicht konsequent verwendet hat.
Das dritte Kapitel analysiert die einzelnen Prämissen. Es wird erläutert, wie Schaffer die Annahme von Welt und Teilen rechtfertigt und welche Probleme sich daraus ergeben. Die Annahme von Teilbeziehungen, Dependenzbeziehungen, Cx und Bx wird ebenfalls analysiert. Die Arbeit stellt die Abdeckungsannahme vor und diskutiert die damit verbundenen Fragen. Die "Kein Überlappen"-Prämisse wird ebenfalls erläutert, und es wird das Argument der Rekombinierbarkeit vorgestellt. Das Kapitel schließt mit der Analyse der Identitätsprämisse und der damit verbundenen Interpretationen.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der "common sense"-Argumentation. Es wird argumentiert, dass Schaffers Monismus dem "common sense" widerspricht, da er nur das Universum als Ganzes priorisiert und nicht jedes andere Objekt als Ganzes betrachtet. Es wird gezeigt, dass Schaffers Perspektive mit unserer Intuition über Objekte wie Planeten, Kieselsteine oder Menschen kollidiert.
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf mögliche Fragestellungen für die zukünftige Forschung. Es wird argumentiert, dass Schaffers Prämissen seine Konklusion vorwegnehmen und dass seine negative Identitätsdefinition zu Widersprüchen führt. Die Arbeit stellt die Frage, ob es alternative Identitätsdefinitionen gibt, die den Monismus retten könnten. Es wird auch die Frage nach der ontologischen Fundierung von Teil und Ganzem aufgeworfen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Monismus, den Pluralismus, die Mereologie, die Identität, die Komposition, die Welt, die Teile, die Abdeckungsannahme, die "Kein Überlappen"-Prämisse, die "Keine Teilhabe"-Prämisse, die "common sense"-Argumentation und die ontologische Fundierung von Teil und Ganzem. Die Arbeit analysiert die Prämissen von Jonathan Schaffers Monismus-These und diskutiert die Probleme, die sich aus seiner Annahme ergeben, dass Identität nicht in Komposition besteht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Jonathan Schaffers Hauptargument für den Monismus?
Schaffer argumentiert, dass das Ganze (das Universum) ontologisch vor seinen Teilen existiert („Priority of the Whole“).
Was ist die Identitätsprämisse im Monismus?
Die umstrittene Annahme, dass Identität nicht in Komposition besteht, was bedeutet, dass das Ganze mehr oder anders ist als die Summe seiner Teile.
Warum wird Schaffers Theorie als unvereinbar mit dem „Common Sense“ angesehen?
Weil unsere Intuition uns sagt, dass einzelne Objekte (Menschen, Planeten) eigenständige fundamentale Entitäten sind und nicht nur abhängige Teile eines Ganzen.
Was ist Mereologie?
Ein Teilbereich der Philosophie und Logik, der sich mit den Beziehungen zwischen Teilen und dem Ganzen befasst.
Was ist die „Kein Überlappen“-Prämisse?
Die Annahme, dass sich fundamentale Objekte im Raum nicht gegenseitig überschneiden dürfen, um ihre Identität zu wahren.
- Arbeit zitieren
- Tobias Tegge (Autor:in), 2012, Schaffers Monismus. Problematisierung seiner Aussagen über Identität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274956