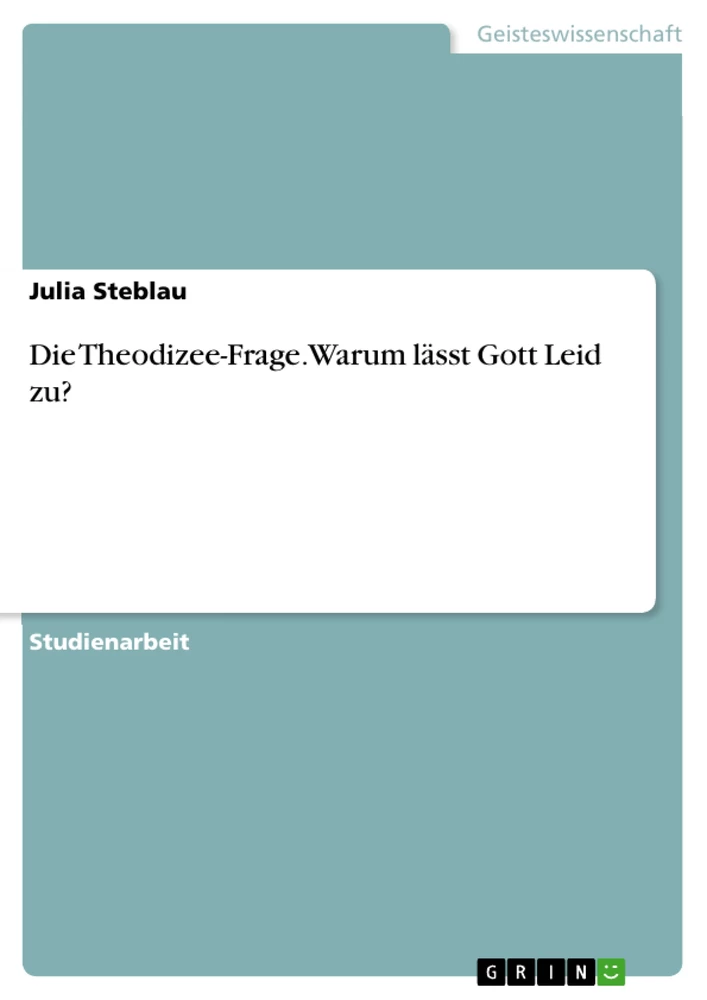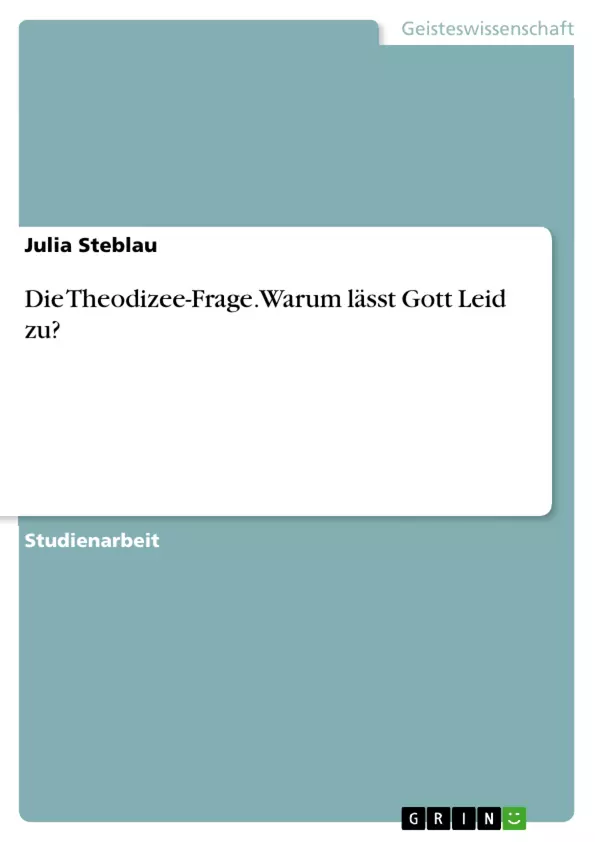Aus dem Leiden in der Welt schließen Atheisten und Religionskritiker, dass es keinen Gott geben kann, der über all dem steht und scheinbar nichts tut.
Joachim Kahl, ein Theologe und überzeugter Atheist, formuliert das eigentliche Problem mit der Frage „Wie kann ein angeblich liebender Gott, bei dem kein Ding unmöglich ist, die Lebewesen, die er doch geschaffen hat, so unsäglich leiden lassen?“ Wäre Gott ein schwacher und handlungsunfähiger Gott, wäre es verständlich, dass er nicht eingreift. Wie Kahl aber andeutet, ist für den Gott, an den die Menschen glauben und der sich selbst als „den Allmächtigen“ bezeichnet, nichts unmöglich. Erkennbar wird ein Widerspruch zwischen dem Leid auf der Welt und Gott als liebendem Vater.
Genau diese Aussage bezeichnet den Kern des Problems. Gott ist voller Liebe für den Menschen, der Mensch leidet und es widerfährt Böses, Gott könnte das Leid verhindern, tut es jedoch nicht. Gibt es möglicherweise Gründe dafür, warum Gott trotz seiner Liebe und Allmacht nicht eingreift, wenn die Menschen leiden?
Zahlreiche Theologen und Philosophen setzen sich mit der Frage, warum Gott Leid zulässt, auseinander. Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, hatte dem Problem den Namen Theodizee, der aus dem Altgriechen kommt (θεός (theos) = „Gott“ und δίκη (dike) = „Gerechtigkeit“) und „Rechtfertigung Gottes“ bedeutet, gegeben. Dieser Terminus wird in der Theologie für die Beschreibung dieses Problems verwendet.
Aber was ist nun eigentlich genau dieses Theodizee-Problem?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie ist Gott?
- Warum lässt Gott dieses Leid zu?
- Hauptteil: Warum lässt Gott Leid zu?
- Eine Welt ohne Leid
- Freiheit
- Gottes Mitleid
- Erlösung aus dem Leid
- Der Engelsturz als Ursprung des Bösem
- Diskussion Hat das Leiden einen Sinn?
- Das Buch Hiob
- Der Prolog
- Der Redeteil
- Die Position der drei Freunde
- Die Position Hiobs
- Gott spricht zu Hiob
- Der Epilog
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, warum Gott Leid zulässt, und analysiert verschiedene Ansätze aus der Theologie und Philosophie, um das Theodizee-Problem zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Eigenschaften Gottes, die Rolle des freien Willens, die Erlösungslehre und die Geschichte Hiobs, um ein tieferes Verständnis für das Leid in der Welt zu gewinnen.
- Die Eigenschaften Gottes (Güte, Liebe, Allmacht, Allwissenheit)
- Der freie Wille des Menschen und seine Auswirkungen auf das Leid
- Die Erlösungslehre und die Rolle des Leides in der christlichen Theologie
- Die Geschichte Hiobs als Beispiel für das Leiden des Unschuldigen
- Die Frage nach dem Sinn des Leides und die Suche nach Trost und Hoffnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema "Mensch und Leid" ein und erläutert die Problematik des Theodizee-Problems. Sie stellt die Frage, wie ein allmächtiger und liebender Gott Leid zulassen kann, und beleuchtet die Widersprüchlichkeit zwischen Gottes Eigenschaften und der Existenz von Leid in der Welt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Frage, wie Gott ist. Es werden verschiedene Bilder und Eigenschaften Gottes aus der Bibel beleuchtet, darunter die Güte, die Barmherzigkeit, die Allgegenwärtigkeit und die Allmacht Gottes. Es wird deutlich, dass Gott ein komplexes Wesen ist, das für den Menschen nur schwer zu begreifen ist.
Das dritte Kapitel widmet sich der Frage, warum Gott Leid zulässt. Es werden verschiedene Theorien vorgestellt, darunter die Theodizee von Gottfried Wilhelm Leibniz, die die Welt als "beste aller möglichen Welten" beschreibt. Leibniz argumentiert, dass Leid notwendig ist, um die Freiheit des Menschen zu gewährleisten und die Vollkommenheit Gottes zu unterstreichen. Es werden verschiedene Arten von Leid (metaphysisches, moralisches, physisches) unterschieden und die Rolle des Leides in der Schöpfungsordnung diskutiert.
Der Hauptteil der Arbeit untersucht verschiedene Aspekte, die mit der Frage nach dem Leid zusammenhängen. Es wird die Frage gestellt, ob eine Welt ohne Leid eine bessere Welt wäre, und die Bedeutung des freien Willens für die Existenz von Leid hervorgehoben. Es wird die Rolle des Mitleids Gottes und die Hoffnung auf Erlösung aus dem Leid diskutiert.
Das Kapitel "Der Engelsturz als Ursprung des Bösem" beleuchtet die Rolle der Engel im christlichen Weltbild und untersucht die Frage, warum Engel böse werden können. Es werden verschiedene Theorien zum Engelsturz vorgestellt, darunter die Lust am Geschlechtsverkehr mit Menschen, die Neugier auf Gottes Weisheit, die Sehnsucht nach Freiheit und der Stolz der Engel.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Frage, ob das Leiden einen Sinn hat. Es wird die Geschichte Josefs aus dem Alten Testament als Beispiel für die Verwendung von Leid durch Gott zur Rettung eines Volkes dargestellt. Das Buch Hiob wird als ein weiteres Beispiel für das Leiden des Unschuldigen herangezogen und die verschiedenen Positionen von Hiob und seinen Freunden im Hinblick auf das Theodizee-Problem analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Theodizee-Problem, das Leid in der Welt, die Eigenschaften Gottes, den freien Willen des Menschen, die Erlösungslehre, die Geschichte Hiobs, die Engel, das Böse, der Sinn des Leides, Trost und Hoffnung.
- Quote paper
- M. Ed. Julia Steblau (Author), 2013, Die Theodizee-Frage. Warum lässt Gott Leid zu?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275026