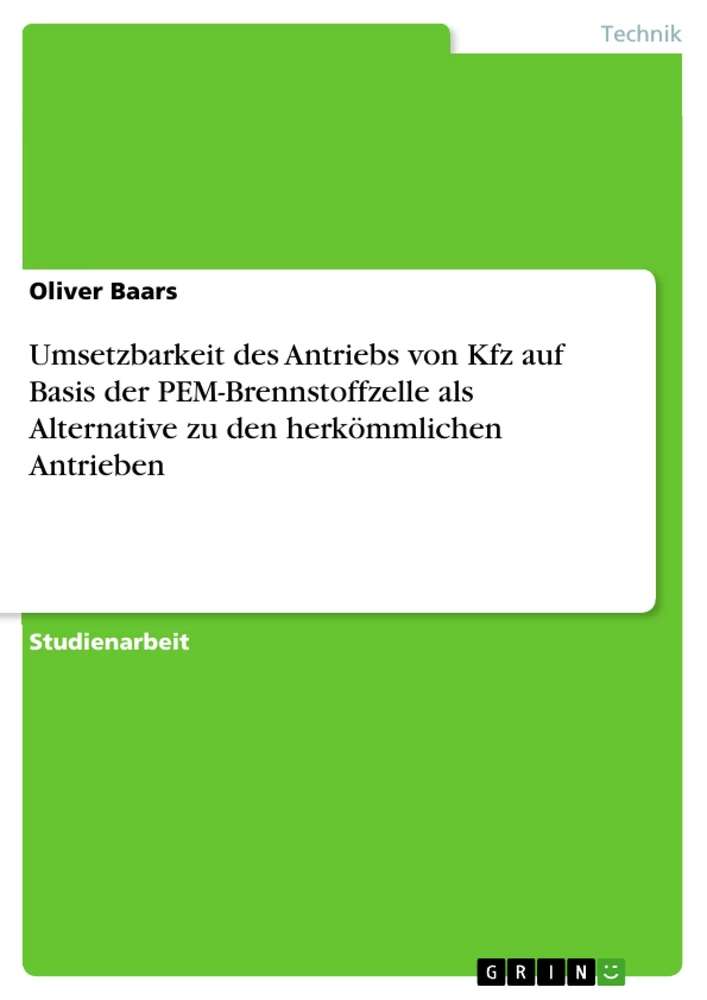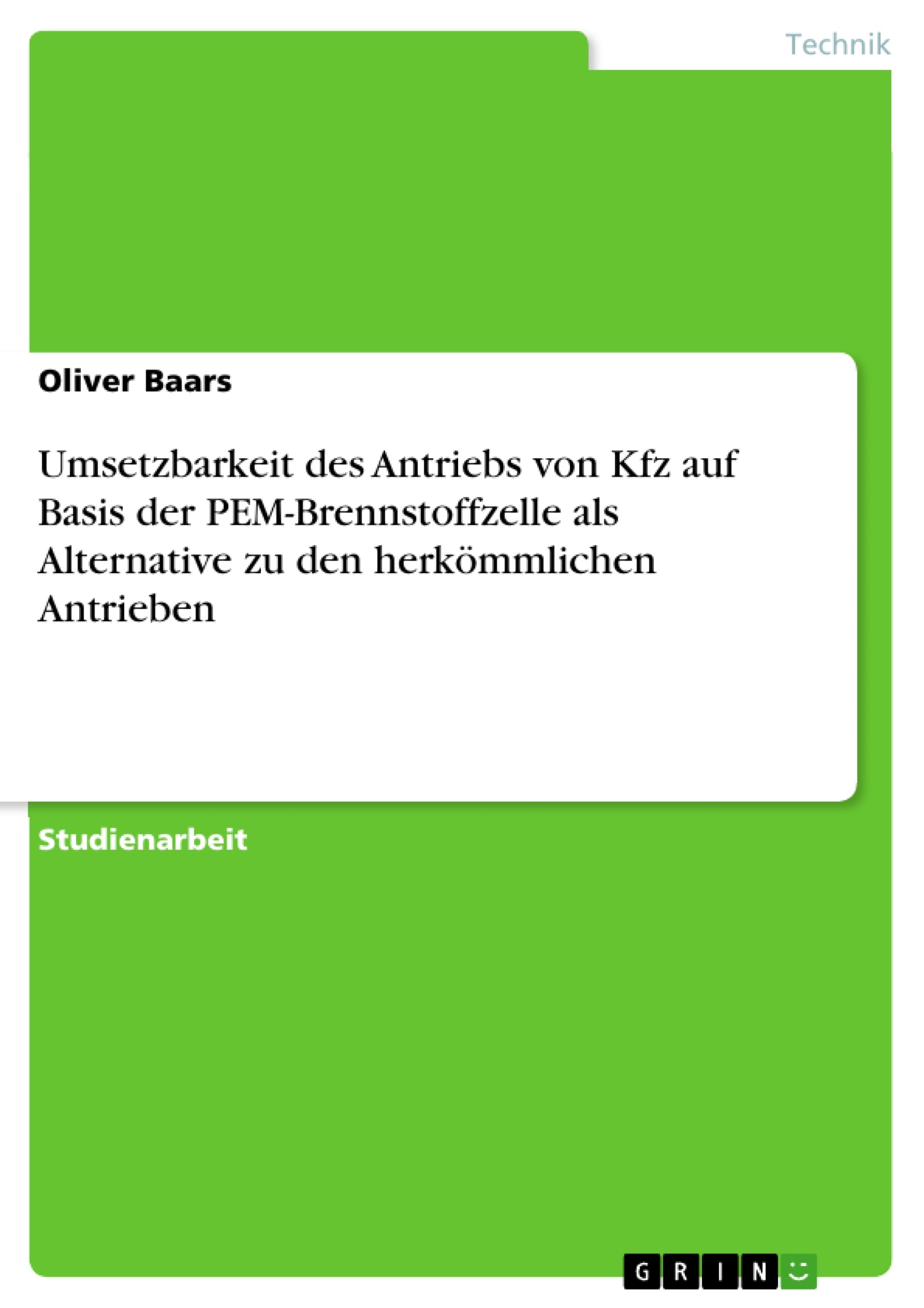Wasser ist die Kohle der Zukunft."
-Jules Verne, Die geheimnisvolle Insel, 1874
Diese Vision des französischen Science-Fiction Autors könnte ebenso gut aus einer aktuellen Presseerklärung eines Automobilkonzerns stammen, und was damals utopisch anmutete, ist mittlerweile zu einer vieldiskutierten Zukunftsoption für unsere energiehungrige Gesellschaft geworden. Neben anderen Anwendungsgebieten wurde insbesondere in der Automobilbranche mit mehreren sogenannten "Concept-Cars" bewiesen, dass von Utopie keine Rede mehr sein kann. Doch die Technik zur wundersamen Energiegewinnung aus den Elementen des Wassers ist schon alt.
Die sogenannte Brennstoffzelle wurde bereits 1839 von dem englischen Physiker William Grove entwickelt, geriet aber nach der Entdeckung des elektrodynamischen Prinzips 1866 durch Werner von Siemens und der Erfindung des Automobils mit Verbrennungsmotor 1885 zunächst wieder in Vergessenheit. Die Energiegewinnung durch Verbrennung fossiler Energieträger war viel einfacher als die komplizierte, noch weitgehend unerforschte elektrochemische Variante.
Erst die Raumfahrt und das Militär entdeckten die Brennstoffzelle für ihre Zwecke wieder, da sich Verbrennungsmotoren in Unterseebooten und in Raumschiffen nicht immer eignen. 1963 lag das erste komplette Polymerelektrolytmembran (PEM) - Brennstoffzellensystem vor, das dann bei allen sieben Gemini-Missionen eingesetzt wurde. Siemens entwickelte die Technik in den 80er Jahren zum Antrieb von außenluftunabhängigen U-Booten weiter. Die bis dato eingesetzten Brennstoffzellen kamen wegen Größe und Preis für die Verwendung im mobilen zivilen Bereich jedoch nicht in Frage.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Geschichtliche Entwicklung der Brennstoffzellentechnik
- 1.2 Aufgabenstellung der Arbeit
- 2. Umsetzbarkeit des Antriebs von Kfz auf Basis der PEM-Brennstoffzelle als Alternative zu den herkömmlichen Antrieben
- 2.1 Motivation der Unternehmen zur Forschung an alternativen Antriebskonzepten
- 2.1.1 Erdölknappheit
- 2.1.2 Emissionsauflagen durch Gesetze
- 2.1.3 Public Relations und verändertes Käuferverhalten
- 2.2 Gründe für den Einsatz von Brennstoffzellen
- 2.2.1 Funktionsweise der PEM-Brennstoffzelle
- 2.2.2 Einordnung in die Palette der Antriebskonzepte
- 2.2.3 Grundsätzliche Vorteile der Brennstoffzellentechnik
- 2.3 Probleme der Brennstoffzellentechnik und Lösungsansätze
- 2.3.1 Realisierung der Wasserstoffbereitstellung
- 2.3.1.1 Direkte Betankung mit Wasserstoff
- 2.3.1.1.1 Vorgelagerte Prozessschritte
- 2.3.1.1.2 Verteilung
- 2.3.1.1.3 Speicherung im Fahrzeug und Sicherheit
- 2.3.1.2 Erzeugung im Fahrzeug aus KW
- 2.3.1.2.1 Einsatz eines Reformers
- 2.3.1.2.2 Einsatz von DMFCS
- 2.3.1.1 Direkte Betankung mit Wasserstoff
- 2.3.2 Probleme bei der PEMFC
- 2.3.3 Kostenaspekte
- 2.3.1 Realisierung der Wasserstoffbereitstellung
- 2.4 Bewertung
- 2.4.1 Ökologischer Vergleich mit konventionellen Verbrennungsmotoren
- 2.4.2 Brennstoffzelleneinsatz in Kraftfahrzeugen als Alternative
- 2.1 Motivation der Unternehmen zur Forschung an alternativen Antriebskonzepten
- 3. Brennstoffzelleneinsatz in anderen Bereichen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Umsetzbarkeit des Antriebs von Kraftfahrzeugen auf Basis der PEM-Brennstoffzelle als Alternative zu herkömmlichen Antrieben. Ziel ist es, die Motivation der Unternehmen zur Forschung an alternativen Antriebsformen aufzuzeigen, die Funktionsweise der Brennstoffzelle zu erklären und die Vor- und Nachteile dieser Technologie im Vergleich zu konventionellen Antrieben zu beleuchten. Darüber hinaus werden Probleme bei der Realisierung der Brennstoffzellentechnologie und mögliche Lösungsansätze diskutiert.
- Motivation der Unternehmen zur Forschung an alternativen Antriebskonzepten
- Funktionsweise und Vorteile der PEM-Brennstoffzelle
- Realisierung der Wasserstoffbereitstellung und Probleme der Brennstoffzellentechnik
- Ökologische Bewertung und Vergleich mit konventionellen Verbrennungsmotoren
- Zukunftspotenzial der Brennstoffzellentechnologie im Automobilbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung der Brennstoffzellentechnik und erläutert die Aufgabenstellung der Arbeit. Kapitel 2 analysiert die Umsetzbarkeit des Antriebs von Kfz auf Basis der PEM-Brennstoffzelle als Alternative zu herkömmlichen Antrieben. Dabei werden die Motivation der Unternehmen zur Forschung an alternativen Antriebsformen, die Funktionsweise der Brennstoffzelle und ihre Vor- und Nachteile im Detail untersucht. Die Realisierung der Wasserstoffbereitstellung, die Probleme der Brennstoffzellentechnik und mögliche Lösungsansätze werden ebenfalls diskutiert. Schließlich erfolgt eine ökologische Bewertung der Brennstoffzellentechnologie im Vergleich zu konventionellen Verbrennungsmotoren.
Schlüsselwörter
PEM-Brennstoffzelle, alternative Antriebe, Wasserstoff, Erdölknappheit, Emissionsauflagen, ökologische Bewertung, Zukunftspotenzial, Automobilindustrie, Nachhaltigkeit, Energiegewinnung, Elektrochemie, Antriebstechnik, Wasserstoffbereitstellung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine PEM-Brennstoffzelle?
PEM steht für Polymerelektrolytmembran. Diese Brennstoffzelle wandelt chemische Energie aus Wasserstoff und Sauerstoff direkt in elektrische Energie um, wobei als Nebenprodukt lediglich Wasser entsteht.
Warum forschen Automobilhersteller an Brennstoffzellen-Antrieben?
Die Hauptmotive sind die drohende Erdölknappheit, strengere gesetzliche Emissionsauflagen sowie der Wunsch nach einem positiven Image durch nachhaltige Technologien.
Welche Vorteile bietet die Brennstoffzellentechnik gegenüber Verbrennungsmotoren?
Zu den Vorteilen zählen die lokale Emissionsfreiheit (nur Wasserdampf), ein hoher Wirkungsgrad und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
Welche Probleme gibt es bei der Umsetzung von Wasserstoff-Autos?
Herausforderungen liegen in der flächendeckenden Wasserstoffbereitstellung (Infrastruktur), der sicheren Speicherung im Fahrzeug sowie den aktuell noch sehr hohen Produktionskosten.
Seit wann gibt es die Technologie der Brennstoffzelle?
Die Brennstoffzelle wurde bereits 1839 von William Grove entwickelt, geriet aber durch den Erfolg des Verbrennungsmotors zunächst in Vergessenheit, bevor sie in der Raumfahrt (1960er Jahre) wiederentdeckt wurde.
- Quote paper
- Oliver Baars (Author), 2002, Umsetzbarkeit des Antriebs von Kfz auf Basis der PEM-Brennstoffzelle als Alternative zu den herkömmlichen Antrieben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2751