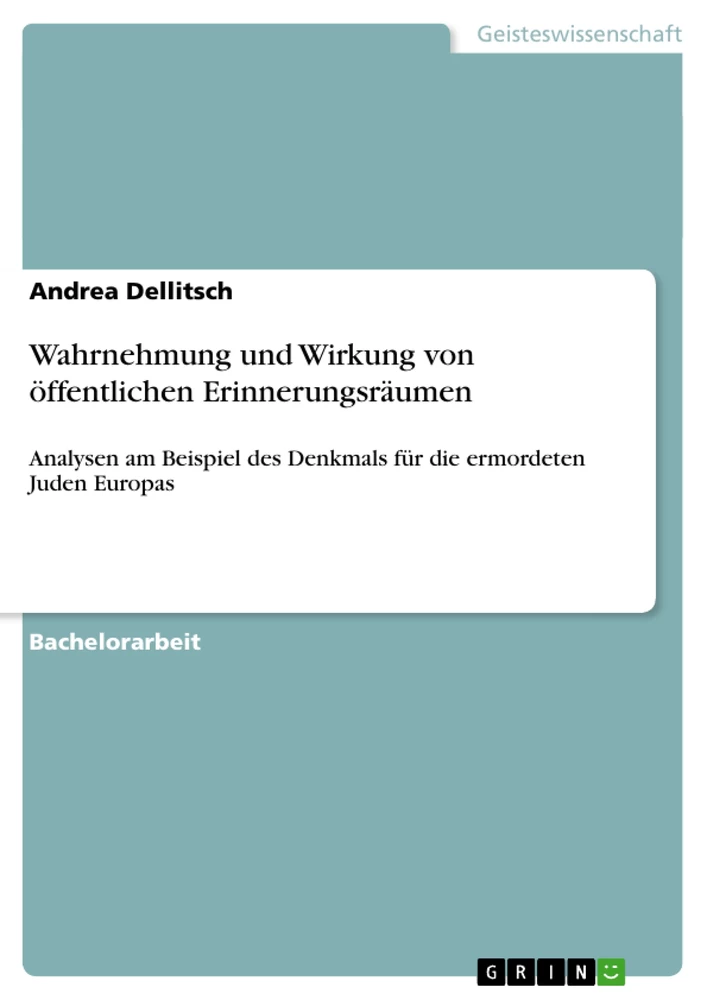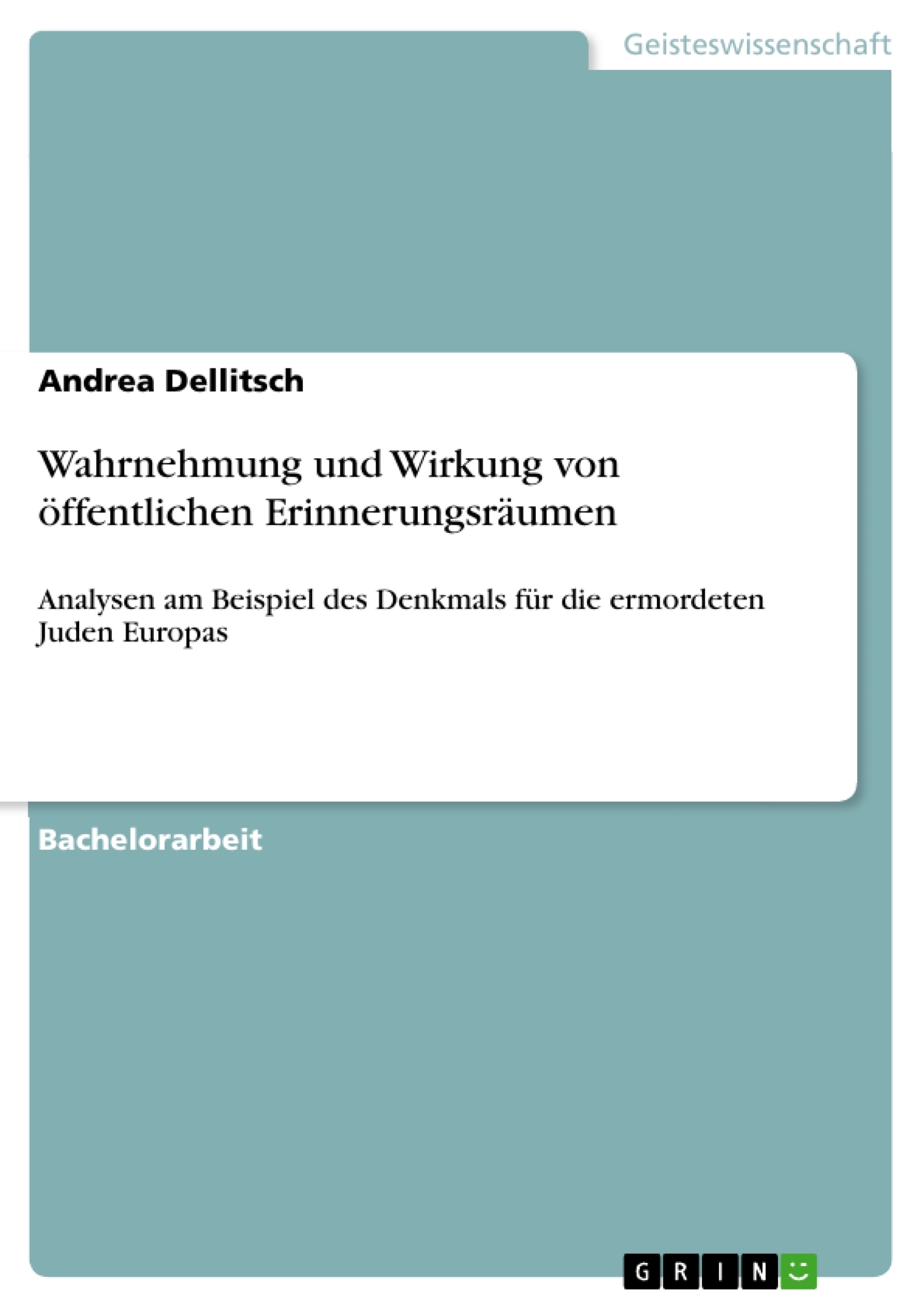„Wenn ich hier langgehe, und es kommen die Gedanken an die grausame Zeit, dann habe ich das Gefühl, meine Eltern, sämtliche Freundinnen und alle Verwandten, die ich in der Schoa verloren habe, sind hier begraben, und ich bin ihnen ganz nah.“ (Inge Borck in Kühn, 2010).
Diese Aussage einer Überlebenden des Holocausts beim Besuch des „Denkmals für die ermordeten Juden Europas“ beschreibt, welche individuellen Emotionen beim Durchschreiten eines Raumes ausgelöst werden können, wenn er mit Erinnerungen in Beziehung gesetzt werden kann. Aber können solche individuellen Wahrnehmungen auch Auswirkungen auf die Gesellschaft haben? Kann man mit dem Raumkonzept eines öffentlichen Raumes die Erinnerungen an geschichtliche Ereignisse der Vergangenheit lebendig halten und somit auch künftige Generationen daran teilhaben lassen? Diese Fragen sind vor allem dann von großer Bedeutung, wenn es sich um die Erinnerung an die Opfer von grausamen Verbrechen durch die Allgemeinheit handelt, deren Andenken vor einer Wiederholung solcher Taten warnen soll. Relevant ist das Thema auch, da im speziellen für die Zeit des Nationalsozialismus die Generation der Zeitzeugen auszusterben beginnt und somit ein unwiederbringlicher Verlust an persönlichen Erinnerungen bevorsteht.
Zentrale Frage der vorliegenden Bachelorarbeit ist, welche Arten der Wahrnehmung bei der Begehung öffentlicher Erinnerungsräume Auswirkungen auf das Individuum und auf die Gesellschaft haben können. Zur Beantwortung dieser Frage muss zuerst geklärt werden, welche Voraussetzungen auf die Wahrnehmung eines Erinnerungsraums Einfluss nehmen und analysiert werden, welche unterschiedlichen Arten der Wahrnehmung möglich sind.
Im ersten Teil der Bachelorarbeit wird auf den theoretischen Hintergrund für die Beantwortung der Fragestellungen eingegangen. Hier wird von drei soziologischen Basistheorien ausgegangen und diese im Zusammenhang zueinander gestellt. Es handelt sich erstens um die Theorien des kollektiven Bewusstseins (Durkheim, 1988) und des kollektiven Gedächtnisses (Halbwachs, 1967), zweitens um die Theorien zur „Soziologie der Emotionen“ (Flam, 2002) und drittens um eine Theorie der Raumsoziologie (Löw, 2000).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Basistheorien
- Kollektives Bewusstsein und kollektives Gedächtnis
- Kollektives Bewusstsein
- Kollektives Gedächtnis
- Das kulturelle Gedächtnis
- Soziologie der Emotionen
- Raumsoziologie
- Kollektives Bewusstsein und kollektives Gedächtnis
- Zusammenspiel der Theorien
- Gedächtnistheorie—Raumsoziologie
- Gedächtnistheorie—Soziologie der Emotionen
- Raumsoziologie — Soziologie der Emotionen
- Zusammenfassung und Hypothese
- Forschungsmethode „Qualitative Inhaltsanalyse"
- Qualitative Inhaltsanalyse als Forschungsmethode
- Vorgehensweise am Beispiel des Denkmals für die ermordeten Juden Europas
- Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas
- Chronik, Architektur und Eröffnung des Denkmals
- Chronik
- Architektur
- Das Stelenfeld
- Der Ort der Information
- Der New Yorker Architekt Peter Eisenman
- Die Eröffnung des Denkmals
- Debatten um das Denkmal
- Die Debatte um die Baustofffirma Degussa
- Die Debatte um einen Zahn
- Metaphern als Ausdruck der Wahrnehmung
- Emotionen und Verhalten der Besucher
- Wahrnehmung, über die in Form von Emotionen berichtet wurde
- Wahrnehmung, über die in Form von Verhalten berichtet wurde
- Chronik, Architektur und Eröffnung des Denkmals
- Ergebnisse aus Theorie und Forschung
- Faktoren, die die Wahrnehmung beeinflussen
- Wahrnehmungen, die durch die Zugehörigkeit des Besuchers zu einer gesellschaftlichen Gruppe beeinflusst werden
- Wahrnehmungen, die durch die Architektur und die Atmosphäre des Raums beeinflusst werden
- Wahrnehmungen, die durch andere Faktoren beeinflusst werden
- Veränderungen in der Wahrnehmung
- Faktoren, die die Wahrnehmung beeinflussen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Wissenschaftliches Material
- Empirisches Material für die Inhaltsanalyse
- Anhang
- Abbildungen
- Tabellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Wahrnehmung und Wirkung von öffentlichen Erinnerungsräumen. Ziel ist es, zu analysieren, wie die Wahrnehmung eines solchen Raumes, am Beispiel des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin, das Individuum und die Gesellschaft beeinflussen kann. Dabei wird untersucht, welche Faktoren die Wahrnehmung des Denkmals beeinflussen und welche Auswirkungen diese auf das kollektive Gedächtnis und die sozialen Strukturen haben.
- Die Rolle des kollektiven Bewusstseins und des kollektiven Gedächtnisses in der Wahrnehmung von Erinnerungsräumen
- Der Einfluss von Emotionen und der Identifikation mit den Opfern auf die Wahrnehmung des Denkmals
- Die Bedeutung der Raumsoziologie und des dynamischen Raumkonzepts für die Analyse der Wahrnehmung und Wirkung von Erinnerungsräumen
- Die Bedeutung von Architektur und Atmosphäre des Denkmals für die emotionale Wahrnehmung der Besucher
- Die Auswirkungen von unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeiten und Verhaltensweisen der Besucher auf die Wahrnehmung des Denkmals
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Wahrnehmung und Wirkung von öffentlichen Erinnerungsräumen. Der erste Teil der Arbeit widmet sich den theoretischen Grundlagen und stellt drei soziologische Basistheorien vor: die Theorien des kollektiven Bewusstseins und des kollektiven Gedächtnisses, die Soziologie der Emotionen und die Raumsoziologie. Im zweiten Teil wird die Forschungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt und deren Anwendung am Beispiel des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin erläutert. Der dritte Teil der Arbeit beschreibt das Denkmal selbst, einschließlich seiner Chronik, Architektur und Eröffnung. Außerdem werden Debatten um das Denkmal, insbesondere die um die Baustofffirma Degussa und die um einen Zahn, näher beleuchtet. Der vierte Teil der Arbeit analysiert die Wahrnehmung des Denkmals durch die Besucher, wobei die Emotionen und das Verhalten der Besucher im Fokus stehen. Der fünfte Teil der Arbeit fasst die Ergebnisse aus Theorie und Forschung zusammen und beleuchtet die Faktoren, die die Wahrnehmung des Denkmals beeinflussen. Abschließend wird auf Veränderungen in der Wahrnehmung des Denkmals im Laufe der Zeit eingegangen und die Bedeutung von öffentlichen Erinnerungsräumen für die Aufrechterhaltung des kollektiven Gedächtnisses und die Bewältigung der Vergangenheit betont.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen öffentliche Erinnerungsräume, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin, Wahrnehmung, Emotionen, kollektives Bewusstsein, kollektives Gedächtnis, Raumsoziologie, Architektur, Atmosphäre, Besucherverhalten, Gruppenzugehörigkeit, Identifikation, Holocaust, Geschichte, Erinnerungskultur, soziale Strukturen, Strukturdynamiken, Abweichungsverstärkung, Abweichungsdämpfung.
- Quote paper
- Andrea Dellitsch (Author), 2014, Wahrnehmung und Wirkung von öffentlichen Erinnerungsräumen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275171