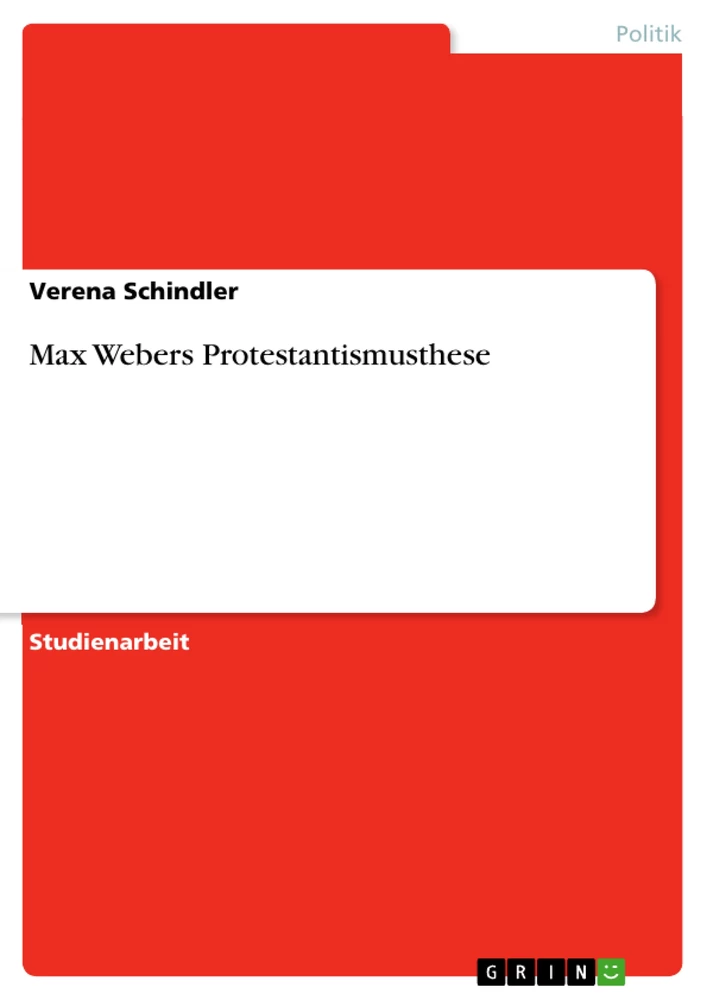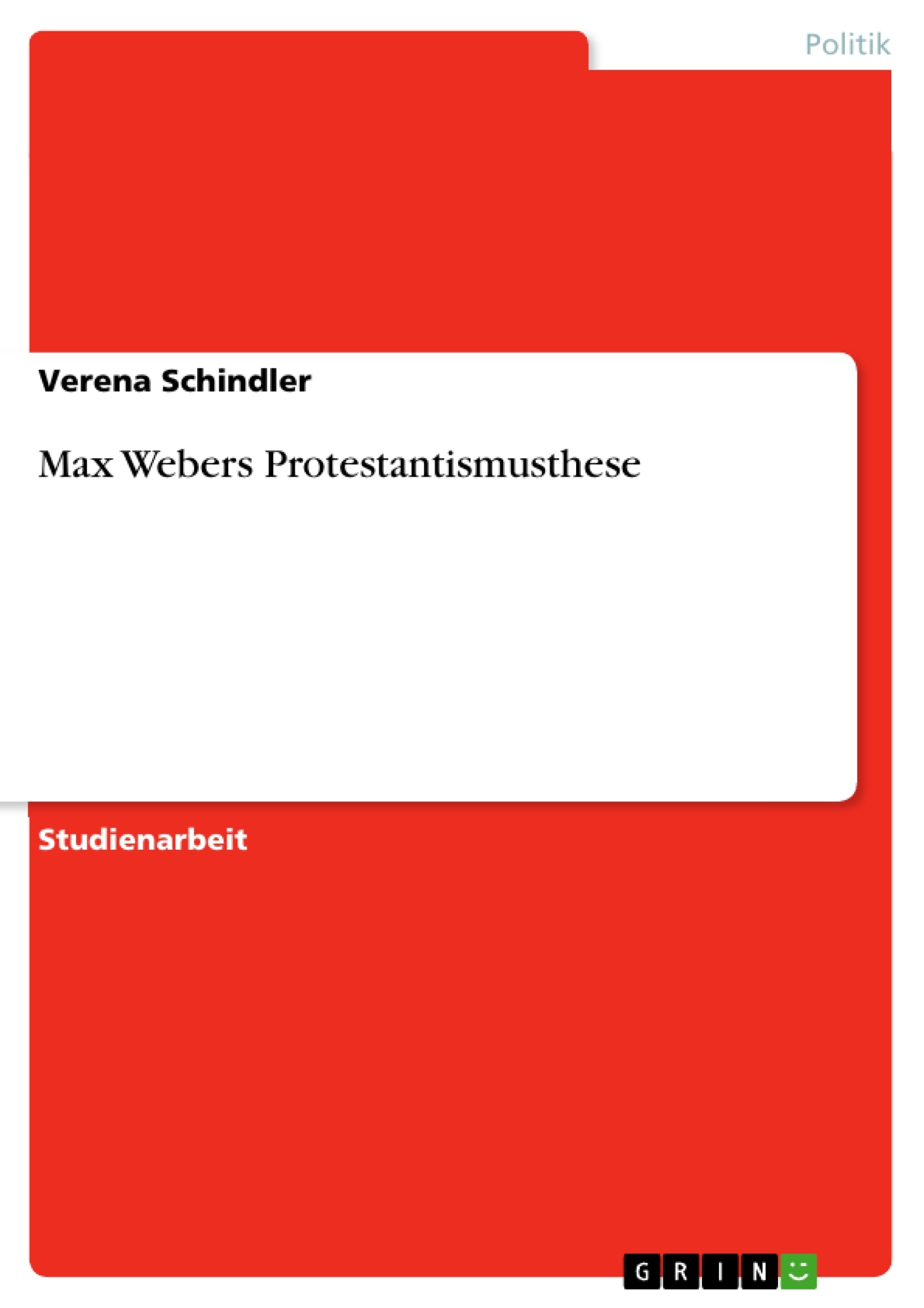Max Weber stellt sich die Frage, warum unsere moderne Kultur, wie wir sie heute kennen, gerade in Westeuropa entstanden sei und sich nicht zum Beispiel in China oder Indien entwickelt habe. Antwort auf diese Frage gibt er mit seiner Theorie des Rationalismus, mit der er sich fast sein Leben lang beschäftigt. Besonders wichtig ist ihm somit auch die Frage nach der Entstehung des Kapitalismus und einer Wirtschaftsgesinnung. In seinem Werk „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ entwickelt er die These, dass eine Wahlverwandtschaft zwischen protestantischer Ethik und Geist des Kapitalismus besteht. Im Folgenden meiner Hausarbeit widme ich mich nun der Frage, mit welchen Argumenten Max Weber diese Wahlverwandtschaft belegt. Hierbei werde ich zuerst auf den Begriff „Geist des Kapitalismus“ eingehen, als nächstes Martin Luthers These vom „Beruf als Berufung“ erläutern, anschließend den Calvinismus mit seinen Lehren beleuchten, dann auf die ökonomischen Auswirkungen eingehen und zuletzt ein Fazit ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Entstehung des Kapitalismus
- „Geist des Kapitalismus"
- Luthers „Beruf als Berufung"
- Calvinismus
- Lehre von der Gnadenwahl
- Vergleich der praktischen Religiosität
- Verweltlichung und ökonomische Auswirkungen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Max Webers These einer Wahlverwandtschaft zwischen protestantischer Ethik und dem Geist des Kapitalismus. Sie untersucht, welche Argumente Weber für diese Verbindung anführt und beleuchtet dabei die Entstehung des Kapitalismus, die protestantische Ethik und ihre ökonomischen Auswirkungen.
- Entstehung des Kapitalismus und die Rolle des "Geist des Kapitalismus"
- Die Bedeutung von Luthers "Beruf als Berufung" für die protestantische Ethik
- Die Lehre von der Gnadenwahl im Calvinismus und ihre Auswirkungen auf die Lebensführung
- Die Verweltlichung und ökonomischen Folgen der protestantischen Ethik
- Webers These der Wahlverwandtschaft zwischen protestantischer Ethik und Kapitalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Entstehung des Kapitalismus und der Frage, warum dieser gerade in Westeuropa entstanden ist. Max Weber führt den "Geist des Kapitalismus" als entscheidenden Faktor ein, der sich durch eine ethisch gefärbte Maxime der Lebensführung auszeichnet, die auf den Erwerb und die Akkumulation von Kapital fokussiert. Benjamin Franklin wird als Beispiel für diesen "Geist des Kapitalismus" herangezogen.
Im zweiten Kapitel analysiert Weber die Rolle von Martin Luthers "Beruf als Berufung" für die protestantische Ethik. Luther sah den Beruf als gottgegebene Aufgabe und hob die Bedeutung der Alltagsarbeit hervor. Durch diese neue Sichtweise gewann die Arbeit eine religiöse Bedeutung, und die Erfüllung der beruflichen Pflichten wurde als Weg zur Gottgefälligkeit angesehen.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Calvinismus und insbesondere der Lehre von der Gnadenwahl. Diese Lehre besagt, dass Gottes Entscheidungen über die Seligkeit oder Verdammnis der Menschen bereits vor deren Geburt feststehen. Die Folgen dieser Lehre waren weitreichend: Sie führte zu einem egoistischen Individualismus, einer rastlosen Berufsarbeit und einer strengen, asketischen Lebensführung. Weber stellt den Calvinismus dem Luthertum und dem Katholizismus gegenüber und zeigt die Unterschiede in ihrer praktischen Religiosität auf.
Im vierten Kapitel untersucht Weber die Verweltlichung und ökonomischen Auswirkungen der protestantischen Ethik. Er analysiert die indirekten und direkten Einflüsse der puritanischen Lebensauffassung auf das Erwerbsleben. Die Puritaner sahen Reichtum als gefährlich an, wenn er zur Genüsslichkeit und zum Verzicht auf das Streben nach dem heiligen Leben führte. Zeit wurde als kostbar betrachtet, und die Arbeit stand an oberster Stelle. Arbeitsteilung, Berufsmobilität und Armut wurden ebenfalls im Kontext der puritanischen Ethik betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den "Geist des Kapitalismus", die protestantische Ethik, die Reformation, Martin Luther, den Calvinismus, die Lehre von der Gnadenwahl, die Prädestinationslehre, die innerweltliche Askese, die Verweltlichung und die ökonomischen Auswirkungen der protestantischen Ethik. Max Webers These der Wahlverwandtschaft zwischen protestantischer Ethik und Kapitalismus steht im Zentrum der Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Max Webers Protestantismusthese?
Weber postuliert eine „Wahlverwandtschaft“ zwischen der protestantischen Ethik (insbesondere dem Calvinismus) und dem Geist des modernen Kapitalismus.
Was meint Weber mit dem „Geist des Kapitalismus“?
Damit ist eine Lebensführung gemeint, die auf rationalem Erwerb, Sparsamkeit und der Akkumulation von Kapital als ethische Pflicht basiert.
Welche Rolle spielt Luthers Begriff des „Berufs“?
Martin Luther interpretierte den weltlichen Beruf als „Berufung“ und gottgegebene Aufgabe, was der täglichen Arbeit eine religiöse Würde verlieh.
Wie beeinflusste der Calvinismus das Wirtschaftsverhalten?
Durch die Lehre von der Gnadenwahl (Prädestination) suchten Gläubige im wirtschaftlichen Erfolg eine Bestätigung ihrer Auserwähltheit, was zu rastloser Arbeit und Askese führte.
Was ist „innerweltliche Askese“?
Es ist der Verzicht auf Genuss und Luxus trotz Reichtums, wobei die Arbeit selbst zum Selbstzweck und Gottesdienst wird.
- Quote paper
- Verena Schindler (Author), 2012, Max Webers Protestantismusthese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275236